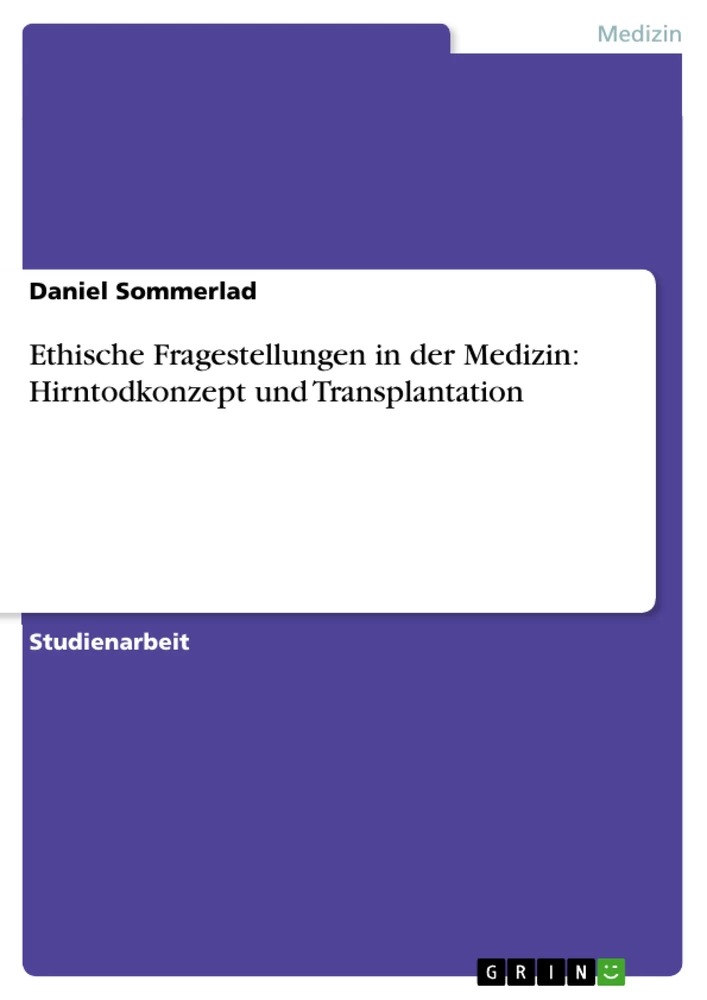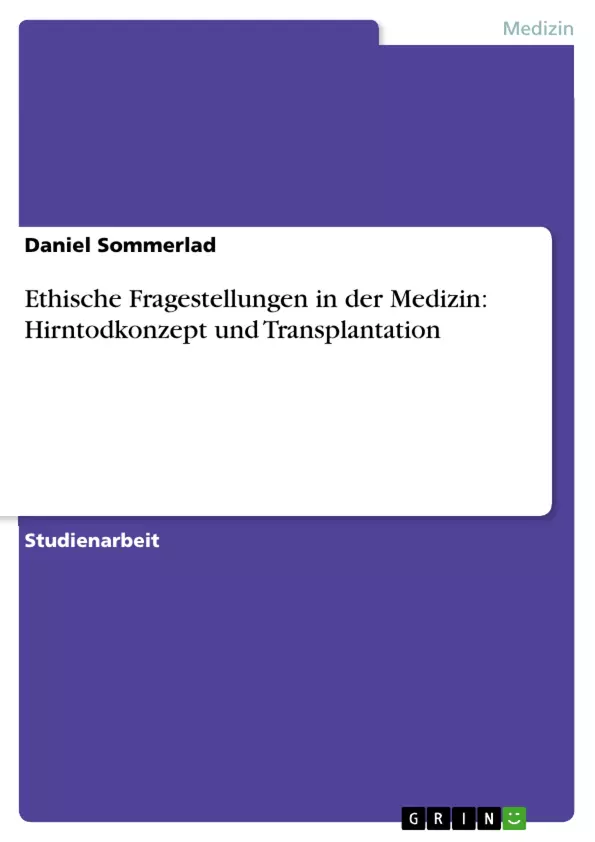Einleitung
Als im Jahr 1967 dem südafrikanischen Chirurgen Christiaan Barnard die erste Herztrans-plantation gelang, geschah dies vor dem Hintergrund eines Paradigmenwechsels im Zuge der sich entwickelnden Intensivmedizin, die scheinbar klinisch "tote" Patienten mittels Reanimation erstmals wieder zum Leben erwecken konnte.
Parallel in verschiedenen Staaten begannen deshalb Ärzte in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die bestehende Definition des Todes auf der Grundlage des Herz-Kreislauf-Stillstands infrage zu stellen und eine Neudefinition zu fordern. Offizielle Stellungnahmen wie die des "Ad Hoc Committee" der Harvard Medical School führten bald zur Durchsetzung eines neuen Hirntod-Kriteriums, nachdem die Arbeit 1968 unter dem Titel "A definition of irreversible coma" erschienen war(1) .
Intensive Diskussionen hatten in Deutschland schon vor der Veröffentlichung der Harvard-Kriterien begonnen, und 1968 schlossen sich ebenfalls die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie und die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie der neuen Hirntod-Definition an.
[...]
_____
1 "A definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death." JAMA 1968 Aug 5;205(6):337-40 (im folgenden zitiert als Harvard-Report)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Hirntod – Eine pragmatische Umdefinierung des Todes?
- 1. Der Vorwurf der pragmatischen Umdefinierung
- 2. Quantes Entgegnung auf die Kritik
- II. Ebenen der Hirntoddiskussion
- 1. Begrifflich-definitorische Ebene
- 2. Ethisch-pragmatische Ebene
- III. Zusammenhang zwischen Hirntod und Transplantation
- 1. Die ethische Problematik der Organentnahme
- 2. Der Bezugspunkt Tod in der Transplantation
- IV. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Hirntod und Organtransplantation im Hinblick auf seine ethisch-moralische Dimension. Im Fokus steht dabei insbesondere der Vorwurf der „pragmatischen Umdefinierung“ des Todes durch das Hirntodkriterium.
- Die Geschichte des Hirntodkriteriums und seine Einführung im Kontext der Organtransplantation
- Die verschiedenen Ebenen der Hirntoddiskussion: begrifflich-definitorische und ethisch-pragmatische Ebene
- Die ethische Problematik der Organentnahme bei Hirntod und die Frage nach dem Bezugspunkt „Tod“ in der Transplantation
- Die Kritik an der „pragmatischen Umdefinierung“ des Todes und die Frage nach der Gültigkeit des Hirntodkriteriums
- Die Bedeutung der gesellschaftlichen Akzeptanz des Hirntodkriteriums und die Rolle der Medizin in diesem Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Hirntod und Organtransplantation im Hinblick auf die ethische und moralische Dimension des Themas. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vorwurf der „pragmatischen Umdefinierung“ des Todes durch das Hirntodkriterium. Die Arbeit befasst sich nicht mit den neurologischen, juristischen und technischen Aspekten des Hirntods.
I. Hirntod – Eine pragmatische Umdefinierung des Todes?
In diesem Kapitel wird der Vorwurf der pragmatischen Umdefinierung des Todes durch das Hirntodkriterium näher betrachtet. Der Autor stellt die Argumentation der Kritiker, die eine rein pragmatische Motivation für die Einführung des Hirntodkriteriums sehen, dar. Es wird gezeigt, dass die Kritiker den Zweck der Organtransplantation als den Hauptgrund für die Definition des Hirntods ansehen. Der Autor stellt die Argumente der Befürworter des Hirntodkriteriums dar, die die Kritik entkräften und die Gültigkeit des Kriteriums auf einer wissenschaftlichen und begrifflichen Basis verteidigen.
II. Ebenen der Hirntoddiskussion
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ebenen der Hirntoddiskussion vorgestellt. Der Autor unterscheidet zwischen einer begrifflich-definitorischen und einer ethisch-pragmatischen Ebene. Die begrifflich-definitorische Ebene beschäftigt sich mit der Frage, ob das Hirntodkriterium adäquat und wissenschaftlich fundiert ist. Die ethisch-pragmatische Ebene befasst sich mit den ethischen und gesellschaftlichen Implikationen des Hirntodkriteriums, insbesondere in Bezug auf die Organtransplantation.
III. Zusammenhang zwischen Hirntod und Transplantation
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der ethischen Problematik der Organentnahme bei Hirntod. Der Autor untersucht die Frage, ob der Tod tatsächlich eingetreten ist, wenn ein Mensch hirntod festgestellt wurde, und ob die Organentnahme unter diesen Umständen ethisch vertretbar ist. Die Frage, ob der Hirntod als der entscheidende Bezugspunkt für die Transplantation angesehen werden kann, steht im Mittelpunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Hirntod, Organtransplantation, pragmatische Umdefinierung des Todes, ethische Problematik, begrifflich-definitorische Ebene, ethisch-pragmatische Ebene, gesellschaftliche Akzeptanz, medizinische Kompetenz, Validität, Reliabilität, Akzeptanz, Behandlungsabbruch, Organentnahme, Bezugspunkt Tod.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Vorwurf der „pragmatischen Umdefinierung“ des Todes?
Kritiker werfen der Medizin vor, das Hirntodkriterium nur eingeführt zu haben, um die Organentnahme bei schlagendem Herzen ethisch zu legitimieren.
Wann wurde das Hirntodkriterium offiziell definiert?
Ein Meilenstein war der Harvard-Report von 1968, der den Hirntod als „irreversibles Koma“ und neues Todeskriterium vorschlug.
Welche Ebenen der Hirntoddiskussion gibt es?
Es wird zwischen der begrifflich-definitorischen Ebene (Was ist der Tod?) und der ethisch-pragmatischen Ebene (Dürfen wir Organe entnehmen?) unterschieden.
Ist ein Hirntoter wirklich tot?
Diese zentrale Frage wird in der Arbeit unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Validität und gesellschaftlicher Akzeptanz diskutiert.
Welchen Einfluss hatte die Intensivmedizin auf diese Debatte?
Durch die Reanimationstechnik konnten Patienten künstlich am Leben erhalten werden, was die traditionelle Definition des Herz-Kreislauf-Tod infrage stellte.
- Citation du texte
- Daniel Sommerlad (Auteur), 2001, Ethische Fragestellungen in der Medizin: Hirntodkonzept und Transplantation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2464