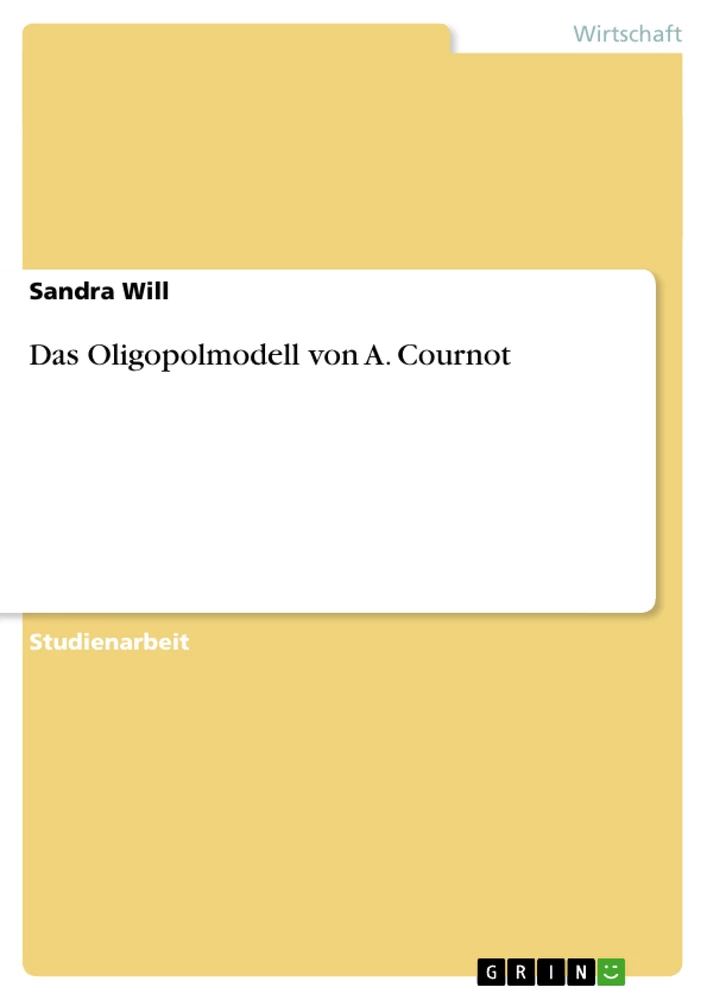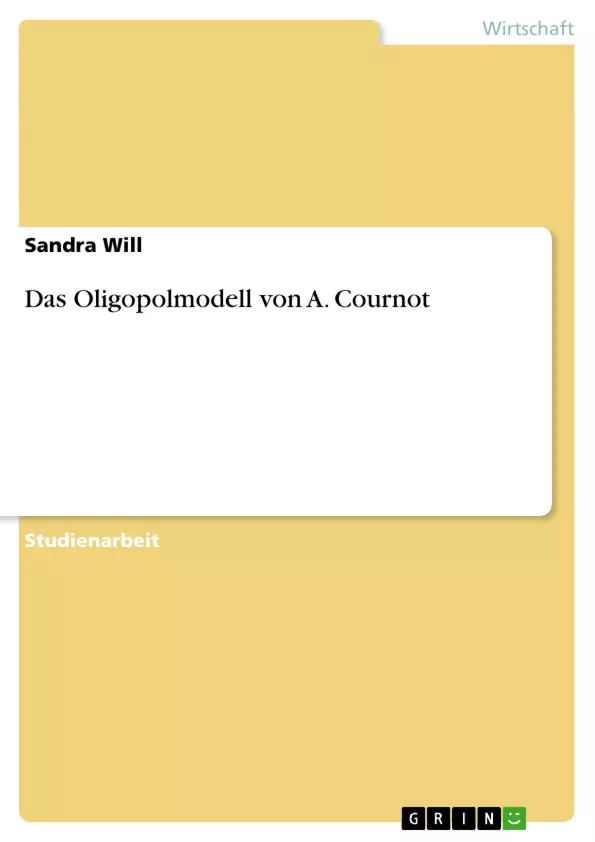Eine in der Wirklichkeit am häufigsten vorkommende Marktform ist das Oligopol. Aus diesem Grunde beschäftigt sich die preistheoretische Forschung immer und immer wieder mit diesem schwierigen Thema. Monopolisten und Polypolisten betrifft die Verhaltensweise ihrer Konkurrenten nicht. Der Monopolist hat keine Konkurrenten, der Polypolist dagegen so viele, dass er von den Aktionen der einzelnen Mitkonkurrenten nicht betroffen ist und selber auch keinen Einfluss auf die anderen Anbieter auf dem Markt ausübt. Beim Oligopol sind dagegen nur „wenige“ Unternehmen am Markt. (1)
Das Oligopol besitzt zahlreiche weitere Merkmale. Der Marktzutritt ist kurzfristig schwer bis kaum möglich. Die Kostenstruktur besteht aus steigenden beziehungsweise konstanten Grenzkosten; es handelt sich um eine große Betriebsgröße im Vergleich zum Gesamtmarkt. Produktart sind perfekte oder nahe Substitute. Die Nachfragestruktur besteht aus sehr vielen preisnehmenden und mengenanpassenden Nachfragern ohne Marktmacht. Die Marktmacht ist bei Kollusion groß, bei oligopolistischem Wettbewerb gering. Es ist sogar ein Wettbewerbsergebnis möglich. Die Erwartungen in bezug auf das Verhalten der Konkurrenten sind zentral, da eine hohe Interdependenz der Konkurrenten besteht. Darauf wird unter Punkt 2 noch genauer eingegangen. Als strategische Variable kommt der Preis, die Menge und die Produktqualität in Frage. Das Marktergebnis ist von der Art des monopolistischen Wettbewerbs abhängig. Ein Monopol- oder Wettbewerbsergebnis ist möglich. (2)
Zusammenfassend hängt der Gewinn eines einzelnen Anbieters also nicht nur von den eigenen Aktionen (Preissetzung, Werbungsanstrengungen, Qualitätspolitik etc.) ab, sondern auch vom Verhalten der anderen Oligopolisten. Jeder einzelne beeinflusst die anderen Anbieter durch seine Aktionen. In Bezug auf die Oligopoltheorie von A. Cournot wird jedoch nur auf die einfachste Form eines Oligopols eingegangen, nämlich das homogene Duopol, bei dem nur zwei Anbieter von nahezu homogenen Produkten, wie zum Beispiel Treib- und Schmierstoffe, Papier, Mehl, Zement, Saatgut, Flugreisen, ...) vorhanden sind, die eine autonome Mengenstrategie betreiben. Zuletzt wird unter Punkt 4 versucht, die Übertragbarkeit des Ergebnisses auf höhere Oligopole mit mehr als zwei Anbietern zu beurteilen.
(1) Pfähler, W . ; Wiese, H.; Oligopoltheorie aus spieltheoretischer Sicht ; Koblenz; W I SU 7/ 90 (438)
(2) Stocker, F.; Mikroökonomik ; München; 1996; S. 262
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Oligopolistische Interdependenz
- Mengenstrategie nach A. Cournot
- Statische Lösung
- Dynamische Lösung
- Höhere Oligopole mit mehr als zwei Anbietern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Oligopolmodell von A. Cournot. Ziel ist es, die oligopolistische Interdependenz zu erklären und die Mengenstrategie nach Cournot sowohl statisch als auch dynamisch zu analysieren. Zusätzlich wird die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern betrachtet.
- Oligopolistische Interdependenz und ihre Auswirkungen auf die Preis- und Mengenentscheidungen der Anbieter
- Die Cournotsche Mengenstrategie und ihre statische Lösung
- Die dynamische Entwicklung im Cournotschen Duopol
- Analyse der Gewinnmaximierung unter Berücksichtigung der Konkurrenz
- Übertragbarkeit des Modells auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Oligopolmarktform, die als eine der häufigsten Marktstrukturen in der Realität beschrieben wird. Im Gegensatz zu Monopolen und Polypolen, wo die Interaktion mit Konkurrenten vernachlässigbar ist, spielt die Interdependenz der wenigen Anbieter im Oligopol eine zentrale Rolle. Die Arbeit fokussiert sich auf das homogene Duopol mit autonomen Mengenstrategien als einfachste Form des Oligopols, wobei Beispiele wie Treibstoffe, Papier oder Zement genannt werden. Es wird hervorgehoben, dass der Gewinn eines Anbieters nicht nur von den eigenen Aktionen, sondern auch vom Verhalten der Konkurrenten abhängt. Die Arbeit kündigt die Analyse der Cournotschen Oligopoltheorie an, mit einem Ausblick auf die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf größere Oligopole.
2. Oligopolistische Interdependenz: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem zentralen Merkmal des Oligopols: der Interdependenz. Die enge Verbundenheit der wenigen Anbieter führt dazu, dass jede Preis- oder Mengenänderung eines Anbieters Auswirkungen auf die anderen hat, was zu einem dynamischen Wechselspiel führt. Erfolgreiche Anbieter berücksichtigen die Reaktionen ihrer Konkurrenten in ihren Strategien, versuchen, ihre Absichten zu verbergen und sich flexibel auf veränderte Situationen einzustellen. Der Nichtpreiswettbewerb wird als potenzielle Strategie gegenüber dem verlustträchtigen Preiswettbewerb dargestellt. Das Kapitel führt in die Komplexität der Oligopolpreistheorie ein, indem es die Schwierigkeiten bei der Ableitung der Gewinnmaximierungsbedingungen unter Berücksichtigung der Interdependenz aufzeigt.
3. Mengenstrategie nach A. Cournot: Dieses Kapitel behandelt die Kernpunkte des Cournotschen Modells. Es wird sowohl die statische als auch die dynamische Lösung des Duopolproblems analysiert, wobei die Interdependenz der Anbieter und die Auswirkungen auf Preis und Menge im Mittelpunkt stehen. Der statische Teil beschreibt wahrscheinlich das Cournotsche Gleichgewicht, während der dynamische Teil den Verlauf von Preis und Menge im Zeitablauf, ausgehend von einem beliebigen Startpunkt, bis zum Erreichen des Gleichgewichts beschreibt. Das Kapitel untersucht, wie die Anbieter ihre Mengenstrategien im Hinblick auf die erwarteten Reaktionen des Konkurrenten optimieren um den maximalen Gewinn zu erzielen. Die mathematischen Grundlagen werden anhand der Gewinnfunktionen der Duopolisten dargestellt, wobei die Abhängigkeit des Preises von den Mengen beider Anbieter explizit berücksichtigt wird.
4. Höhere Oligopole mit mehr als zwei Anbietern: Der letzte analysierte Abschnitt bewertet die Übertragbarkeit der Erkenntnisse des Cournotschen Duopolmodells auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern. Es wird diskutiert, inwieweit die grundlegenden Mechanismen der Interdependenz und der Mengenstrategie auch in komplexeren Marktstrukturen gelten und wie sich die Ergebnisse verändern. Die Herausforderungen bei der Analyse größerer Oligopole im Vergleich zum Duopol werden beleuchtet und die Grenzen des Modells werden möglicherweise angesprochen.
Schlüsselwörter
Oligopol, Cournot-Modell, Mengenstrategie, Interdependenz, Duopol, Gewinnmaximierung, statische Lösung, dynamische Lösung, Preisbildung, Konkurrenzverhalten, homogene Güter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Cournotschen Oligopolmodells
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert das Oligopolmodell von Augustin Cournot. Im Fokus steht die oligopolistische Interdependenz und die Mengenstrategie nach Cournot, sowohl statisch als auch dynamisch. Zusätzlich wird untersucht, wie sich die Ergebnisse auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern übertragen lassen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Oligopolistische Interdependenz und ihre Auswirkungen auf Preis- und Mengenentscheidungen; die Cournotsche Mengenstrategie und ihre statische Lösung; die dynamische Entwicklung im Cournotschen Duopol; Gewinnmaximierung unter Berücksichtigung der Konkurrenz; und die Übertragbarkeit des Modells auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einführung in die Oligopolmarktform und das Cournotsche Modell; 2. Detaillierte Betrachtung der oligopolistischen Interdependenz; 3. Analyse der Cournotschen Mengenstrategie (statisch und dynamisch); und 4. Übertragung der Ergebnisse auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern.
Was wird in der Einführung erläutert?
Die Einführung beschreibt die Oligopolmarktform als eine der häufigsten Marktstrukturen. Im Gegensatz zu Monopolen und Polypolen spielt die Interdependenz der wenigen Anbieter eine zentrale Rolle. Der Fokus liegt auf dem homogenen Duopol mit autonomen Mengenstrategien. Es wird betont, dass der Gewinn eines Anbieters vom eigenen Handeln und dem Verhalten der Konkurrenz abhängt. Die Analyse der Cournotschen Theorie und deren Übertragbarkeit auf größere Oligopole wird angekündigt.
Wie wird die oligopolistische Interdependenz beschrieben?
Kapitel 2 befasst sich mit der engen Verbundenheit der Anbieter. Jede Preis- oder Mengenänderung beeinflusst die anderen Anbieter, was zu einem dynamischen Wechselspiel führt. Erfolgreiche Anbieter berücksichtigen die Reaktionen der Konkurrenten und versuchen, ihre Absichten zu verbergen. Nicht-Preiswettbewerb wird als Alternative zu verlustreichem Preiswettbewerb dargestellt. Die Komplexität der Oligopolpreistheorie und die Schwierigkeiten bei der Gewinnmaximierung unter Berücksichtigung der Interdependenz werden hervorgehoben.
Wie wird die Cournotsche Mengenstrategie erklärt?
Kapitel 3 analysiert das Cournotsche Modell, sowohl statisch als auch dynamisch. Der statische Teil beschreibt das Cournotsche Gleichgewicht, der dynamische Teil den Verlauf von Preis und Menge bis zum Erreichen des Gleichgewichts. Es wird gezeigt, wie Anbieter ihre Mengenstrategien im Hinblick auf die erwarteten Reaktionen der Konkurrenz optimieren, um den maximalen Gewinn zu erzielen. Die mathematischen Grundlagen werden anhand der Gewinnfunktionen der Duopolisten dargestellt.
Wie wird das Modell auf größere Oligopole übertragen?
Das letzte Kapitel bewertet die Übertragbarkeit der Ergebnisse des Cournotschen Duopolmodells auf Oligopole mit mehr als zwei Anbietern. Es wird diskutiert, inwieweit die Mechanismen der Interdependenz und der Mengenstrategie in komplexeren Marktstrukturen gelten und wie sich die Ergebnisse verändern. Die Herausforderungen bei der Analyse größerer Oligopole und die Grenzen des Modells werden möglicherweise angesprochen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Relevante Schlüsselwörter sind: Oligopol, Cournot-Modell, Mengenstrategie, Interdependenz, Duopol, Gewinnmaximierung, statische Lösung, dynamische Lösung, Preisbildung, Konkurrenzverhalten, homogene Güter.
- Arbeit zitieren
- Sandra Will (Autor:in), 2002, Das Oligopolmodell von A. Cournot, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23982