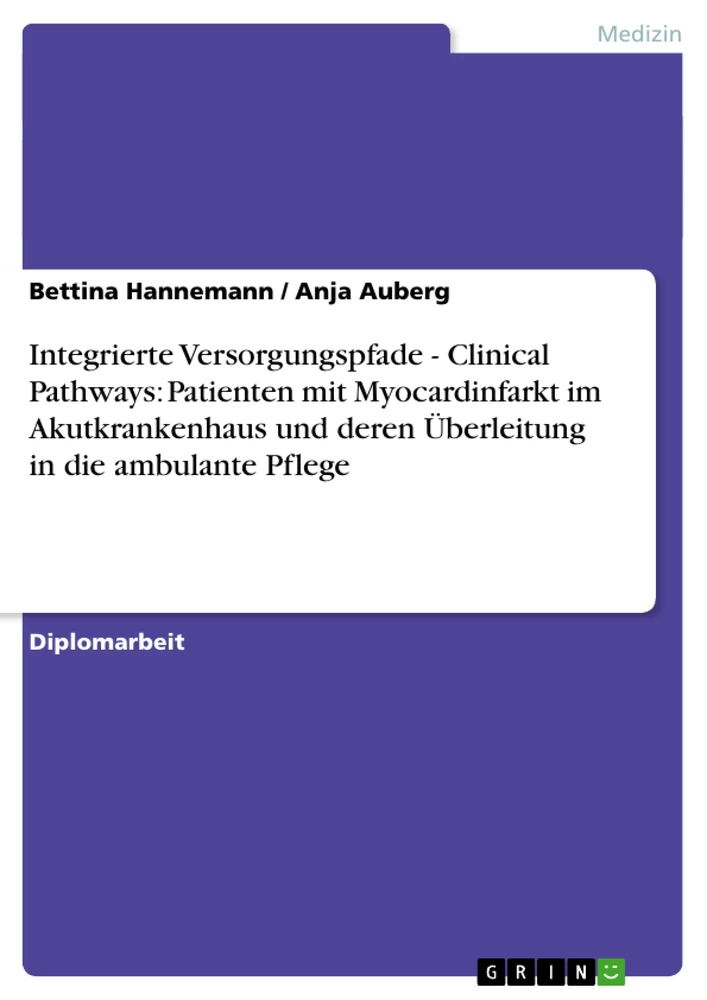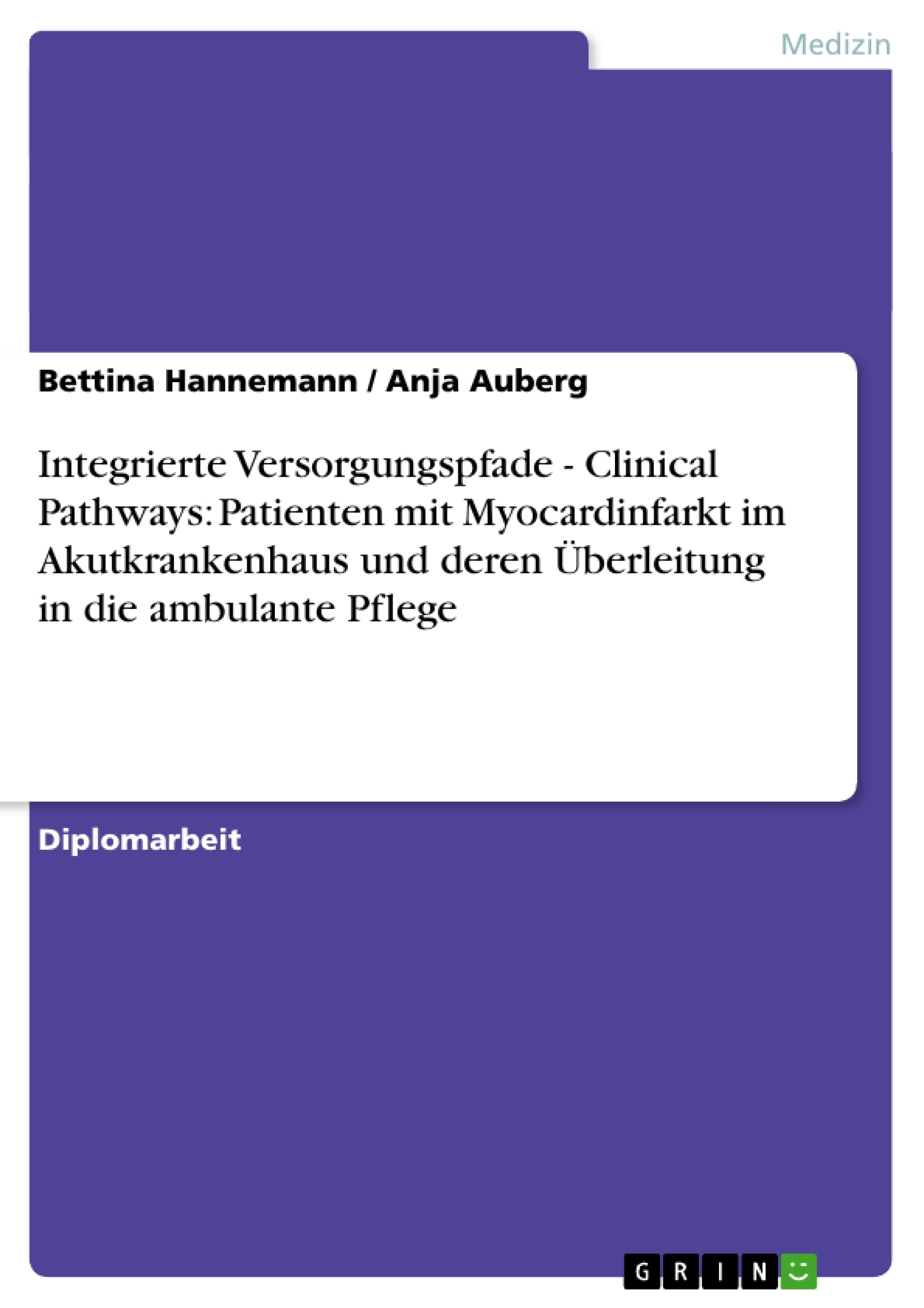[...] Wie sehen die Verantwortlichen den Beitrag
an der Veränderung im deutschen Gesundheitssystem? Es ist die Vermutung der Verfasser, dass in Bezug auf die Umsetzung eine
große Unsicherheit herrscht und somit die verschiedensten
Durchführungsstadien im deutschen Gesundheitssystem existieren. Anders
ausgedrückt, die Erforschung, ob es eine unterschiedliche Handhabung der
genannten Managementstrategien und deren Umsetzungsmaßnahmen gibt, und
die Fragen, auf welche Weise sie realisiert werden und mit welchen
Konsequenzen für das deutsche Gesundheitssystem, sind also Gegenstand der
vorliegenden Diplomarbeit.
Nach dieser Einleitung folgt das zweite Kapitel, welches die Entwicklung der
Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit beinhaltet. In Kapitel drei wird
eine Situationsanalyse der Reformen des deutschen Gesundheitssystems
vorgenommen. Hier wird aufgezeigt, wo ein derzeitiger Handlungsbedarf zur
Umsetzung von Clinical Pathways, Case Management, Entlassungsmanagement
und Disease Management besteht. Dies bildet den Grundstock bzw. den
theoretischen Bezugsrahmen für die darauf folgenden Kapitel vier, fünf, sechs
und sieben, in denen diese neuen Versorgungsmodelle dargestellt werden. Diese
Kapitel bilden den theoretischen Hauptteil der Diplomarbeit.
In dem achten Kapitel folgt die Darstellung des Forschungsdesigns, es soll zum
einen die Erhebungs- und Auswertungsmethoden nachvollziehbar abbilden. In
diesem Teil der Arbeit wird ein praktischer Bezug hergestellt, in dem der
reichhaltige Erfahrungsschatz von Experten in die wissenschaftliche Betrachtung
mit einfließt, um so die theoretischen Erkenntnisse aus der diversen Literatur mit
praktischem Wissen über neue Versorgungsmodelle anzureichern. Zum anderen
werden Ergebnisse aus qualitativer Forschung dargestellt mit ausgewählten
Aussagen der Experten, welche zur Veranschaulichung auch im Original zitiert
werden. Dies ist der praktische Hauptteil der Diplomarbeit.
Daran schließt sich Kapitel neun an, in dem ein zusammenfassendes Fazit der
Diplomarbeit von den Forschern gezogen wird und gleichzeitig eine
Ergebnisdarstellung erfolgt.
Anschließend wird in Kapitel zehn der Arbeit eine konzeptionelle Vision für die
umfassende Versorgung von Patienten mit akutem Myocardinfarkt von den
Verfassern aus Ihrer Sicht vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Danksagung
- Einleitung
- Entwicklung der Fragestellung
- Das deutsche Gesundheitssystem und seine Reformen
- Clinical Pathways
- Clinical Pathways in den USA, Australien und Deutschland
- USA und Australien
- Deutschland
- Warum Clinical Pathways?
- Die Entwicklung und Implementierung des Clinical Pathways
- Abweichungen
- Vorteile und Grenzen der Clinical Pathways
- Schlussfolgerung
- Clinical Pathways in den USA, Australien und Deutschland
- Case Managementkonzepte (CM)
- Case Management im Akutkrankenhaus
- Case Management in der ambulanten Versorgung
- Integrierte Versorgung
- Entlassungsmanagement (EM)
- Überleitungen vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung
- Entlassungsplanungsprozess
- Disease Management Program (DMP)
- Forschungsdesign
- Das Leitfaden- Interview
- Das Experteninterview
- Auswahl von Experten
- Vorbereitung des Leitfadens
- Durchführung von Interviews
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Das Experteninterview
- Das Leitfaden- Interview
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der integrierten Versorgung von Patienten mit Myocardinfarkt im Akutkrankenhaus und deren Überleitung in die ambulante Pflege. Sie untersucht die Rolle von Clinical Pathways (CP) in diesem Kontext und analysiert die Erfahrungen von Experten im Hinblick auf die Implementierung und die Anwendung dieser Versorgungsmodelle.
- Entwicklung und Implementierung von Clinical Pathways für Patienten mit Myocardinfarkt
- Integration von Case Management-Konzepten in die Versorgung von Patienten mit Myocardinfarkt
- Analyse von Überleitungsprozessen vom Krankenhaus in die ambulante Pflege
- Bewertung der Vorteile und Grenzen von Clinical Pathways in der Praxis
- Bewertung der Herausforderungen und Potenziale der integrierten Versorgung im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Diplomarbeit vor und skizziert die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Gesundheitssystems. Kapitel 2 erläutert die Entwicklung der Fragestellung und beleuchtet die relevanten Forschungsfragen. Kapitel 3 befasst sich mit dem deutschen Gesundheitssystem und seinen Reformen, wobei die Bedeutung von integrierten Versorgungsformen hervorgehoben wird.
Kapitel 4 widmet sich dem Konzept der Clinical Pathways. Es werden die Entwicklungen in den USA und Australien vorgestellt, gefolgt von einer Darstellung der Situation in Deutschland. Zudem werden die Vorteile und Grenzen von CP diskutiert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Case Management-Konzepten und deren Bedeutung im Akutkrankenhaus und in der ambulanten Versorgung. Kapitel 6 behandelt das Entlassungsmanagement und die damit verbundenen Überleitungsprozesse vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung.
Schlüsselwörter
Clinical Pathways, Case Management, Integrierte Versorgung, Myocardinfarkt, Akutkrankenhaus, Ambulante Pflege, Entlassungsmanagement, Disease Management, Experteninterview, Qualitative Inhaltsanalyse
- Quote paper
- Bettina Hannemann (Author), Anja Auberg (Author), 2003, Integrierte Versorgungspfade - Clinical Pathways: Patienten mit Myocardinfarkt im Akutkrankenhaus und deren Überleitung in die ambulante Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23745