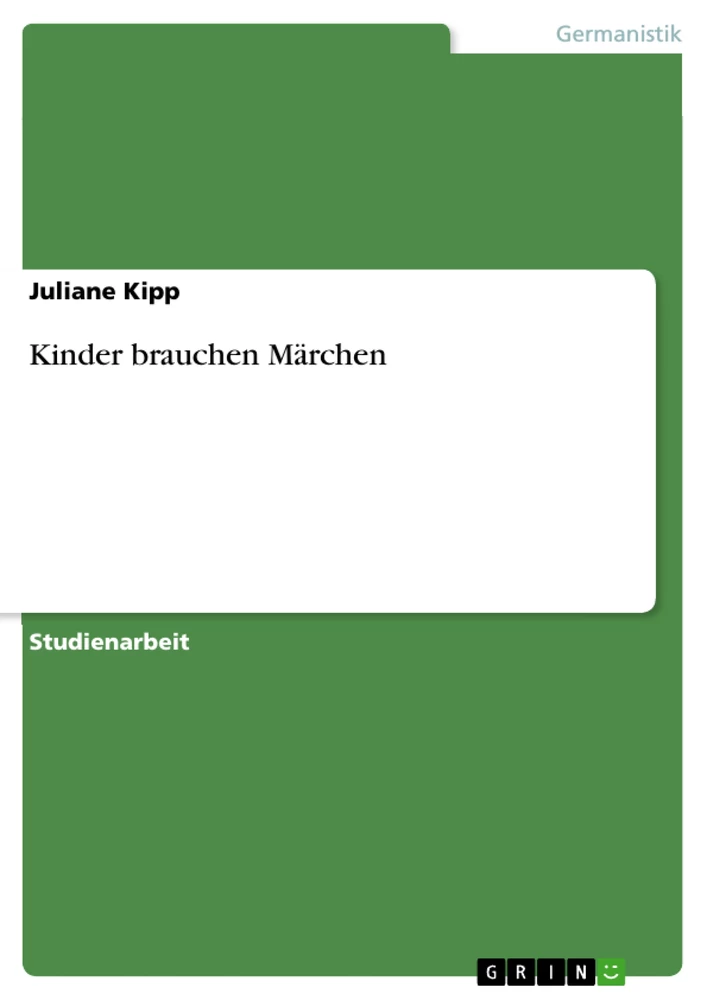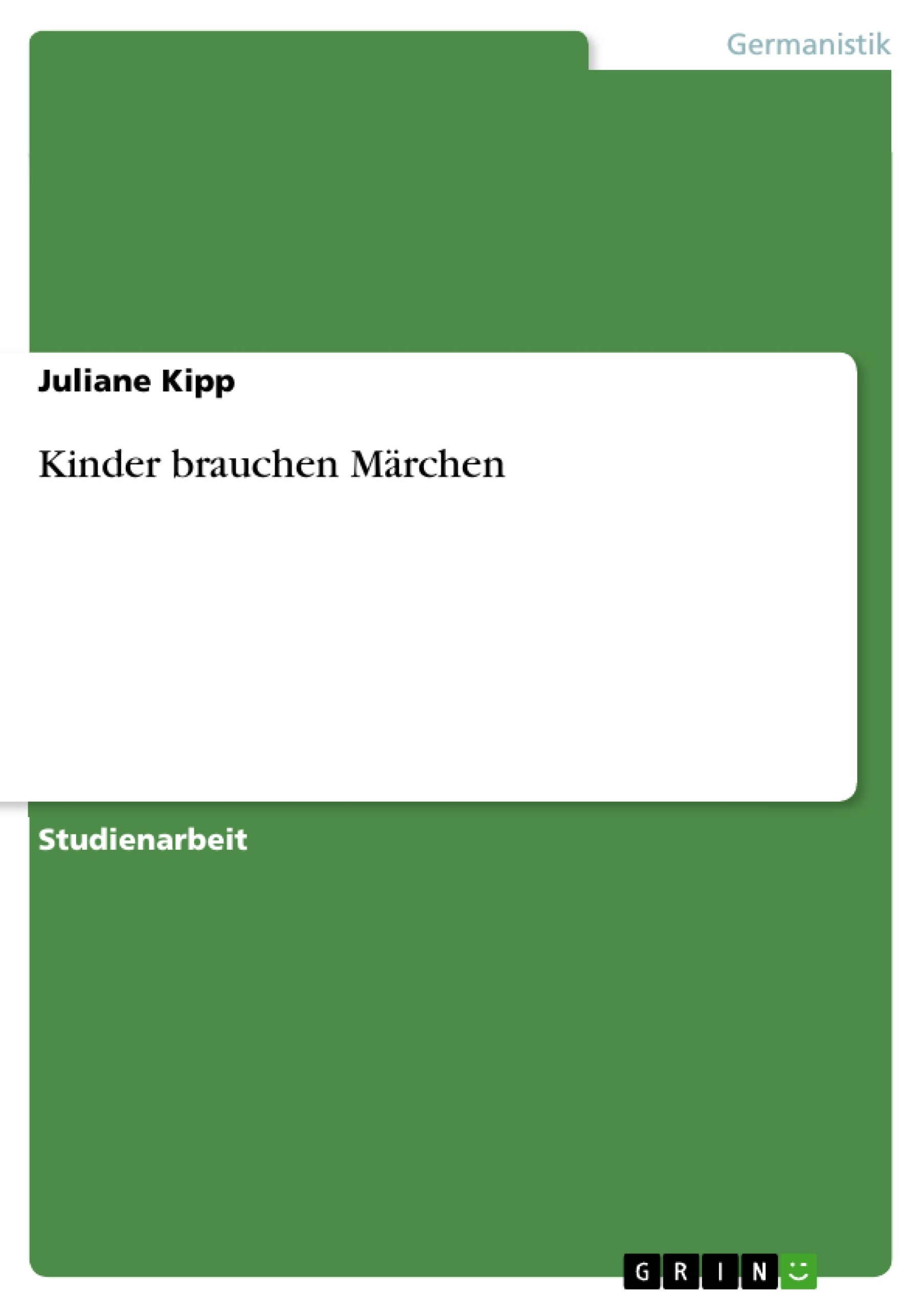Oft kommt es zu Diskussionen, ob Märchen überholt und altmodisch seien, ebenso grausam und fortschritts- und vernunftfeindlich, eine „Welt der Täuschung“ (Immanuel Kant). Die Begründung für diesen Standpunkt wird darin gesehen, dass Märchen eine Gesellschaft präsentieren, die heute nicht mehr existiert. Außerdem gibt es genügend neue Formen der „Unterhaltung“, die für das Kind und den Erwachsenen interessant sind, und die sich allein durch Technik und neue Medien viel mehr mit den Ansprüchen der Menschen decken. Denn kaum jemand greift heute noch zum Märchenbuch! Stattdessen lassen sich die Menschen durch Zeitungen, Fernsehen, Videos, Hörfunk und Internet informieren und unterhalten. Kinder beschäftigen sich am liebsten mit Computerspielen, wenn sie nicht gerade im Sportverein sind, oder wenn es nichts schöneres im Fernsehen gibt.
Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, dass Kinder (und auch Erwachsene) in unserer Zeit doch noch Märchen brauchen. Vor allem Kinder zeigen ein großes Interesse an den fantastischen Erzählungen, in der die Grenzen zur Wirklichkeit und zu Wunderbarem aufgehoben sind. Märchen sind in unserer Gesellschaft sehr wohl noch erwünscht und erzielen eine große Wirkung besonders auf Heranwachsende. Woran dies nun liegt, woher das Interesse an Märchen kommt und warum Märchen viele Menschen derartig in ihre Fesseln ziehen, soll in dieser Arbeit gezeigt werden. Dieser Teil der Arbeit, der nach einer allgemeinen Einführung in die Gattung Märchen folgt, soll ein Verständnis an Märchenwichtigkeit vermitteln, ebenso das Empfinden des pädagogischen Wertes von Märchendidaktik stärken. Der/Die junge LehrerIn soll dazu ermutigt werden, in seinem/ihrem Unterricht mit Märchen zu arbeiten. Am Bespiel Schneewittchen wird ein Interpretationsansatz von Bruno Bettelheim referiert, an dem einige grundlegende Aspekte des Märchens aufgezeigt werden. Ebenso wird an „Schneewittchen“ gezeigt, wo der pädagogische Wert des Märchens uns seine Wirkung auf die Kinder gesucht werden kann. Der letzte Teil der Arbeit gibt einige Anregungen für die Umsetzung des Themas „Märchen im Unterricht“, und stützt sich auch auf den Rahmenplan Grundschule des Landes Hessen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Aspekte zum Märchen
- 2.1 Definitionsversuche
- 2.2 Geschichte
- 2.3 Kennzeichen
- 3 Kinder brauchen Märchen
- 3.1 Was bewirken Märchen bei Kindern?
- 3.2 Bedeutungsanalyse Märchen Schneewittchen (nach Bruno Bettelheim)
- 4 Märchen in der Schule
- 4.1 Allgemein
- 4.2 Der Rahmenplan Grundschule zum Thema Märchen
- 4.3 Im Rahmenplan Deutsch der Sek. II
- 4.4 Einsetzen des Märchens in der Schule
- 4.5 Lernziele
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die anhaltende Relevanz von Märchen für Kinder (und Erwachsene) in der heutigen Zeit aufzuzeigen. Sie untersucht das große Interesse an fantastischen Erzählungen, die die Grenzen zwischen Realität und Wunderbarem aufheben. Die Arbeit beleuchtet die Wirkung von Märchen, insbesondere auf Heranwachsende, und fördert das Verständnis ihrer pädagogischen Bedeutung im Unterricht.
- Die Definition und historische Entwicklung des Märchens
- Die Wirkung von Märchen auf Kinder und ihre psychologische Bedeutung
- Der pädagogische Wert von Märchen und deren Einsatz im Schulunterricht
- Interpretation eines Märchens (Schneewittchen) nach Bruno Bettelheim
- Konkrete Vorschläge zur Integration von Märchen in den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die kontroverse Debatte um die Relevanz von Märchen in der modernen Gesellschaft. Die Argumentation, Märchen seien überholt, grausam und vernunftfeindlich, wird angesprochen. Die Arbeit widerlegt diese Sichtweise und betont die anhaltende Bedeutung von Märchen für Kinder und Erwachsene, die durch das große Interesse an fantastischen Erzählungen belegt wird. Das Ziel ist, den pädagogischen Wert von Märchen aufzuzeigen und Lehrer*innen zur Integration von Märchen in den Unterricht zu ermutigen. Die Arbeit wird mit einer Analyse von Schneewittchen nach Bettelheim und konkreten Unterrichtsvorschlägen abgeschlossen.
2 Allgemeine Aspekte zum Märchen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition und der Geschichte des Märchens. Es werden verschiedene Definitionsversuche vorgestellt, die die Komplexität des Phänomens Märchen verdeutlichen, einschließlich der Unterscheidung zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Die historische Entwicklung wird von den „Tausendundeine Nacht“ bis zu den Grimmschen Märchen nachgezeichnet, wobei wichtige Sammler und Autoren hervorgehoben werden. Die Kapitel analysiert weiterhin die charakteristischen Merkmale von Märchen, wie z.B. die Dichotomie zwischen Gut und Böse, die Verwendung von fantastischen Elementen und die einfache, leicht verständliche Erzählweise, die eine Identifikation mit den Hauptpersonen erleichtert. Die Funktion des Märchens als Spiegel gesellschaftlicher Ordnungen und die Wiederholung von typischen Mustern werden ebenfalls behandelt.
3 Kinder brauchen Märchen: Dieses Kapitel untersucht die Wirkung von Märchen auf Kinder. Es wird erörtert, welche positiven Effekte Märchen auf die kindliche Entwicklung haben und wie sie dazu beitragen, mit Herausforderungen des Lebens umzugehen. Ein zentraler Teil dieses Kapitels widmet sich einer detaillierten Bedeutungsanalyse des Märchens „Schneewittchen“ nach Bruno Bettelheim. Diese Analyse beleuchtet die psychologischen und pädagogischen Aspekte des Märchens und verdeutlicht, wie das Märchen Kinder dabei unterstützt, wichtige Entwicklungsschritte zu meistern und existenzielle Fragen zu verarbeiten. Die Kapitel zeigt auf, wie Märchen das Kind bei der Bewältigung von Herausforderungen und der Entwicklung seiner Persönlichkeit unterstützen.
4 Märchen in der Schule: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung von Märchen im Schulunterricht. Es werden allgemeine Aspekte der Märchenarbeit im Unterricht beleuchtet, sowie der Einsatz des Märchens im hessischen Rahmenplan der Grundschule. Das Kapitel enthält Vorschläge zur Integration des Themas „Märchen“ in den Unterricht der Sekundarstufe II. Konkrete Lernziele für den Unterricht werden formuliert, um die pädagogische Wirksamkeit der Märchenarbeit zu optimieren. Das Kapitel liefert didaktische Hinweise und praktische Tipps für den Einsatz von Märchen im Unterricht und unterstreicht ihren Wert für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Märchen, Kinderliteratur, Pädagogik, Didaktik, Volksmärchen, Kunstmärchen, Schneewittchen, Bruno Bettelheim, Erzählforschung, Identifikation, Fantasie, Wirklichkeit, Unterricht, Rahmenplan, Lernziele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Märchen im Unterricht"
Was ist der Inhalt der Arbeit "Märchen im Unterricht"?
Die Arbeit untersucht die anhaltende Relevanz von Märchen für Kinder und Erwachsene. Sie beleuchtet die Wirkung von Märchen, insbesondere auf Heranwachsende, und deren pädagogischen Wert im Unterricht. Die Arbeit umfasst Definitionen und historische Entwicklung des Märchens, die Wirkung auf Kinder, den Einsatz im Schulunterricht (inkl. Rahmenpläne) und eine Interpretation von Schneewittchen nach Bruno Bettelheim.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und historische Entwicklung des Märchens, die Wirkung von Märchen auf Kinder und ihre psychologische Bedeutung (inkl. einer detaillierten Analyse von Schneewittchen nach Bettelheim), der pädagogische Wert von Märchen und deren Einsatz im Schulunterricht (inkl. konkreter Vorschläge und didaktischer Hinweise für die Grund- und Sekundarstufe), sowie die Widerlegung von Argumenten, die die Relevanz von Märchen bestreiten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Einleitung, 2. Allgemeine Aspekte zum Märchen (Definitionen, Geschichte, Kennzeichen), 3. Kinder brauchen Märchen (Wirkung auf Kinder, Analyse von Schneewittchen nach Bettelheim), 4. Märchen in der Schule (Einsatz im Unterricht, Rahmenpläne, Lernziele) und 5. Literaturverzeichnis.
Wie wird die Wirkung von Märchen auf Kinder dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die positiven Effekte von Märchen auf die kindliche Entwicklung und deren Hilfe beim Umgang mit Herausforderungen des Lebens. Die detaillierte Interpretation von Schneewittchen nach Bruno Bettelheim verdeutlicht, wie Märchen Kinder bei wichtigen Entwicklungsschritten und der Verarbeitung existentieller Fragen unterstützen.
Wie wird das Märchen "Schneewittchen" in der Arbeit behandelt?
Das Märchen "Schneewittchen" dient als Fallbeispiel für die Analyse der Wirkung von Märchen auf Kinder. Es wird eine detaillierte Bedeutungsanalyse nach Bruno Bettelheim durchgeführt, die die psychologischen und pädagogischen Aspekte des Märchens beleuchtet.
Welche praktischen Hinweise für den Unterricht werden gegeben?
Die Arbeit bietet konkrete Vorschläge zur Integration von Märchen in den Unterricht der Grundschule und Sekundarstufe II, berücksichtigt relevante Rahmenpläne und formuliert Lernziele für den Unterricht. Didaktische Hinweise und praktische Tipps für den Einsatz von Märchen im Unterricht werden ebenfalls gegeben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Märchen, Kinderliteratur, Pädagogik, Didaktik, Volksmärchen, Kunstmärchen, Schneewittchen, Bruno Bettelheim, Erzählforschung, Identifikation, Fantasie, Wirklichkeit, Unterricht, Rahmenplan, Lernziele.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Lehrer*innen, Studierende der Pädagogik und Erziehungswissenschaften sowie alle, die sich für die Bedeutung von Märchen und deren Einsatz im Unterricht interessieren.
Welche Argumente gegen die Relevanz von Märchen werden angesprochen und widerlegt?
Die Arbeit thematisiert die kontroverse Debatte um die Relevanz von Märchen und widerlegt die Argumentation, Märchen seien überholt, grausam und vernunftfeindlich. Sie betont die anhaltende Bedeutung von Märchen aufgrund des großen Interesses an fantastischen Erzählungen.
- Quote paper
- Juliane Kipp (Author), 2000, Kinder brauchen Märchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2372