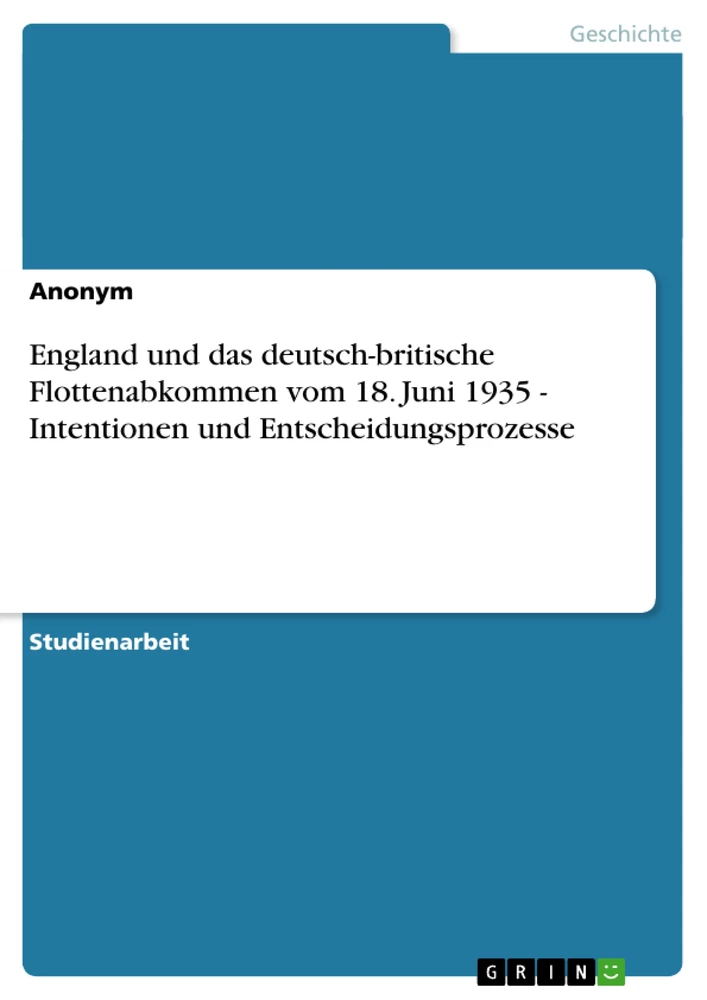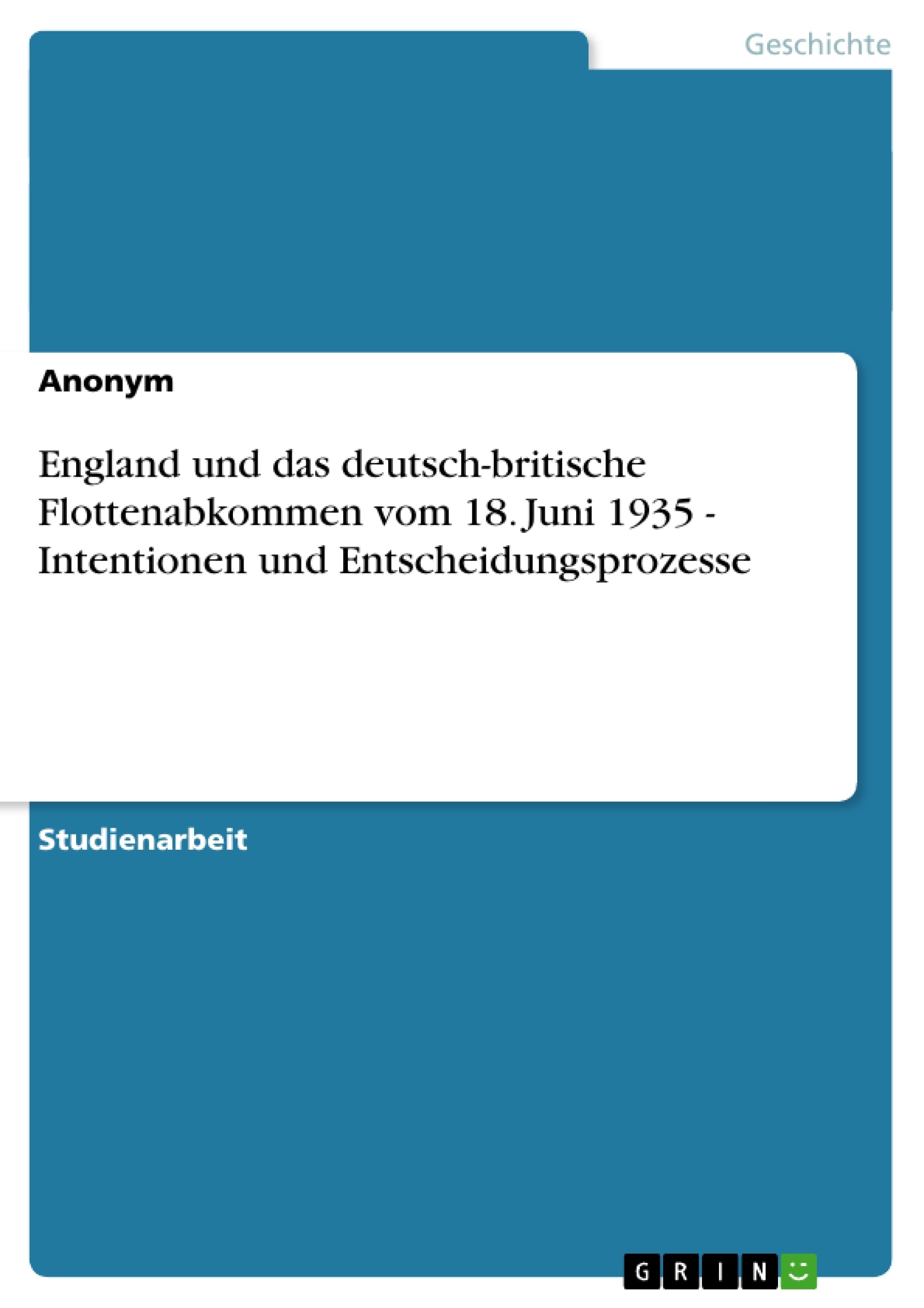Der Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens löste bei der deutschen Regierung grenzenlose Euphorie aus. „Für Adolf Hitler“, so schreibt Joachim von Ribbentrop in seinem Buch „Zwischen London und Moskau“, „war dieser Tag der glücklichste seines Lebens.“ Hitler ließ sich gar zu der Aussage hinreißen, Ribbentrop, der Unterhändler bei den Verhandlungen in London, sei der größte Diplomat seit Bismarck. In der Retrospektive scheint die Begeisterung Hitlers über die Übereinkunft in der Frage der Flottenrüstung mit Großbritannien durchaus verständlich. Er hoffte zum einen auf ein dauerhaftes Bündnis, ein weiterer wichtiger Punkt war für ihn die Überwindung der außenpolitischen Isolation, die seit der Bildung der „Stresa-Front“ unübersehbar war. Hitler konnte endlich die deutsche Aufrüstung legalisieren, da die Marinebestimmungen des Versailler Vertrages nun auch offiziell ungültig wurden. Nicht zuletzt sicherte ihm das Abkommen einen enormen Prestigegewinn gegenüber dem Regierungsapparat und der Bevölkerung. Nicht ungelegen war für ihn dabei, dass die französische Regierung erklärte, das Abkommen habe auf sie „wie ein kalter Wasserstrahl gewirkt“. Das Verhältnis zwischen Frankreich und England verschlechterte sich drastisch, eine wochenlange „Eiszeit“ sowie eine monatelange Pressekampagne setzten ein.
Betrachtet man diese enormen Vorteile für die Hitlerregierung, so erscheint das Verhalten der britischen Politiker, die ihm diese Triumphe verschafften, unverständlich. Die Arbeit möchte deshalb der Frage nachgehen, welche Motive die britische Führung bewog, das deutsch-britische Flottenabkommen, das in der historischen Forschung durchweg negativ beurteilt wird, abzuschließen. Um aufzuzeigen, dass die britische Administration akuten Handlungsbedarf gegenüber Hitlers Angebot sah, werden die direkten Verhandlungsprozesse in London ausführlich eruiert, um den besonderen Zeitdruck zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Weg zum Flottenabkommen
- Der Beginn der Verhandlungen in London
- Der Abschluss der Verhandlungen
- Vertragsinhalt
- Rechtfertigungen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Motiven der britischen Führung beim Abschluss des deutsch-britischen Flottenabkommens von 1935. Sie untersucht die Verhandlungen in London und den besonderen Zeitdruck, der auf die britische Regierung wirkte.
- Analyse der Intentionen der britischen Regierung
- Bewertung der Bedeutung des Flottenabkommens für die deutsche Außenpolitik
- Die Rolle des Versailler Vertrags und seiner Revision in den Verhandlungen
- Die Reaktion der europäischen Mächte auf die deutsche Aufrüstung
- Die Bedeutung der "Appeasement-Politik" im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beleuchtet die Begeisterung der deutschen Regierung über den Abschluss des Flottenabkommens und stellt die Frage nach den Motiven der britischen Führung.
Der Weg zum Flottenabkommen
Die Arbeit schildert die Verhandlungen zwischen Deutschland und Großbritannien über ein Flottenabkommen und beleuchtet die Gründe, warum die britische Regierung zunächst zurückhaltend reagierte.
Der Beginn der Verhandlungen in London
Das Kapitel beschreibt die ersten Verhandlungen in London und die komplexen Hintergründe der britischen Politik im Umgang mit dem nationalsozialistischen Deutschland.
Der Abschluss der Verhandlungen
Die Arbeit untersucht die entscheidenden Momente der Verhandlungen, die zum Abschluss des Flottenabkommens führten.
Vertragsinhalt
Das Kapitel analysiert den Inhalt des Flottenabkommens und dessen Folgen für die deutsche und britische Flottenrüstung.
Rechtfertigungen
Die Arbeit beleuchtet die Argumente der britischen Regierung zur Rechtfertigung des Flottenabkommens.
Schlüsselwörter
Versailler Vertrag, Flottenabkommen, Appeasement, Außenpolitik, Deutschland, Großbritannien, Hitler, Churchill, Revisionismus, Aufrüstung, Diplomatie.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2004, England und das deutsch-britische Flottenabkommen vom 18. Juni 1935 - Intentionen und Entscheidungsprozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23617