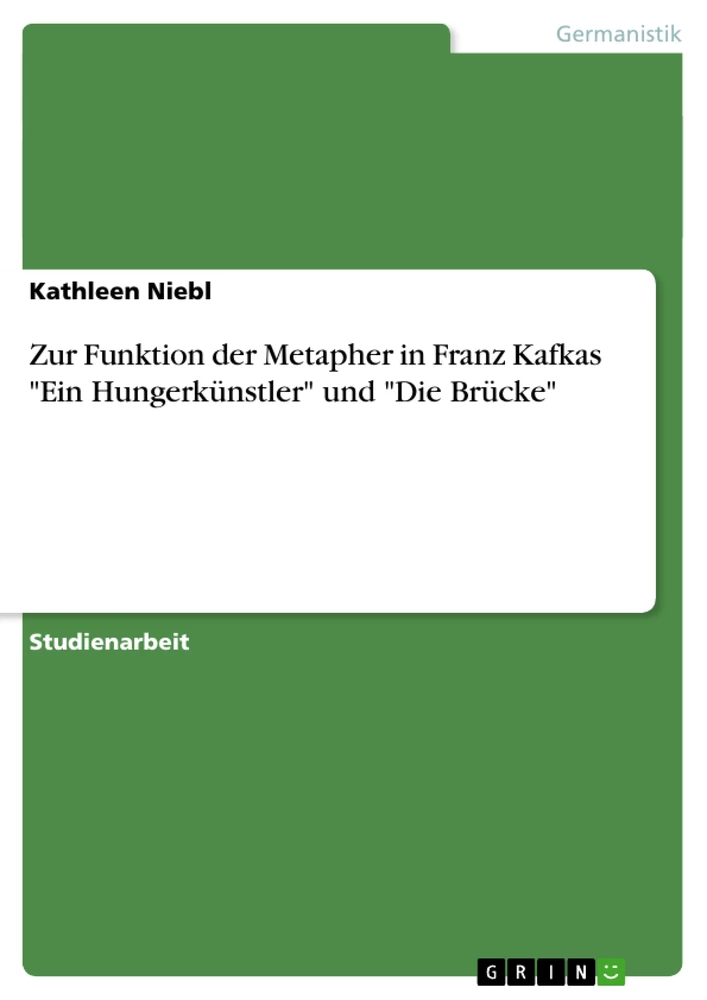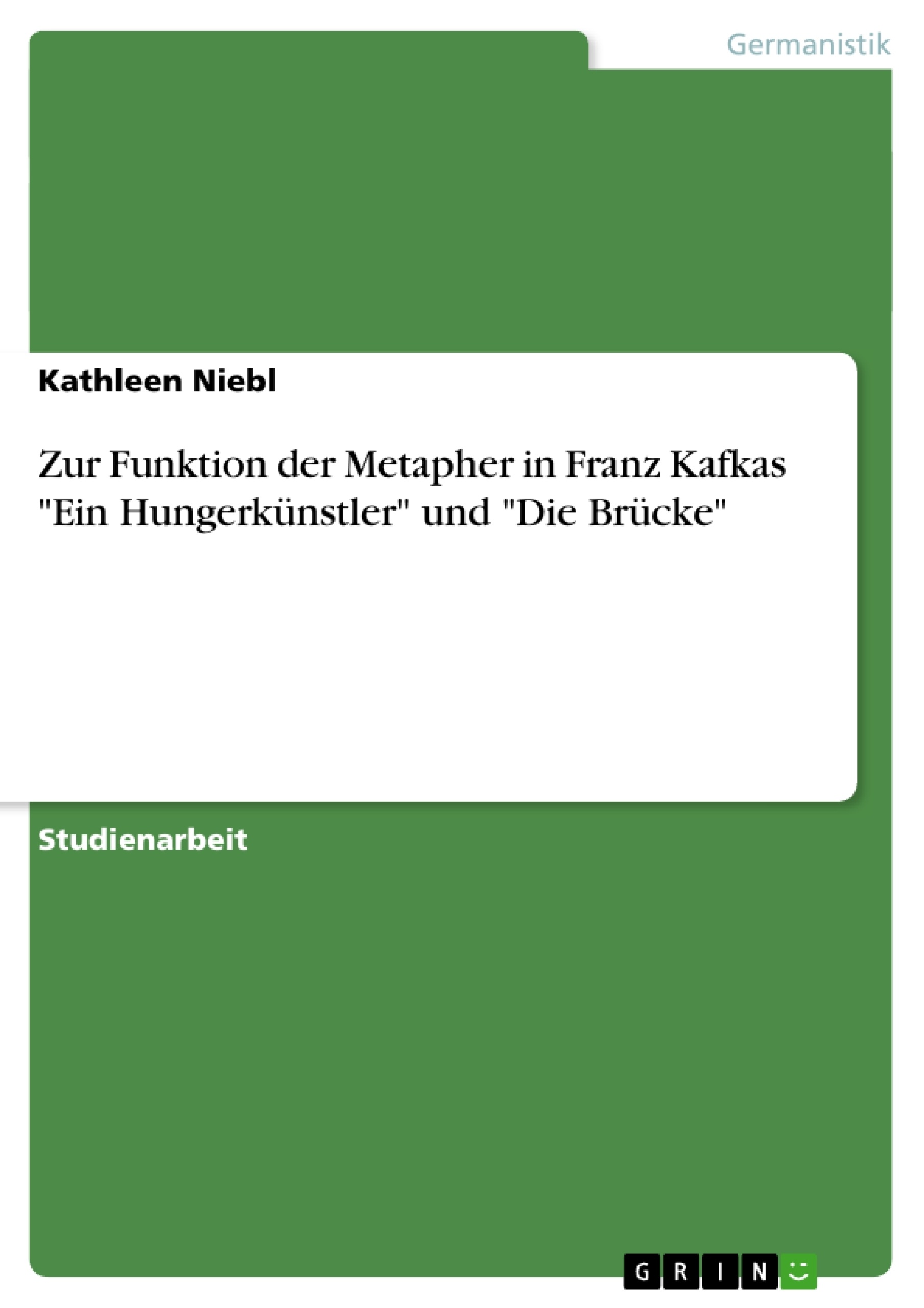Als zentrale Begriffe der Literaturkritik dienen die Metapher, die Allegorie, als
auch das Symbol der Kategorisierung und Verwaltung poetischer Bilder. Auch die
Analyse der Bildersprache Franz Kafkas versprach zahlreichen Interpreten ergiebige
Resultate.1 Während man sich relativ schnell darauf einigte, dass die ohnehin allzu
klar umrissenen Begriffe der Allegorie und des Symbols, angewendet auf die Prosa
Franz Kafkas, relativ schnell an Überzeugungskraft verloren, 2 verblieb einzig die
Metapher zur Klärung der ungewöhnlichen Bilderwelt des Autors. Doch ist man sich
bis heute auch über deren Erklärungspotential, die Bildstrukturen von Kafkas Prosa
betreffend, weitest gehend uneinig geblieben.
So erheben im Anschluss an Günther Anders eine Vielzahl an Kritikern, etwa
Henry Sussman oder Wilhelm Emrich3, die Metapher zum bestimmenden
Konstruktionsprinzip der Dichtung Kafkas, während man auf der anderen Seite, den
Forschungen Friedrich Beißners zum einsinnigen Erzählen Franz Kafkas folgend,4
seine Sprache als weitgehend unmetaphorisch bezeichnet. [...]
1 Vgl. etwa die umfangreiche Studie von Barbara Beutner: Die Bildersprache Franz Kafkas.
München: Wilhelm Fink Verlag 1973. Vgl. auch: Heinz Politzer: „Gibs auf!“ – Zum Problem der
Deutung von Kafkas Bildersprache. In: ders.: Franz Kafka, der Künstler. Frankfurt am Main: S.
Fischer Ve rlag 1965. S. 19-44.
2 Bereits 1951 ließ Günther Anders in seiner einflussreichen Analyse des Erzählstils Franz Kafkas nur
den Begriff der Metapher für dessen Bildersprache gelten, Vgl.:Günther Anders: Nicht Symbole,
sondern Metaphern. In: ders.: Kafka. Pro und Contra. Die Prozeß-Unterlagen. München: C.H. Beck
41972. S. 39-51. Allegorische Deutungen finden sich eher selten. So sieht etwa James Rolleston den
„Hungerkünstler“ als Allegorie der Moderne, Vgl. James Rolleston: Purification unto Death: “A
Hunger Artist” as Allegory of Modernism. In: Approaches to teaching Kafka’s short fiction. Hg. v.
Richard T. Gray. New York: The Modern Language Association of America 1995. S. 135-142.
3 Vgl.: Henry Sussmann: Franz Kafka. Geometrician of Metaphor. Madison: Coda Press 1979,
Wilhelm Emrich: Die Bilderwelt Franz Kafkas. In: Franz Kafka. Hg. v. Heinz Politzer. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1973. S. 286-308.
4 Friedrich Beißner: Der Erzähler Franz Kafka. In: ders.: Der Erzähler Franz Kafka und andere
Vorträge. Mit einer Einführung von Werner Keller. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983. S. 21-50.
Inhaltsverzeichnis
- Metapher, Allegorie oder Symbol?
- Die Leistung der Metapher in Franz Kafkas „Ein Hungerkünstler“
- Kunst oder Natur? - Das Hungern des Hungerkünstlers
- Die „heranwälzende Menge“ – Das Publikum im „Hungerkünstler“
- Ein Leben in „scheinbarem Glanz“ – Lichtmetaphorik im „Hungerkünstler“
- Vorherrschaft des Metaphorischen - Die Funktion des Panthers im „Hungerkünstler“
- Ergebnis
- Die realisierte Metapher - Franz Kafkas „Die Brücke“
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktion der Metapher in Franz Kafkas Erzählungen „Ein Hungerkünstler“ und „Die Brücke“. Sie analysiert die Bedeutung der Metaphorik für die Konstruktion der erzählten Welt und die Interpretation der Geschichten.
- Die Rolle der Metapher als Konstruktionsprinzip in Kafkas Werk
- Die Ambivalenz der Metapher: zwischen Klarheit und Unklarheit, Bedeutung und Bedeutungslosigkeit
- Die Beziehung zwischen Metapher und Realität in Kafkas Erzählungen
- Die Frage nach der Funktion der Metapher in der Gestaltung des Verhältnisses zwischen Künstler und Publikum
- Der Einfluss der Metaphorik auf die Rezeption Kafkas Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Frage nach der Abgrenzung der Metapher von verwandten Begriffen wie Allegorie und Symbol. Es beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Analyse der Bildersprache Kafkas und stellt die Bedeutung der Metapher für die Interpretation seines Werkes heraus.
Das zweite Kapitel analysiert die Funktion der Metapher in Franz Kafkas Erzählung „Ein Hungerkünstler“. Es untersucht verschiedene Aspekte der Metaphorik in diesem Text, wie z.B. die Darstellung des Hungers des Hungerkünstlers, die Beziehung zwischen Künstler und Publikum sowie die Rolle des Panthers als Metapher für die Kunst selbst.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der „realisierten Metapher“ in Franz Kafkas „Die Brücke“. Es betrachtet die Frage, inwieweit die Metapher in dieser kurzen Skizze die erzählte Welt prägt und auf den Leser wirkt.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Metapher, Allegorie, Symbol, „Ein Hungerkünstler“, „Die Brücke“, Kunst, Realität, Publikum, Interpretation, Bildersprache, Konstruktionsprinzip, Ambivalenz
- Quote paper
- Kathleen Niebl (Author), 2003, Zur Funktion der Metapher in Franz Kafkas "Ein Hungerkünstler" und "Die Brücke", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23336