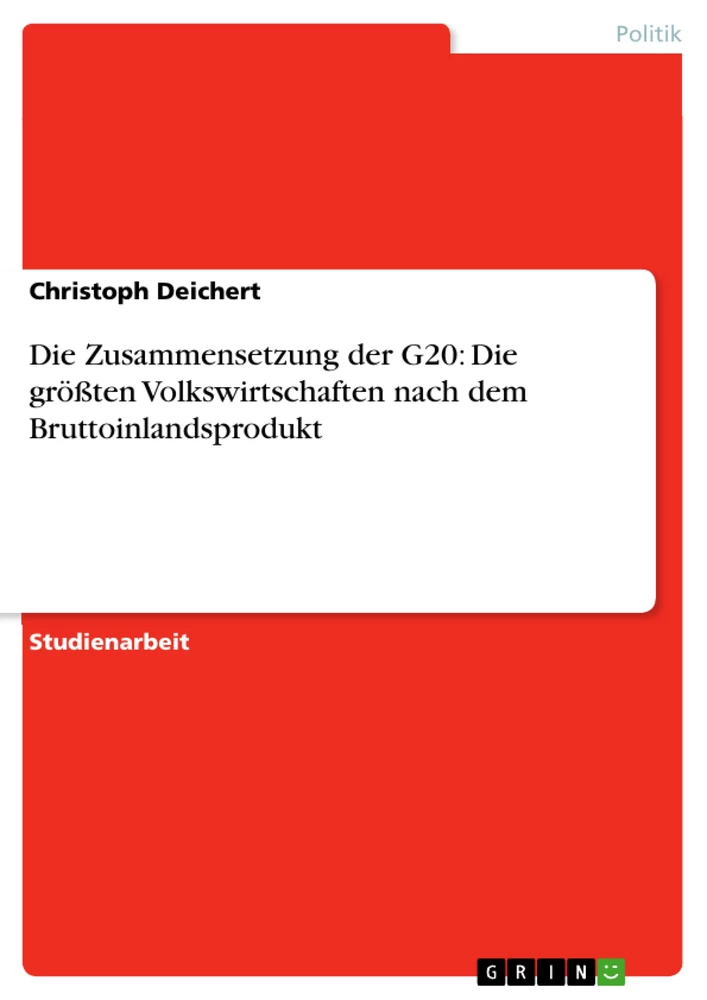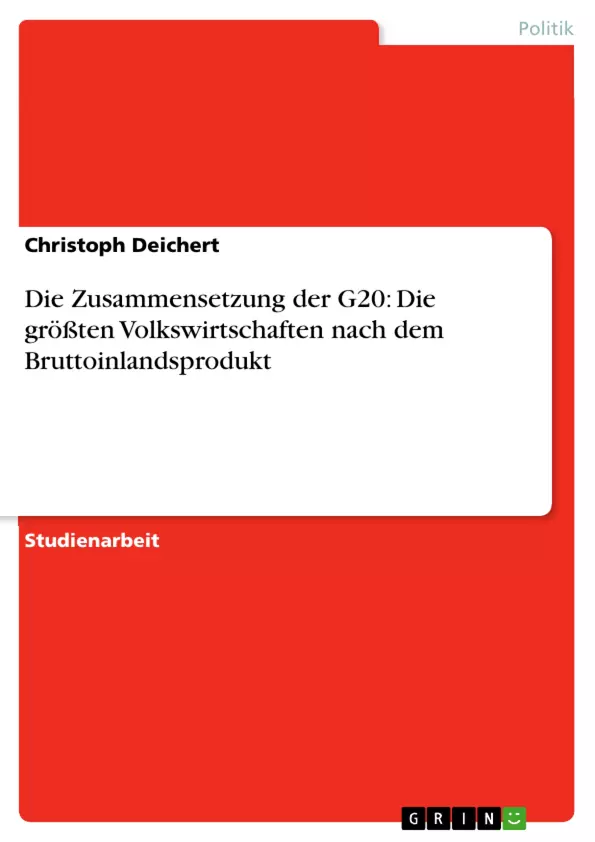Seit dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G20 Staaten vom November 2008 in Washington, gab es bis 2010 halbjährige Gipfeltreffen und ab 2011 jährliche Gipfeltreffen. In Begleitung zu den Gipfeltreffen, liest man immer wieder Überschriften in Artikeln, wie in der Onlineausgabe der FAZ vom 04.11.2011 und dieser beginnt mit den Worten, "Die Regierungen der 20 größten Industrie- und Schwellenlädner (G20) haben auf ihrem Gipfeltreffen in Cannes erstmals die internationalen Großbanken genannt, die von 2016 an zusätzliches Kapital vorhalten müssen." Oder ebenfalls eine Einleitung eines Artikels über die G20 und dem Gipfel aus diesem Jahr beginnt wie folgt: "Sind die G20 die neue Wirtschaftsregierung der Welt? Auf ihrem Gipfel in Los Cabos veranstalteten die mächtigsten Staaten eher eine reine Politik-Show. Wegweisende Beschlüsse gibt es nicht - übrig bleibt der ganz normale Gipfelwahnsinn".
Die Presse, zumindest in Deutschland, sieht die G20 als die größten und mächtigsten Staaten der Welt. Eine Verbindung aus Größe und Macht der Staaten und Verhandlungen, wie angedeutet über Fragen der internationalen politischen Ökonomie, wirft folgende Fragestellung auf:
Handelt es sich bei den G20 Staaten um die 20 Stärksten Volkswirtschaften des Globus?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Quellen- und Literaturdiskussion
- I.2 Methode
- II. Realistische Theorie
- III. Mitglieder der G20
- III.1 Daten der G20 Mitglieder
- III.1.1 Unregelmäßige Gipfelteilnehmer
- III.2 Entstehungsgeschichte und Themen der G20
- III.3 Erklärung des letzten Gipfeltreffens in Mexiko
- IV. Ranking von Staaten nach Bruttoinlandsprodukt
- V. Schlussfolgerungen
- VI. Was sollte getan werden?
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammensetzung der G20-Staaten und deren Verhältnis zur wirtschaftlichen Stärke der jeweiligen Volkswirtschaften. Die zentrale Fragestellung lautet: Sind die G20-Staaten tatsächlich die 20 stärksten Volkswirtschaften der Welt?
- Analyse der Zusammensetzung der G20 im Hinblick auf ökonomische Faktoren.
- Bewertung des Einflusses weiterer Faktoren (Herrschaftsform, Religion, Militärausgaben) auf die G20-Mitgliedschaft.
- Anwendung der realistischen Theorie auf die Zusammensetzung der G20.
- Vergleich der G20-Staaten mit einem Ranking der stärksten Volkswirtschaften.
- Diskussion der Bedeutung der G20 im Kontext der internationalen politischen Ökonomie.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der wirtschaftlichen Grundlage der G20-Zusammensetzung. Sie beleuchtet die mediale Darstellung der G20 als die mächtigsten Staaten und hinterfragt diese Annahme. Die Arbeit skizziert alternative Einflussfaktoren wie Herrschaftsform, Religion und Militärausgaben, argumentiert aber letztlich für die Dominanz ökonomischer Kriterien. Die These besagt, dass die G20-Mitgliedschaft primär von der Wirtschaftskraft abhängt.
I.1 Quellen- und Literaturdiskussion: Dieser Abschnitt diskutiert die verwendete Literatur, fokussiert auf Werke zur internationalen Politik, welche Theorien, Akteure und globale Probleme darstellen. Es wird der Mangel an empirischer Forschung zur G20-Zusammensetzung konstatiert und die Notwendigkeit, auf Quellen von G20-Teilnehmern und Daten zur Wirtschaftskraft zurückzugreifen, betont. Die unterschiedlichen Interessen von Ländern des globalen Nordens und Südens werden als potenzielle Quelle von Interpretationsschwierigkeiten hervorgehoben.
I.2 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die angewandte Methodik. Nach der Einleitung und Literaturdiskussion wird die realistische Theorie vorgestellt, eingebettet in den Kontext anderer Theorien der internationalen Beziehungen. Die Arbeit wird die G20-Staaten anhand von Daten zu Bevölkerung, Religion, Herrschaftsform und Militärausgaben präsentieren, die Entstehungsgeschichte und die Themen der G20 erläutern und diese mit einem Ranking der stärksten Volkswirtschaften vergleichen.
II. „Realistische“ Theorie: Dieser Abschnitt präsentiert den Realismus als einen dominanten Theoriestrang in der internationalen Beziehungen, im Vergleich zum Idealismus und Institutionalismus. Es werden die ereignis- und wissenschaftsgeschichtliche Einordnung des Realismus diskutiert.
Schlüsselwörter
G20, Internationale Beziehungen, Realismus, Wirtschaftskraft, Bruttoinlandsprodukt, globale Politik, Internationale Organisationen, ökonomische Macht, Schwellenländer, Industrieländer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der G20-Zusammensetzung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Zusammensetzung der G20-Staaten und deren Verhältnis zur wirtschaftlichen Stärke der jeweiligen Volkswirtschaften. Die zentrale Frage lautet: Sind die G20-Staaten tatsächlich die 20 stärksten Volkswirtschaften der Welt?
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Zusammensetzung der G20 unter Berücksichtigung ökonomischer Faktoren, bewertet den Einfluss weiterer Faktoren (Herrschaftsform, Religion, Militärausgaben) auf die G20-Mitgliedschaft, wendet die realistische Theorie auf die G20-Zusammensetzung an, vergleicht die G20-Staaten mit einem Ranking der stärksten Volkswirtschaften und diskutiert die Bedeutung der G20 im Kontext der internationalen politischen Ökonomie.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse, die auf Daten zu Bevölkerung, Religion, Herrschaftsform und Militärausgaben der G20-Staaten basiert. Die Entstehungsgeschichte und die Themen der G20 werden erläutert und mit einem Ranking der stärksten Volkswirtschaften verglichen. Die realistische Theorie dient als theoretischer Rahmen.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich primär auf den Realismus als theoretischen Rahmen der internationalen Beziehungen, der im Vergleich zum Idealismus und Institutionalismus diskutiert wird.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (mit Quellen- und Literaturdiskussion und Methodik), die Darstellung der realistischen Theorie, die Analyse der G20-Mitglieder (inklusive Daten und Entstehungsgeschichte), ein Ranking der Staaten nach Bruttoinlandsprodukt, Schlussfolgerungen, Handlungsempfehlungen und ein Fazit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Literatur zur internationalen Politik und verwendet Daten zu Wirtschaftskraft und weiteren relevanten Faktoren der G20-Staaten. Die unterschiedlichen Interessen von Ländern des globalen Nordens und Südens werden als potenzielle Quelle von Interpretationsschwierigkeiten berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Kapitel V und VII präsentiert. Es wird geprüft, ob die These, dass die G20-Mitgliedschaft primär von der Wirtschaftskraft abhängt, bestätigt werden kann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
G20, Internationale Beziehungen, Realismus, Wirtschaftskraft, Bruttoinlandsprodukt, globale Politik, Internationale Organisationen, ökonomische Macht, Schwellenländer, Industrieländer.
- Citar trabajo
- Christoph Deichert (Autor), 2012, Die Zusammensetzung der G20: Die größten Volkswirtschaften nach dem Bruttoinlandsprodukt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231794