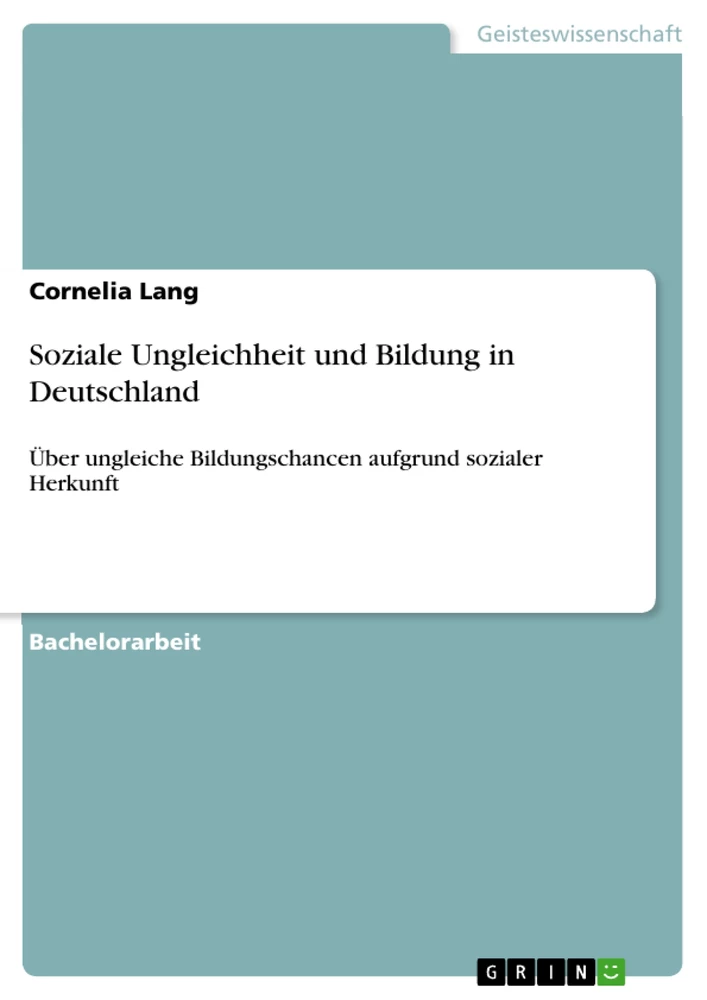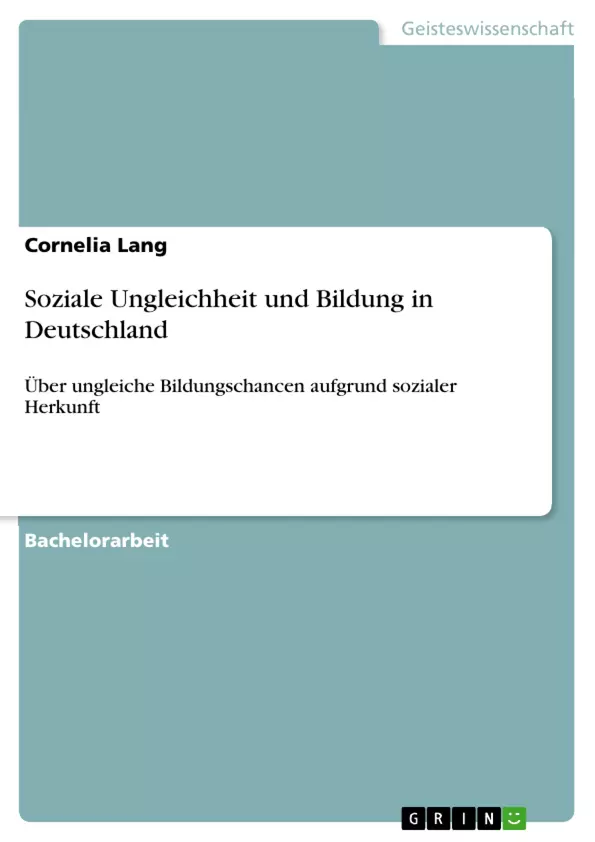In den vergangenen Jahren hat das Thema Bildungsungleichheit eine immer wiederkehrende Brisanz erlebt. Vor allem die Aussage, dass Bildung immer noch von der sozialen Herkunft abhängig ist, beschäftigt die aktuelle Bildungsforschung. Durch die Ergebnisse der PISA-Studien wird auch in der Öffentlichkeit vermehrt über die ungleichen Zugangschancen zur Bildung in unserer Gesellschaft diskutiert. So wurde festgestellt, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine große Spanne zwischen den obersten und untersten sozialen Bildungsschichten aufweist. Diese Ungleichheit ist nicht nur im Bildungsbereich ersichtlich, sondern spiegelt auch die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland wieder. Es wird zwar des Öfteren behauptet, dass Kinder überwiegend aufgrund ihrer schulischen Leistungen einen entsprechenden Bildungserfolg erreichen, doch empirische Untersuchungen bestätigen die vorhandene Wechselbeziehung zwischen Bildungschancen und sozialer Herkunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Soziale Ungleichheit
- 2.2 Bildungsungleichheit
- 2.3 Stände, Klassen und Schichten
- 2.4 Soziale Lage und Lebenslagen - Milieus und Lebensstile
- 3. Historische Entwicklung sozialer Ungleichheit
- 3.1 Die vorindustrielle Gesellschaft
- 3.2 Die frühindustrielle Gesellschaft
- 3.3 Die moderne Gesellschaft
- 4. Ursachen von Bildungsungleichheit in Deutschland
- 4.1 Die Bildungsexpansion
- 4.2 Institutionelle Bildungsungleichheit und Schichtzugehörigkeit
- 4.3 Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheit
- 4.4 Bildungsungleichheit und Migrationshintergrund
- 5. Bildung aufgrund sozialer Herkunft
- 5.1 Pierre Bourdieu - Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen
- 5.1.1 Die Kapitalarten
- 5.1.1.1 Ökonomisches Kapital
- 5.1.1.2 Kulturelles Kapital
- 5.1.1.3 Soziales Kapital
- 5.1.1.4 Symbolisches Kapital
- 5.1.2 Soziale Herkunft und Bildungschancen im Hochschulbereich
- 5.2 Raymond Boudon – primäre und sekundäre Disparitäten
- 5.2.1 Theorie der primären und sekundären Herkunftseffekte
- 5.2.2 Primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft beim Übergang in das Gymnasium
- 5.2.3 Primäre und sekundäre Effekte der sozialen Herkunft beim Übergang in die Hochschule
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungsungleichheiten in Deutschland. Ziel ist es, die Mechanismen der Reproduktion ungleicher Bildungschancen zu beleuchten. Hierzu werden die Theorien von Pierre Bourdieu und Raymond Boudon herangezogen und auf den Übergang in das Gymnasium und die Hochschule angewendet.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie soziale und bildungsbezogene Ungleichheit
- Historische Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland
- Ursachen von Bildungsungleichheit (Bildungsexpansion, institutionelle Faktoren, Geschlecht, Migration)
- Bourdieus Kapitalarten und deren Einfluss auf Bildungschancen
- Boudons Theorie der primären und sekundären Herkunftseffekte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Brisanz des Themas Bildungsungleichheit in Deutschland, insbesondere im Kontext der PISA-Studien und der anhaltenden Debatte über den Einfluss sozialer Herkunft auf Bildungserfolg. Die Arbeit fokussiert auf die ungleichen Bildungschancen aufgrund sozialer Herkunft und untersucht die Theorien von Pierre Bourdieu und Raymond Boudon zur Erklärung dieser Ungleichheiten, speziell im Hinblick auf den Übergang in Gymnasium und Hochschule. Die Struktur der Arbeit und die Forschungsfrage werden klar umrissen.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von zentralen Begriffen wie soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Stände, Klassen, Schichten, soziale Lage und Lebenslagen, sowie Milieus und Lebensstile. Es werden die jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexte beleuchtet und die Unterschiede zwischen den Begriffen herausgearbeitet. Der Fokus liegt auf der Klärung der terminologischen Grundlagen für die weitere Analyse.
3. Historische Entwicklung sozialer Ungleichheit: Das Kapitel bietet einen Überblick über die historische Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland, unterscheidet zwischen vorindustrieller, frühindustrieller und moderner Gesellschaft. Es wird aufgezeigt, wie sich die Formen und Ursachen sozialer Ungleichheit im Laufe der Zeit verändert haben und wie diese Entwicklungen die gegenwärtige Situation prägen. Der Abschnitt dient als wichtiger Kontext für das Verständnis der aktuellen Bildungsungleichheiten.
4. Ursachen von Bildungsungleichheit in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen von Bildungsungleichheit in Deutschland. Es beleuchtet die Auswirkungen der Bildungsexpansion, institutionelle Ungleichheiten, geschlechtsspezifische Unterschiede und den Einfluss des Migrationshintergrunds auf den Bildungserfolg. Die einzelnen Faktoren werden detailliert dargestellt und ihre Interdependenz wird herausgestellt.
5. Bildung aufgrund sozialer Herkunft: Dieses zentrale Kapitel präsentiert die Theorien von Pierre Bourdieu und Raymond Boudon zur Erklärung von Bildungsungleichheiten. Bourdieus Konzept der Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) wird erläutert und auf den Zugang zum Hochschulbereich angewendet. Die Theorie der primären und sekundären Herkunftseffekte von Boudon wird vorgestellt und anhand der Übergänge in das Gymnasium und die Hochschule analysiert. Die Kapitel zeigen auf, wie soziale Herkunft die Bildungschancen beeinflusst.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Soziale Ungleichheit, Soziale Herkunft, Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, Reproduktionstheorie, Primäre und sekundäre Herkunftseffekte, Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches Kapital), Bildungsexpansion, Deutschland, Hochschulzugang, Gymnasium.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungsungleichheiten in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert die Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungsungleichheiten in Deutschland. Im Fokus steht die Untersuchung der Mechanismen, die zu ungleichen Bildungschancen führen.
Welche Theorien werden im Text verwendet?
Der Text bezieht sich hauptsächlich auf die Theorien von Pierre Bourdieu (Kapitalarten: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) und Raymond Boudon (primäre und sekundäre Herkunftseffekte), um die Reproduktion ungleicher Bildungschancen zu erklären.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffserklärungen, Historische Entwicklung sozialer Ungleichheit, Ursachen von Bildungsungleichheit in Deutschland, Bildung aufgrund sozialer Herkunft und Schlussbetrachtung.
Was wird unter den Begriffen „Soziale Ungleichheit“ und „Bildungsungleichheit“ verstanden?
Der Text liefert präzise Definitionen dieser zentralen Begriffe, beleuchtet ihre historischen und gesellschaftlichen Kontexte und arbeitet die Unterschiede zwischen ihnen heraus. Die genaue Definition findet sich im Kapitel „Begriffserklärungen“.
Welche historischen Entwicklungen werden betrachtet?
Der Text betrachtet die historische Entwicklung sozialer Ungleichheit in Deutschland, unterteilt in vorindustrielle, frühindustrielle und moderne Gesellschaft, um den Kontext der gegenwärtigen Bildungsungleichheiten zu verstehen.
Welche Ursachen für Bildungsungleichheit werden untersucht?
Der Text analysiert verschiedene Ursachen, darunter die Bildungsexpansion, institutionelle Ungleichheiten, geschlechtsspezifische Unterschiede und den Einfluss des Migrationshintergrunds.
Wie werden Bourdieus Kapitalarten im Text angewendet?
Bourdieus Konzept der Kapitalarten wird erläutert und auf den Zugang zum Hochschulbereich angewendet, um aufzuzeigen, wie unterschiedliche Kapitalformen die Bildungschancen beeinflussen.
Wie werden Boudons primäre und sekundäre Herkunftseffekte im Text verwendet?
Boudons Theorie der primären und sekundären Herkunftseffekte wird vorgestellt und anhand der Übergänge in das Gymnasium und die Hochschule analysiert, um den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsentscheidungen zu beleuchten.
Welche konkreten Beispiele werden im Text genannt?
Der Text bezieht sich auf den Übergang in das Gymnasium und die Hochschule als konkrete Beispiele, um die Theorien von Bourdieu und Boudon zu veranschaulichen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Die Schlussfolgerung des Textes findet sich im Kapitel „Schlussbetrachtung“. Der Text fasst die Ergebnisse seiner Analyse der Auswirkungen sozialer Herkunft auf Bildungsungleichheiten zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, Soziale Ungleichheit, Soziale Herkunft, Pierre Bourdieu, Raymond Boudon, Reproduktionstheorie, Primäre und sekundäre Herkunftseffekte, Kapitalarten, Bildungsexpansion, Deutschland, Hochschulzugang, Gymnasium.
- Citation du texte
- Cornelia Lang (Auteur), 2013, Soziale Ungleichheit und Bildung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231438