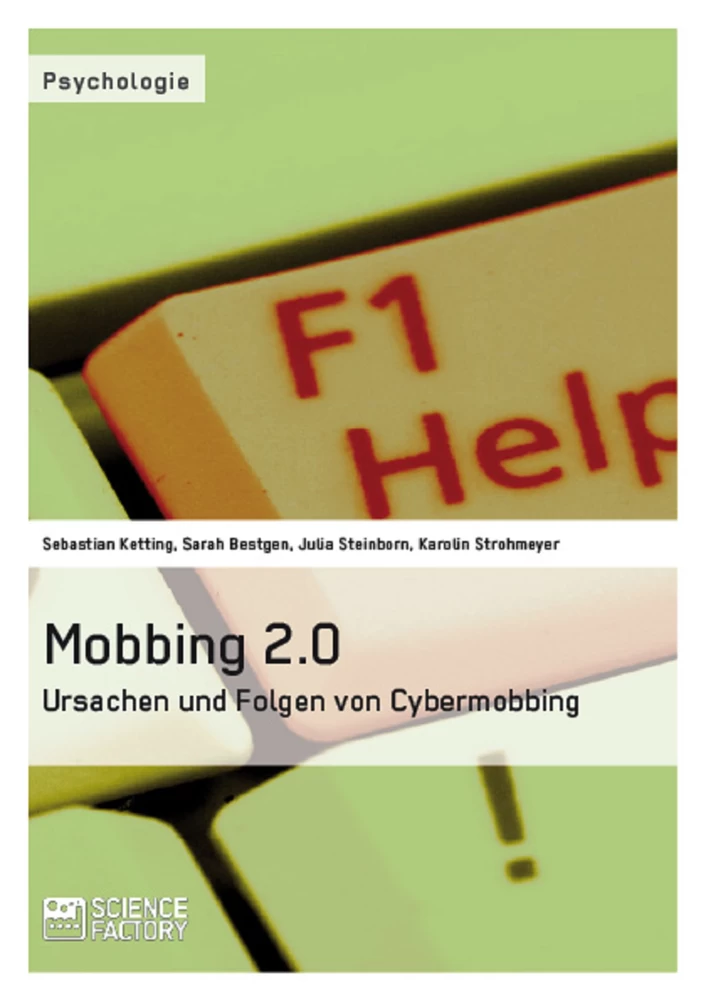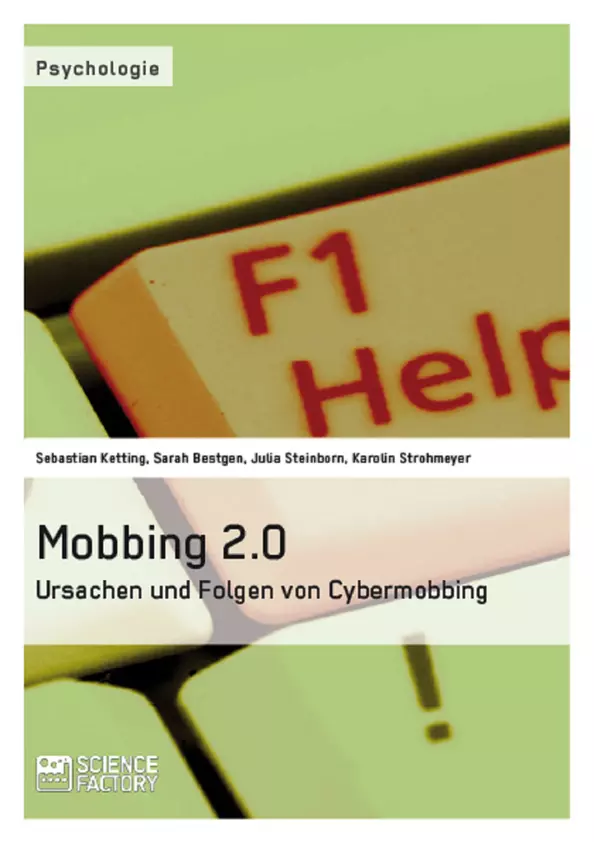Hemmschwelle adé – immer noch veröffentlichen viele Jugendliche nahezu
ihr ganzes Leben im World Wide Web. Besonders soziale Netzwerke
werden genutzt, um sich selbst darzustellen. Dabei können gepostete
Inhalte und Bilder schnell negative Reaktionen hervorrufen. Besonders
verletzend sind abfällige Kommentare zum Aussehen oder falsche Behauptungen
zur Person. In solchen Fällen sprechen Experten von Cybermobbing.
In diesem Buch wird diskutiert, wie Cybermobbing zustande kommt, mit
welchen Folgen die Opfer zu kämpfen haben und wie man sich vor Übergriffen
schützen kann.
Aus dem Inhalt: Kommunikation im Internet, Anonymität im Internet, Cybermobbing, Präventions- und Interaktionsstrategien, Offline Persönlichkeit vs. Online Persönlichkeit, Folgen für die Opfer, Opfer vs. Täter, Anlässe und Auslöser von Cyber-Mobbing, Möglichkeiten, sich zu schützen.
Inhaltsverzeichnis
- Offline Persönlichkeit vs. Online Persönlichkeit. Der Einfluss des Internets auf unsere Persönlichkeit am Beispiel des Cybermobbings
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Offline Persönlichkeit vs. Online Persönlichkeit
- Wechselwirkung zwischen der realen und der virtuellen Welt in Bezug auf unsere Persönlichkeit
- Gefahren des Internets für die Offline Persönlichkeit am Beispiel des Cybermobbings
- Fazit
- Literatur
- Die Auswirkungen von Anonymität in der Online-Kommunikation. Wie das Internet Cybermobbing ermöglicht und Nähe schafft
- Einleitung
- Kommunikation im Internet
- Anonymität im Internet
- Cybermobbing
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Internets auf die Persönlichkeit und die Rolle der Anonymität im Kontext von Cybermobbing. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen der realen und virtuellen Welt zu beleuchten und die Gefahren des Internets, insbesondere im Hinblick auf Cybermobbing, zu analysieren.
- Der Einfluss des Internets auf die Persönlichkeit
- Die Rolle der Anonymität bei Cybermobbing
- Die Gefahren von Cybermobbing für die Offline-Persönlichkeit
- Cybermobbing als neues Phänomen mit neuen Präventions- und Interaktionsstrategien
- Wechselwirkungen zwischen Online- und Offline-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Offline Persönlichkeit vs. Online Persönlichkeit. Der Einfluss des Internets auf unsere Persönlichkeit am Beispiel des Cybermobbings: Diese Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen der Offline- und Online-Persönlichkeit. Es wird analysiert, wie das Internet unsere Persönlichkeit beeinflusst und welche Gefahren, insbesondere durch Cybermobbing, daraus entstehen können. Die Studie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen realer und virtueller Welt und untersucht, wie sich das Online-Verhalten auf das Offline-Leben auswirkt. Konkrete Beispiele aus dem Bereich Cybermobbing veranschaulichen die potenziellen negativen Konsequenzen.
Die Auswirkungen von Anonymität in der Online-Kommunikation. Wie das Internet Cybermobbing ermöglicht und Nähe schafft: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Anonymität im Internet und deren Auswirkungen auf die Kommunikation, insbesondere im Zusammenhang mit Cybermobbing. Es wird analysiert, wie die Anonymität Cybermobbing ermöglicht und gleichzeitig paradoxerweise auch Nähe und vermeintliche Sicherheit schaffen kann. Die Arbeit untersucht die Mechanismen, die zu aggressivem Online-Verhalten führen und beleuchtet die verschiedenen Facetten der Online-Kommunikation, welche sowohl positive als auch negative Aspekte aufweisen.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Online-Persönlichkeit, Offline-Persönlichkeit, Anonymität, Internet, Kommunikation, Gefahren des Internets, Prävention, Interaktionsstrategien, virtuelle Welt, reale Welt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Einfluss des Internets auf die Persönlichkeit und Cybermobbing
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Internets auf die Persönlichkeit und die Rolle der Anonymität im Kontext von Cybermobbing. Sie beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen der realen und virtuellen Welt und analysiert die Gefahren des Internets, insbesondere im Hinblick auf Cybermobbing.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Einfluss des Internets auf die Persönlichkeit (Offline vs. Online Persönlichkeit), die Rolle der Anonymität bei Cybermobbing, die Gefahren von Cybermobbing für die Offline-Persönlichkeit, Cybermobbing als neues Phänomen mit neuen Präventions- und Interaktionsstrategien und die Wechselwirkungen zwischen Online- und Offline-Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus zwei Hauptkapiteln:
- "Offline Persönlichkeit vs. Online Persönlichkeit. Der Einfluss des Internets auf unsere Persönlichkeit am Beispiel des Cybermobbings": Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Offline- und Online-Persönlichkeit, den Einfluss des Internets und die Gefahren durch Cybermobbing.
- "Die Auswirkungen von Anonymität in der Online-Kommunikation. Wie das Internet Cybermobbing ermöglicht und Nähe schafft": Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Anonymität im Internet, ihre Auswirkungen auf die Kommunikation und den Zusammenhang mit Cybermobbing.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cybermobbing, Online-Persönlichkeit, Offline-Persönlichkeit, Anonymität, Internet, Kommunikation, Gefahren des Internets, Prävention, Interaktionsstrategien, virtuelle Welt, reale Welt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen der realen und virtuellen Welt zu beleuchten und die Gefahren des Internets, insbesondere im Hinblick auf Cybermobbing, zu analysieren.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Das erste Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen Offline- und Online-Persönlichkeit und die daraus resultierenden Gefahren durch Cybermobbing. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der Anonymität im Internet und deren Auswirkungen auf die Kommunikation im Zusammenhang mit Cybermobbing, wobei sowohl die ermöglichenden als auch die paradoxen Nähe-schaffenden Aspekte beleuchtet werden.
- Quote paper
- Sebastian Ketting (Author), Sarah Bestgen (Author), Julia Steinborn (Author), Karolin Strohmeyer (Author), 2013, Mobbing 2.0 – Ursachen und Folgen von Cybermobbing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231340