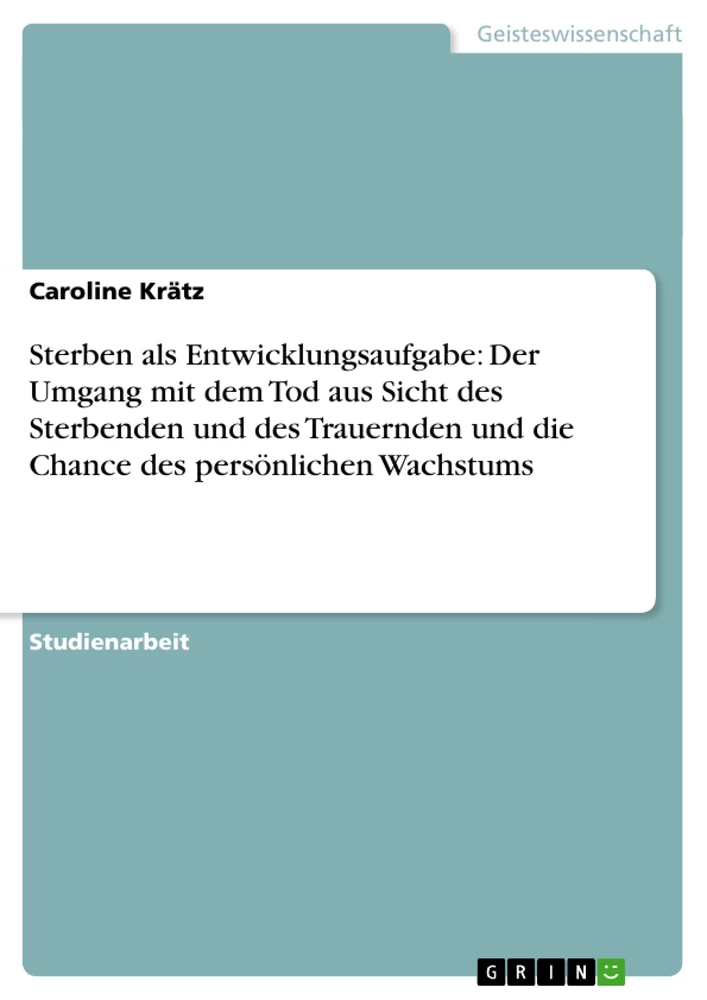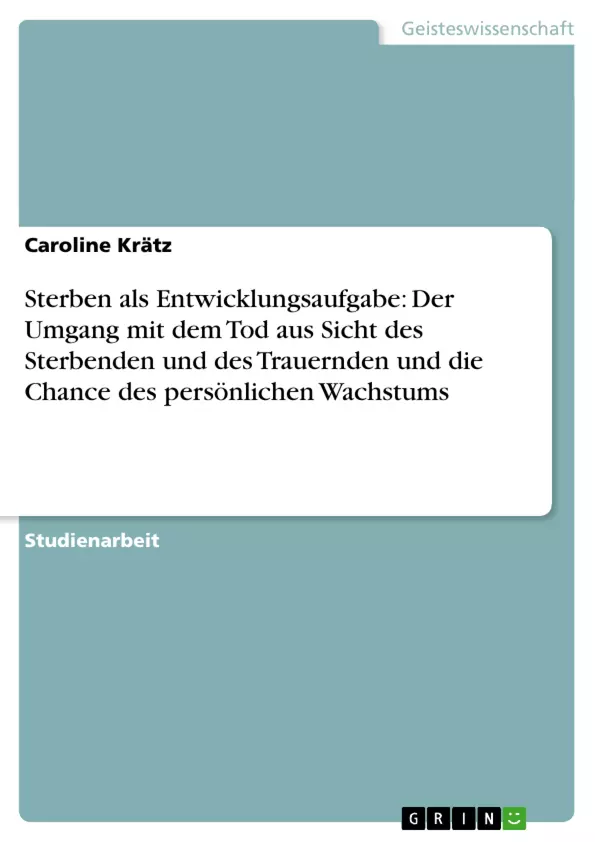Sterben als Entwicklung? In unserem Verständnis impliziert "Entwicklung" den Übergang auf eine höhere Stufe, eine Entwicklung zum Besseren. Der Glaube an das Jenseits und ein verheißungsvolles Leben nach dem Tod verlor und verliert aber immer mehr an Einfluss - in der Vorstellung der meisten Menschen unseres Kulturkreises endet das Leben mit dem Tod. Deshalb erscheint es paradox, genau in dieser Phase, in der der Körper und oft auch der Geist abbaut, einen letzten Wachstumsprozess anzunehmen.
Zwar ist sich der Mensch grundsätzlich und in abstrakter Weise seiner Endlichkeit bewusst - Testamente werden gemacht, Lebensversicherungen für die Hinterbliebenen abgeschlossen, ein Lebenstraum wird realisiert in Hinblick darauf, dass es irgendwann zu spät sein könnte. - Eine konkrete Beschäftigung mit dem Sterbeprozess erfolgt aber gewöhnlich erst durch äußere Auslöser z.B. Krankheit, Tod eines Angehörigen.
Trifft einen Menschen die Diagnose des baldigen Todes im hohen Alter, empfindet er selbst und auch die Angehörigen dies meist als gerecht, vielleicht schon erwartet; die durchschnittliche Lebenserwartung liegt heute etwa bei 70 Jahren - es ist also wesentlich wahrscheinlicher, erst im dritten Lebensabschnitt zu sterben, als z.B. zu Anfang des letzten Jahrhunderts, als die Lebenserwartung bei etwa 44 Jahren lag. Der frühe Tod wird in unserer Zeit deshalb meist problematischer, weil unerwartet und ungerecht empfunden. So ist die Verarbeitung des frühen Todes eines Angehörigen, womöglich sogar des eigenen Kindes weit schwieriger (vgl. Baltes+Skrotzki, 1998 S.1137ff).
Robert Havighurst formuliert meiner Meinung nach den Begriff der Entwicklungsaufgabe sehr schlüssig: Es ist eine Aufgabe, die dem Individuum in einer bestimmten Phase seines Lebens gestellt ist; das erfolgreiche Meistern dieser Aufgabe führt zu Zufriedenheit und Erfolg beim Lösen der noch kommenden Aufgaben; das Scheitern führt zu Unzufriedenheit und potentiellen Schwierigkeiten bei folgenden Entwicklungsaufgaben. Manche Aufgaben sind biologisch determiniert, z.B. wird von normal entwickelten Kindern das Sprechen im Alter von 2 - 3 Jahren erlernt. Frühere Versuche, dies dem Kind beizubringen, können nichts bewirken, da es die kognitiven Voraussetzungen noch nicht entwickelt hat. Verpasst das Kind diesen Zeitpunkt, z.B. durch Deprivation, kann es diese Lücke später nie vollständig schließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Ein letzter Wachstumsprozess?
- Das Erleben des eigenen Sterbens
- Elisabeth Kübler-Ross und das Phasenmodell des Sterbens
- Kritische Betrachtung der Arbeit von Elisabeth Kübler-Ross
- Die Trauer der Angehörigen
- Trauer als Wachstumsprozess?
- John Bowlby und die Bindungstheorie
- Das Phasenmodell der Trauer nach John Bowlby
- Kritische Betrachtung des Themenkomplexes Trauer bei John Bowlby
- Der Umgang mit Tod und Trauer in verschiedenen Kulturen
- Funktion der Rituale
- Griechische Klagegesänge
- Präsenz des Todes in Mexiko
- Trauern in unserer Kultur – Hindernisse und Möglichkeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Sterben als Entwicklungsaufgabe, aus Sicht des Sterbenden und des Trauernden. Sie untersucht die Chance des persönlichen Wachstums in diesen Phasen und analysiert die verschiedenen Modelle des Sterbe- und Trauerprozesses. Dabei stehen die Theorien von Elisabeth Kübler-Ross und John Bowlby im Fokus. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Bedeutung von Trauerritualen und den Umgang mit Tod und Trauer in verschiedenen Kulturen.
- Sterben als Entwicklungsaufgabe
- Das Phasenmodell des Sterbens nach Kübler-Ross
- Trauer als Wachstumsprozess
- Die Bindungstheorie und das Phasenmodell der Trauer nach Bowlby
- Der Einfluss von Kultur auf den Umgang mit Tod und Trauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Sterbens als Entwicklungsaufgabe vor und beleuchtet die Paradoxie des Wachstums in einer Phase des Abbaus. Sie erläutert die Bedeutung von Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf und zeigt, wie Sterben und Trauern in verschiedenen Lebensabschnitten auftreten können.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Erleben des eigenen Sterbens. Es beschreibt das Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross, das die typischen Reaktionen von Sterbenden auf die Diagnose einer tödlichen Krankheit beschreibt. Weiterhin werden kritische Punkte des Modells beleuchtet.
Im dritten Kapitel stehen die Trauer der Angehörigen im Mittelpunkt. Es werden die Theorien von John Bowlby zur Bindungstheorie und das Phasenmodell der Trauer diskutiert, sowie kritische Anmerkungen zum Themenkomplex Trauer bei John Bowlby.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Umgang mit Tod und Trauer in verschiedenen Kulturen. Es werden die Funktion von Trauerritualen erläutert und beispielhaft der Umgang mit Tod und Trauer in Griechenland und Mexiko beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sterben, Entwicklungsaufgabe, Elisabeth Kübler-Ross, Phasenmodell, Trauer, John Bowlby, Bindungstheorie, Kultur, Rituale, Wachstum, Tod, Lebensabschnitte, Trauerarbeit, Angehörige.
Häufig gestellte Fragen
Kann Sterben als „Entwicklungsaufgabe“ verstanden werden?
Ja, basierend auf Robert Havighurst wird Sterben als biologisch determinierte Aufgabe betrachtet, deren Bewältigung zu Zufriedenheit oder Unzufriedenheit führen kann.
Was besagt das Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross?
Es beschreibt typische psychologische Reaktionen Sterbender auf eine tödliche Diagnose, unterteilt in verschiedene Phasen wie Leugnen, Zorn und Akzeptanz.
Wie definiert John Bowlby den Trauerprozess?
Bowlby nutzt die Bindungstheorie, um Trauer als Reaktion auf den Verlust einer engen Bindung zu erklären und unterteilt diesen Prozess ebenfalls in Phasen.
Welche kulturellen Unterschiede gibt es im Umgang mit dem Tod?
Die Arbeit vergleicht Rituale wie griechische Klagegesänge mit der starken Präsenz des Todes in der mexikanischen Kultur, um unterschiedliche Bewältigungsstrategien aufzuzeigen.
Bietet Trauer eine Chance für persönliches Wachstum?
Trotz des körperlichen Abbaus wird untersucht, inwiefern der psychologische Prozess der Trauerarbeit zu einer Reifung und einem „letzten Wachstumsprozess“ führen kann.
- Citation du texte
- Caroline Krätz (Auteur), 2004, Sterben als Entwicklungsaufgabe: Der Umgang mit dem Tod aus Sicht des Sterbenden und des Trauernden und die Chance des persönlichen Wachstums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23117