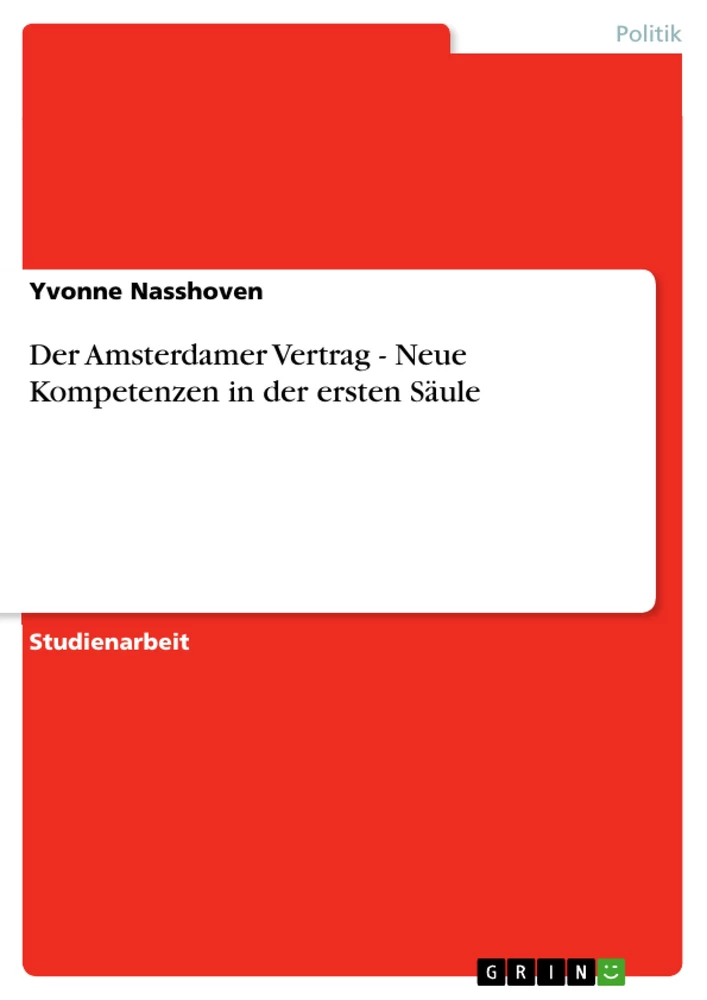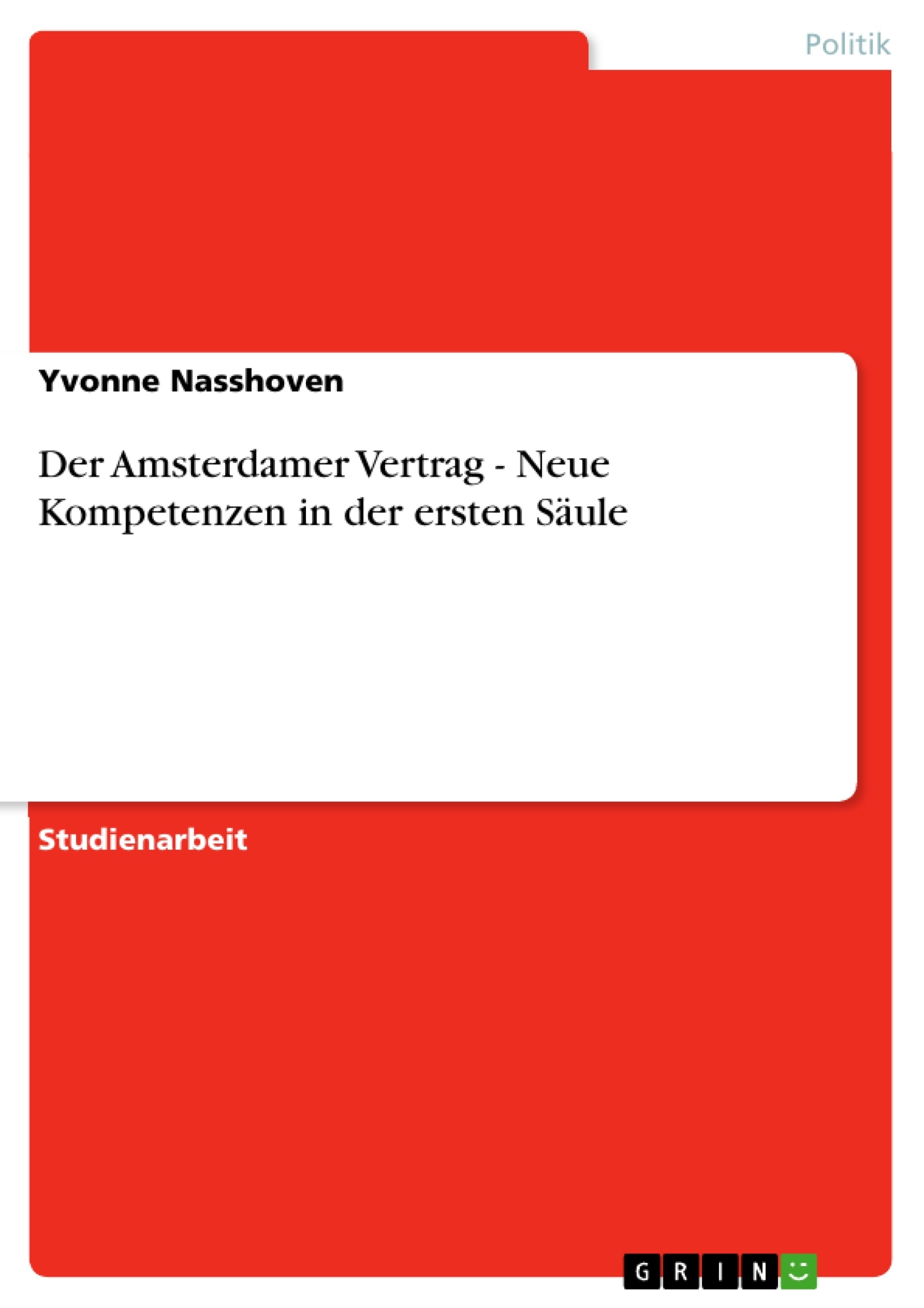Einleitung
Der 1997 verabschiedete Vertrag von Amsterdam sollte die Europäische Union im Hinblick auf eine immer größer werdende Gruppe von Mitgliedsstaaten auf die nächsten Jahre vorbereiten. Sowohl institutionelle als auch sachpolitische Fragen standen zur Diskussion, die sowohl im Vorfeld diskutiert, als auch auf der Regierungskonferenz selbst erörtert wurden.
Doch haben die vorgenommenen Reformen wirklich das Ziel erreicht, eine leistungsfähigere und bürgernähere Europäische Union zu schaffen oder standen doch wieder nationale Interessen dem Fortschritt des Reformprozesses im Wege?
In Zusammenhang mit dieser Fragestellung möchte ich über die Vorgeschichte der Revisionskonferenz die wichtigsten Punkte des Amsterdamer Vertrages erläutern, um dann abschließend ein Fazit ziehen zu können.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Säulenmodell der Europäischen Union
- 2.1 Das Säulenmodell nach dem Vertrag von Maastricht
- 2.2 Das Säulenmodell nach dem Vertrag von Amsterdam
- 3. Der Weg nach Amsterdam
- 3.1 Die Vorbereitung der Verhandlungen
- 3.2 Von den Entwürfen zum Vertrag von Amsterdam
- 4. Kompetenzen in der ersten Säule nach dem Vertrag von Amsterdam
- 4.1 Der Titel Visa, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr (Titel IV)
- 4.2 Sozialpolitik nach dem Vertrag von Amsterdam
- 4.3 Beschäftigungspolitik
- 4.4 Die Bekämpfung von Diskriminierung
- 4.5 Weitere Neuerungen
- 5. Konsequenzen des Vertrags von Amsterdam
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Vertrag von Amsterdam von 1997 und seine Auswirkungen auf die Europäische Union. Sie analysiert die Vorgeschichte der Vertragsrevision, die wichtigsten Änderungen im Säulenmodell, insbesondere in der ersten Säule, und die damit verbundenen Herausforderungen und Konsequenzen. Die Arbeit fragt nach dem Erfolg der Reformen im Hinblick auf eine leistungsfähigere und bürgernähere EU.
- Das Säulenmodell der EU vor und nach Amsterdam
- Der Verhandlungsprozess und die Vorbereitung der Regierungskonferenz
- Neue Kompetenzen der EU in der ersten Säule (z.B. Visa, Einwanderung, Sozialpolitik)
- Die Rolle nationaler Interessen im Reformprozess
- Auswirkungen des Vertrages auf die Funktionsweise der EU
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Vertrags von Amsterdam ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Erfolg der Reformen in Bezug auf eine leistungsfähigere und bürgernähere EU. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse der Vorgeschichte, der wichtigsten Punkte des Vertrages und eines abschließenden Fazits an. Die Einleitung betont die Bedeutung der Reformen im Hinblick auf eine wachsende Zahl von Mitgliedsstaaten und die Notwendigkeit, institutionelle und sachpolitische Fragen zu adressieren.
2. Das Säulenmodell der Europäischen Union: Dieses Kapitel beschreibt das Säulenmodell der EU, zunächst im Zustand nach dem Vertrag von Maastricht, mit seinen drei Säulen: Gemeinschaftsverträge (erste Säule), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP, zweite Säule) und Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (dritte Säule). Es hebt die Unterschiede in den Integrationsansätzen der einzelnen Säulen hervor – die erste Säule mit ihrem Fokus auf den seit 1957 eingeschlagenen Integrationsweg, im Gegensatz zu den zwischenstaatlichen Kooperationen der zweiten und dritten Säule. Anschließend wird die Umstrukturierung nach dem Vertrag von Amsterdam erläutert, mit der Vergemeinschaftung der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen innerhalb der ersten Säule und der damit verbundenen Reduzierung der dritten Säule. Die Sonderrolle von Großbritannien, Irland und Dänemark in Bezug auf die Teilnahme an EU-Maßnahmen wird ebenfalls angesprochen.
3. Der Weg nach Amsterdam: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorbereitungen und den Verlauf der Regierungskonferenz von Amsterdam. Es beschreibt den Prozess der Vertragsrevision, beginnend mit dem Artikel N des Vertrags über die Europäische Union, der die Überprüfung der Funktionsweise der neuen Bestimmungen und weitere Änderungen vorsah. Die Rolle von Berichten der EU-Organe, einer Reflexionsgruppe unter Carlos Westendorp und die Beteiligung der Kommission und des Europäischen Parlaments werden detailliert dargestellt. Die Kapitel beschreibt die Ziele der Vertragsrevision, darunter die Verbesserung der Arbeitsweise der Organe, eine bessere Repräsentation der EU in der GASP und eine bürgernähere Gestaltung der Institutionen.
4. Kompetenzen in der ersten Säule nach dem Vertrag von Amsterdam: Dieser Abschnitt analysiert die im Vertrag von Amsterdam neu gewonnenen Kompetenzen der ersten Säule. Es werden spezifische Beispiele genannt, wie der Titel IV ("Visa, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr"), die Veränderungen der Sozialpolitik, die Beschäftigungspolitik, Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung und weitere Neuerungen. Das Kapitel untersucht die detaillierten Veränderungen und Erweiterungen der Kompetenzen, die die erste Säule nach dem Vertrag von Amsterdam erhalten hat. Es zeigt die tiefgreifenden Auswirkungen auf die Politikbereiche der ersten Säule und deutet auf die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen hin.
Häufig gestellte Fragen zum Vertrag von Amsterdam
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht den Vertrag von Amsterdam von 1997 und seine Auswirkungen auf die Europäische Union. Sie analysiert die Vorgeschichte der Vertragsrevision, die wichtigsten Änderungen im Säulenmodell, insbesondere in der ersten Säule, und die damit verbundenen Herausforderungen und Konsequenzen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: War die Reform erfolgreich im Hinblick auf eine leistungsfähigere und bürgernähere EU?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Säulenmodell der EU vor und nach Amsterdam; den Verhandlungsprozess und die Vorbereitung der Regierungskonferenz; neue Kompetenzen der EU in der ersten Säule (z.B. Visa, Einwanderung, Sozialpolitik); die Rolle nationaler Interessen im Reformprozess; und die Auswirkungen des Vertrages auf die Funktionsweise der EU.
Wie ist das Säulenmodell der EU vor und nach Amsterdam aufgebaut?
Vor Amsterdam bestand das Säulenmodell aus drei Säulen: Gemeinschaftsverträge (erste Säule), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP, zweite Säule) und Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (dritte Säule). Nach Amsterdam wurde die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Zivilsachen in die erste Säule integriert, was zur Reduzierung der dritten Säule führte. Die Unterschiede in den Integrationsansätzen der Säulen (supranational vs. intergouvernemental) werden ebenfalls beleuchtet.
Wie verlief der Weg zum Vertrag von Amsterdam?
Das Kapitel "Der Weg nach Amsterdam" beschreibt den Prozess der Vertragsrevision, beginnend mit Artikel N des Vertrags über die Europäische Union. Es werden die Rolle von Berichten der EU-Organe, einer Reflexionsgruppe unter Carlos Westendorp und die Beteiligung der Kommission und des Europäischen Parlaments detailliert dargestellt. Die Ziele der Revision waren die Verbesserung der Arbeitsweise der Organe, eine bessere Repräsentation der EU in der GASP und eine bürgernähere Gestaltung der Institutionen.
Welche neuen Kompetenzen erhielt die erste Säule nach Amsterdam?
Der Vertrag von Amsterdam erweiterte die Kompetenzen der ersten Säule erheblich. Konkrete Beispiele sind der Titel IV ("Visa, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr"), Änderungen in der Sozialpolitik, Beschäftigungspolitik, Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung und weitere Neuerungen. Die Arbeit analysiert die detaillierten Veränderungen und ihre Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 beschreibt das Säulenmodell der EU vor und nach Amsterdam. Kapitel 3 beleuchtet den Weg zum Vertrag von Amsterdam. Kapitel 4 analysiert die neuen Kompetenzen der ersten Säule. Kapitel 5 (Konsequenzen) zieht abschließende Schlussfolgerungen.
Welche Rolle spielten nationale Interessen im Reformprozess?
Die Arbeit untersucht die Rolle nationaler Interessen im Reformprozess, obwohl dies nicht explizit in den beschriebenen Inhaltsangaben erwähnt wird. Es ist zu erwarten, dass die Analyse der Verhandlungsprozesse und die Diskussion der Kompromisse Hinweise auf die Bedeutung nationaler Interessen liefern.
Wie wird der Erfolg der Reformen bewertet?
Die Arbeit bewertet den Erfolg der Reformen anhand der Frage, ob sie zu einer leistungsfähigeren und bürgernäheren EU geführt haben. Die abschließende Bewertung wird im letzten Kapitel (Konsequenzen des Vertrags von Amsterdam) präsentiert. Die Rolle von Großbritannien, Irland und Dänemark in Bezug auf die Teilnahme an EU-Maßnahmen wird ebenfalls berücksichtigt.
- Citar trabajo
- Yvonne Nasshoven (Autor), 2001, Der Amsterdamer Vertrag - Neue Kompetenzen in der ersten Säule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2297