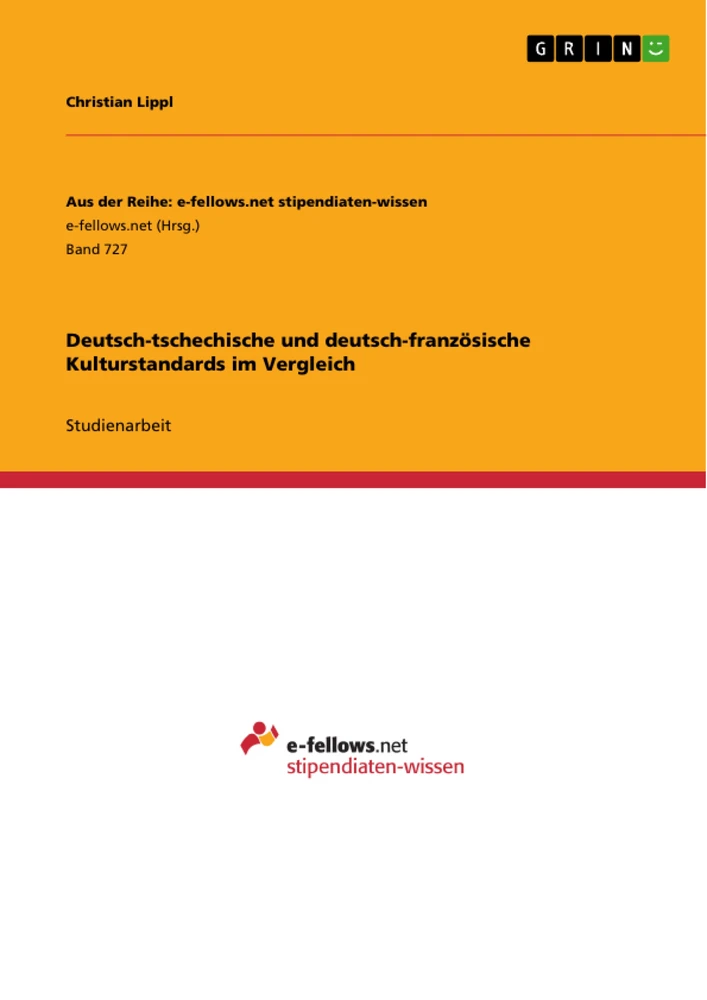Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der interkulturellen Kommunikation und Zusammenarbeit im Unternehmen. Im Zuge der europäischen Vereinigung und der Globalisierung formen sich immer mehr bi- und multinationale Unternehmen heraus, in denen es aufgrund von verschiedenen Verhaltensmustern, Wertevorstellungen und Normen zu Problemen in der Zusammenarbeit kommen kann.
Im Folgenden wird ein Konzept der interkulturellen Zusammenarbeit behandelt, das unterschiedliche Länder und Kulturen anhand von Kulturstandards vergleicht und dadurch Rückschlüsse auf ein angemessenes, „richtiges“ und erfolgreiches Verhalten in der interkulturellen Kommunikation zieht.
In einem ersten Schritt wird auf diese Theorie allgemein näher eingegangen. Dabei ist es wichtig, zu untersuchen, welcher Kulturbegriff dieser Lehre zugrunde liegt, bevor eine Definition von „Kulturstandards“ vorgenommen werden kann. Um anschließend mit den Ergebnissen, die auf dieser Lehre beruhen, weiterarbeiten zu können, muss auch deutlich gemacht werden, mit welcher Methodik die Forscher vorgegangen sind.
Im Zentrum dieser Arbeit soll der Vergleich zwischen den deutsch-tschechischen und den deutsch-französischen Kulturstandards stehen. Dabei wird jedoch nicht auf eigene Forschungsergebnisse zurückgegriffen, da dies im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war. Vielmehr werden die Resultate der Befragungen von Dr. Sylvia Schroll-Machl und Prof. Ing. Ivan Nový für die tschechische Seite und hauptsächlich von Dipl.-Psych. Markus Molz für die französische Seite verglichen. Es wird so vorgegangen, dass zunächst immer ein deutsch-tschechisches Kulturstandardpaar näher beschrieben wird, bevor untersucht wird, ob es ein französisches Pendant dazu gibt und inwiefern sich der Kontrast von Tschechien zu Deutschland in dem jeweiligen Punkt auch im Vergleich von Deutschland und Frankreich wieder finden lässt.
Anschließend daran wird versucht, eine Synthese des Vergleichs herauszuarbeiten, wobei man sich im Klaren sein muss, dass die Ergebnisse der zugrunde gelegten Forschungen immer Deutschland als Bezugspunkt haben, was auf dem kulturrelativistischen Ansatz der Kulturstandardtheorie beruht.
Um die Aussagekraft der Vergleichsresultate zu relativieren, wird im letzten Schritt der Arbeit nochmals deutlich auf die Grenzen und die Schwächen dieses Kulturstandardkonzepts eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Deutsch-tschechische und deutsch-französische Kulturstandards im Vergleich
- 1. Kulturstandardtheorie
- 1.1 Definition von Kultur und Kulturstandards
- 1.2 Generierung von Kulturstandards
- 2. Deutsch-tschechische Kulturstandardpaare im Vergleich zu Frankreich
- 2.1 Sachorientierung vs. Personenorientierung
- 2.2 Aufwertung vs. Abwertung von Strukturen
- 2.3 Konsekutivität vs. Simultanität
- 2.4 Starker vs. schwacher Kontext
- 2.5 Trennung vs. Diffusion von Lebensbereichen
- 2.6 Regelorientierte vs. personenorientierte Kontrolle
- 2.7 Konfliktkonfrontation vs. Konfliktvermeidung
- 2.8 Stabile vs. schwankende Selbstsicherheit
- 2.9 Synthese aus dem Vergleich
- 1. Kulturstandardtheorie
- III. Grenzen des Kulturstandardkonzepts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen, insbesondere im Kontext der deutsch-tschechischen und deutsch-französischen Beziehungen. Sie analysiert die Kulturstandardtheorie als ein Konzept zum Vergleich verschiedener Kulturen und deren Einfluss auf die Interaktion. Ziel ist es, anhand bestehender Forschungsergebnisse Verhaltensmuster und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zu beleuchten.
- Vergleich deutsch-tschechischer und deutsch-französischer Kulturstandards
- Anwendung der Kulturstandardtheorie auf interkulturelle Kommunikation
- Analyse von Kulturstandardpaaren (z.B. Sachorientierung vs. Personenorientierung)
- Identifizierung von kulturellen Unterschieden und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
- Bewertung der Grenzen und Schwächen des Kulturstandardkonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Die Einleitung stellt das Thema der interkulturellen Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen im Kontext der Globalisierung vor. Sie führt in die Kulturstandardtheorie ein, deren zugrundeliegenden Kulturbegriff erläutert und die Methodik der Forschung darlegt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich deutsch-tschechischer und deutsch-französischer Kulturstandards basierend auf existierenden Forschungsarbeiten von Dr. Sylvia Schroll-Machl, Prof. Ing. Ivan Nový und Dipl.-Psych. Markus Molz. Die Arbeit betont den kulturrelativistischen Ansatz der Theorie, wobei Deutschland als Referenzpunkt dient. Die Einleitung kündigt abschließend die kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen des Kulturstandardkonzepts an.
II. Deutsch-tschechische und deutsch-französische Kulturstandards im Vergleich: Dieses Kapitel analysiert verschiedene deutsch-tschechische Kulturstandardpaare und vergleicht sie mit den entsprechenden französischen Pendants. Es werden zentrale Gegensatzpaare wie Sachorientierung vs. Personenorientierung, Aufwertung vs. Abwertung von Strukturen, Konsekutivität vs. Simultanität, und weitere untersucht. Für jedes Paar wird der deutsch-tschechische Unterschied detailliert beschrieben und anschließend im Kontext des deutsch-französischen Verhältnisses analysiert. Das Kapitel gipfelt in einer Synthese der Vergleichsergebnisse, wobei die Limitationen, basierend auf der Wahl Deutschlands als Referenzpunkt innerhalb des kulturrelativistischen Ansatzes der Kulturstandardtheorie, berücksichtigt werden.
III. Grenzen des Kulturstandardkonzepts: Dieses Kapitel (voraussichtlich) behandelt kritisch die Limitationen und Schwächen des Kulturstandardkonzepts. Es wird vermutlich auf die Vereinfachung komplexer kultureller Phänomene, die Gefahr der Stereotypisierung und die potenzielle Vernachlässigung individueller Unterschiede eingegangen. Weitere Aspekte können die eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte oder die methodischen Herausforderungen bei der Erhebung und Interpretation von Kulturstandards umfassen.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kommunikation, Kulturstandardtheorie, deutsch-tschechische Beziehungen, deutsch-französische Beziehungen, Kulturvergleich, Sachorientierung, Personenorientierung, Strukturen, Konsekutivität, Simultanität, Konfliktmanagement, Kulturrelativismus, Methodenkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Deutsch-tschechische und deutsch-französische Kulturstandards im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen, insbesondere im deutsch-tschechischen und deutsch-französischen Kontext. Sie analysiert die Kulturstandardtheorie als Werkzeug zum Vergleich verschiedener Kulturen und deren Einfluss auf die Interaktion.
Welche Kulturstandards werden verglichen?
Der Fokus liegt auf dem Vergleich deutsch-tschechischer und deutsch-französischer Kulturstandards. Es werden verschiedene Gegensatzpaare analysiert, darunter Sachorientierung vs. Personenorientierung, Aufwertung vs. Abwertung von Strukturen, Konsekutivität vs. Simultanität und weitere.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Kulturstandardtheorie als theoretisches Fundament. Diese Theorie dient als Konzept zum Vergleich verschiedener Kulturen und deren Einfluss auf die Kommunikation und Zusammenarbeit.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsergebnissen von Dr. Sylvia Schroll-Machl, Prof. Ing. Ivan Nový und Dipl.-Psych. Markus Molz. Ein kulturrelativistischer Ansatz wird verfolgt, wobei Deutschland als Referenzpunkt dient.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einführung in die Thematik und die Kulturstandardtheorie, einen Vergleich deutsch-tschechischer und deutsch-französischer Kulturstandards anhand verschiedener Gegensatzpaare und abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen des Kulturstandardkonzepts.
Welche konkreten Kulturstandardpaare werden analysiert?
Es werden mehrere Kulturstandardpaare detailliert untersucht, darunter Sachorientierung vs. Personenorientierung, Aufwertung vs. Abwertung von Strukturen, Konsekutivität vs. Simultanität, starker vs. schwacher Kontext, Trennung vs. Diffusion von Lebensbereichen, regelorientierte vs. personenorientierte Kontrolle, Konfliktkonfrontation vs. Konfliktvermeidung und stabile vs. schwankende Selbstsicherheit.
Welche Einschränkungen des Kulturstandardkonzepts werden diskutiert?
Das dritte Kapitel widmet sich einer kritischen Betrachtung der Grenzen des Kulturstandardkonzepts. Hier werden Aspekte wie Vereinfachung komplexer kultureller Phänomene, die Gefahr der Stereotypisierung, die Vernachlässigung individueller Unterschiede, die eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse und methodische Herausforderungen bei der Erhebung und Interpretation von Kulturstandards diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Kommunikation, Kulturstandardtheorie, deutsch-tschechische Beziehungen, deutsch-französische Beziehungen, Kulturvergleich, Sachorientierung, Personenorientierung, Strukturen, Konsekutivität, Simultanität, Konfliktmanagement, Kulturrelativismus, Methodenkritik.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, anhand bestehender Forschungsergebnisse Verhaltensmuster und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit in interkulturellen Kontexten zu beleuchten und die Anwendbarkeit und Grenzen der Kulturstandardtheorie zu evaluieren.
Wo kann ich mehr über die verwendeten Forschungsarbeiten erfahren?
Die Arbeit basiert auf den Forschungsarbeiten von Dr. Sylvia Schroll-Machl, Prof. Ing. Ivan Nový und Dipl.-Psych. Markus Molz. Weitere Details zu den verwendeten Quellen sind (voraussichtlich) im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit zu finden.
- Citar trabajo
- Christian Lippl (Autor), 2006, Deutsch-tschechische und deutsch-französische Kulturstandards im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229597