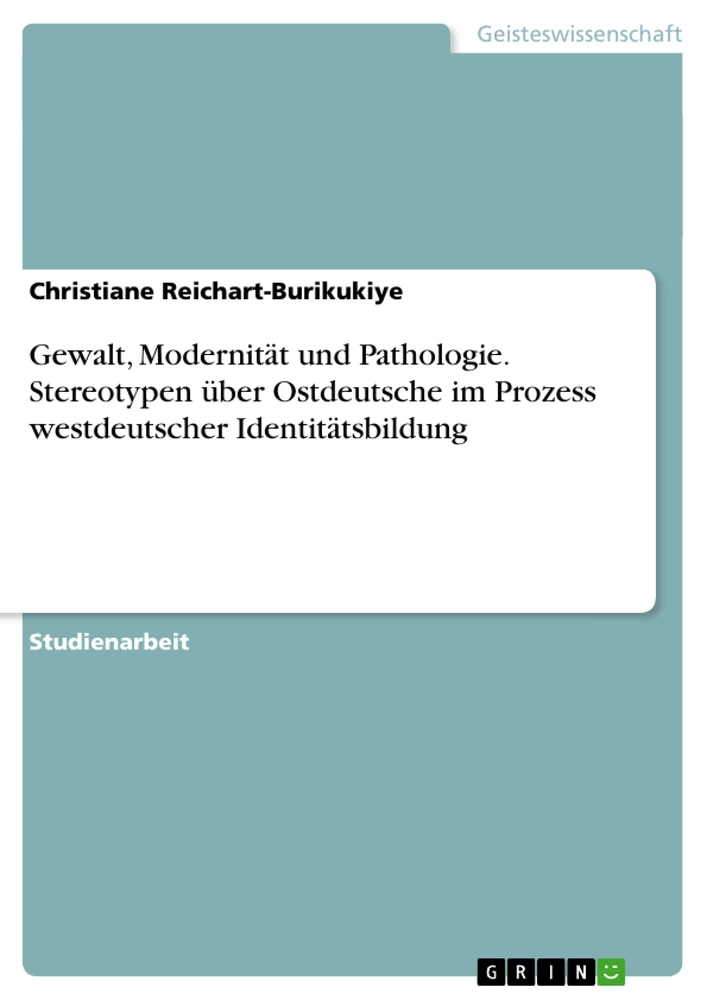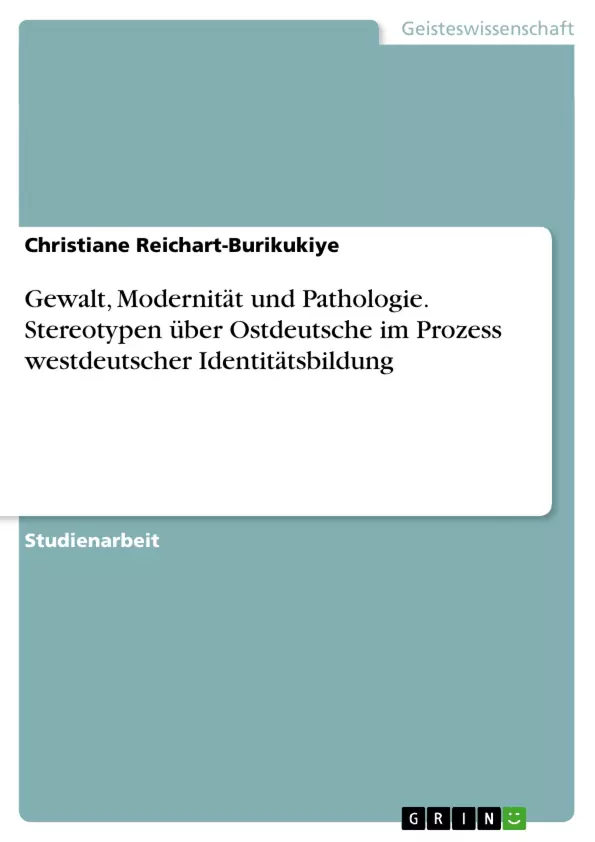Seit mehr als einem halben Jahrzehnt ist das Motiv der Ost-Identität, der Ost-Nostalgie oder Ostalgie ein immer wieder gern aufgegriffenes Modethema der deutschen Medienlandschaft. So mancher Journalist fühlt sich als Entdecker des Phänomens, diagnostiziert, diskutiert und kommentiert es. Als bestimmende Indizien findet man die auf allen Ebenen stattfindende Rückkehr in altvertrautes aus DDR-Zeiten und die gleichzeitige Abkehr von den zuvor bejubelten westlichen Neuerungen. Die Diskurse über die Eigenheiten der Ostdeutschen und deren identitätsstiftende Eigenschaften verlieren dabei meist einen wichtigen Punkt aus dem Auge. Im außereuropäischen Kontext ist es längst keine neue Erkenntnis mehr, dass die Betonung der Differenz vor allem einen Zweck hat und stets damit einher geht: im Anderen, im Fremden, den Abgrenzungspunkt zu schaffen, um die eigene Identität zu festigen und zu bestätigen. 1 Hinter dem Interesse für das neue Selbstbewusstsein des Ostens aber bleibt oft zurück, dass nicht nur die Ostdeutschen im Westdeutschen einen Abgrenzungspunkt sehen, sondern dass auch umgekehrt die Distanzierung in einer allumfassenden und machtvollen Form geschah und geschieht. Die Ostdeutschen wurden in den Jahren nach der Wiedervereinigung von den Medien zu einer Form von Exoten stilisiert, was sicher zur Stärkung eines ostdeutschen Gemeinschaftsgefühls beitrug, andrerseits aber vor allem zur Bestätigung der westdeutschen Identität. Durch die Dominanz westdeutscher Journalisten und Journalistinnen in den Medien blieben westliche Werte konstante, unabänderliche Faktoren, Selbstverständlichkeiten, offiziell nicht hinterfragt und kaum einen Kommentar wert. Die Existenz dieses Gegenübers, der Ostdeutschen, bestärkt vor allem den Identifikationsmechanismus mit dem Eigenen, mit westdeutschen Normen und Werten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. WIR UND DIE ANDEREN
- 1.1. Fremde im eigenen Land
- 1.2. (Ost-West) Deutsche Stereotypen
- 2. BAUSTEINE DER GRENZZIEHUNG
- 2.1. Die Kategorie Gewalt
- 2.2. Modernität und Rückständigkeit
- 2.3. Die Macht der Kindheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stereotype über Ostdeutsche im Prozess der westdeutschen Identitätsbildung. Sie analysiert, wie die Unterscheidung zwischen Ost und West zur Stärkung der westdeutschen Identität beigetragen hat.
- Die Konstruktion des "Anderen" in der ethnographischen Tradition
- Die Rolle der Medien in der Darstellung von Ostdeutschen
- Die Verwendung von Stereotypen zur Abgrenzung und Identitätsbildung
- Die Folgen der Westdeutschen Dominanz in der Medienlandschaft
- Die Auswirkungen auf das Selbstverständnis von Ost- und Westdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 "Wir und die Anderen": Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des "Fremden" in der Gesellschaft und analysiert, wie die Abgrenzung vom "Anderen" zur Konstruktion der eigenen Identität beiträgt. Die Arbeit stellt fest, dass die Darstellung des "Fremden" oft negativ konnotiert ist und zur Disqualifikation des Anderen führt.
- Kapitel 1.1 "Fremde im eigenen Land": Der Abschnitt untersucht die Bedeutung der "Fremdheit" im Kontext der deutschen Gesellschaft. Er analysiert, wie die "Fremdheit" in der Ethnologie und im Umgang mit anderen Kulturen konstruiert wird und welche Folgen dies für die Wahrnehmung und den Umgang mit dem "Anderen" hat.
- Kapitel 1.2 "(Ost-West) Deutsche Stereotype": Dieser Abschnitt fokussiert auf die Stereotype, die im Kontext der deutschen Wiedervereinigung über Ostdeutsche verbreitet wurden. Er analysiert, wie diese Stereotype zur Abgrenzung und zur Stärkung der westdeutschen Identität verwendet wurden.
- Kapitel 2 "Bausteine der Grenzziehung": Das Kapitel untersucht verschiedene Elemente, die zur Abgrenzung zwischen Ost- und Westdeutschen beigetragen haben. Es analysiert, wie diese Elemente, wie Gewalt, Modernität und die Macht der Kindheit, in der Konstruktion von Stereotypen verwendet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der deutschen Wiedervereinigung, Stereotypen, Identitätsbildung, Medien und die Konstruktion des "Anderen". Die Analyse bezieht sich auf wichtige Konzepte wie die ethnographische Tradition, den Diskurs über den Anderen und die Rolle der Medien in der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Welche Stereotypen existieren über Ostdeutsche?
Ostdeutsche werden oft durch Kategorien wie mangelnde Modernität (Rückständigkeit), Gewaltbereitschaft oder eine durch das DDR-System geprägte „pathologische“ Kindheit stigmatisiert.
Wie dienen diese Stereotypen der westdeutschen Identitätsbildung?
Indem das „Ostdeutsche“ als das Fremde und Andere markiert wird, können sich westdeutsche Normen und Werte als überlegener Standard und Identifikationspunkt festigen.
Welche Rolle spielen die Medien bei der „Ostalgie“?
Medien stilisieren Ostdeutsche oft als „Exoten“. Dies fördert zwar ein Gemeinschaftsgefühl im Osten, dient aber primär der Bestätigung westdeutscher Normalität.
Was ist die „Macht der Kindheit“ in diesem Diskurs?
Die Arbeit analysiert, wie die Kindheit in der DDR oft als defizitär dargestellt wird, um heutige Verhaltensweisen von Ostdeutschen als Ergebnis einer Fehlentwicklung zu erklären.
Warum bleiben westdeutsche Werte oft unhinterfragt?
Aufgrund der Dominanz westdeutscher Journalisten werden westliche Werte als universell und unabänderlich vorausgesetzt, während nur die „Abweichungen“ des Ostens kommentiert werden.
- Citation du texte
- Christiane Reichart-Burikukiye (Auteur), 1998, Gewalt, Modernität und Pathologie. Stereotypen über Ostdeutsche im Prozess westdeutscher Identitätsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22849