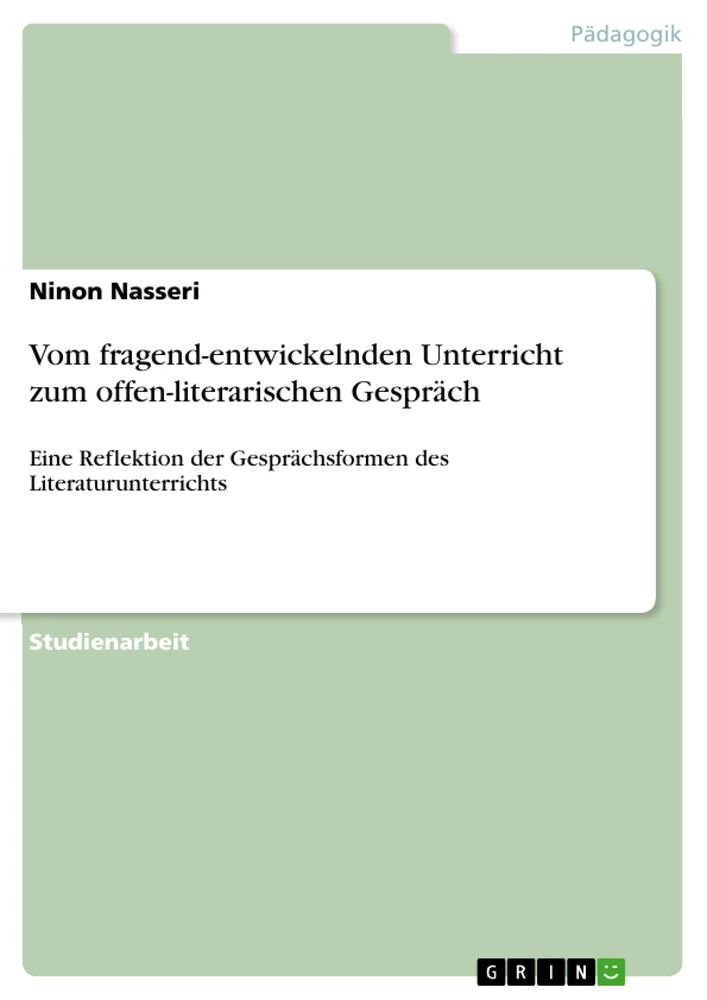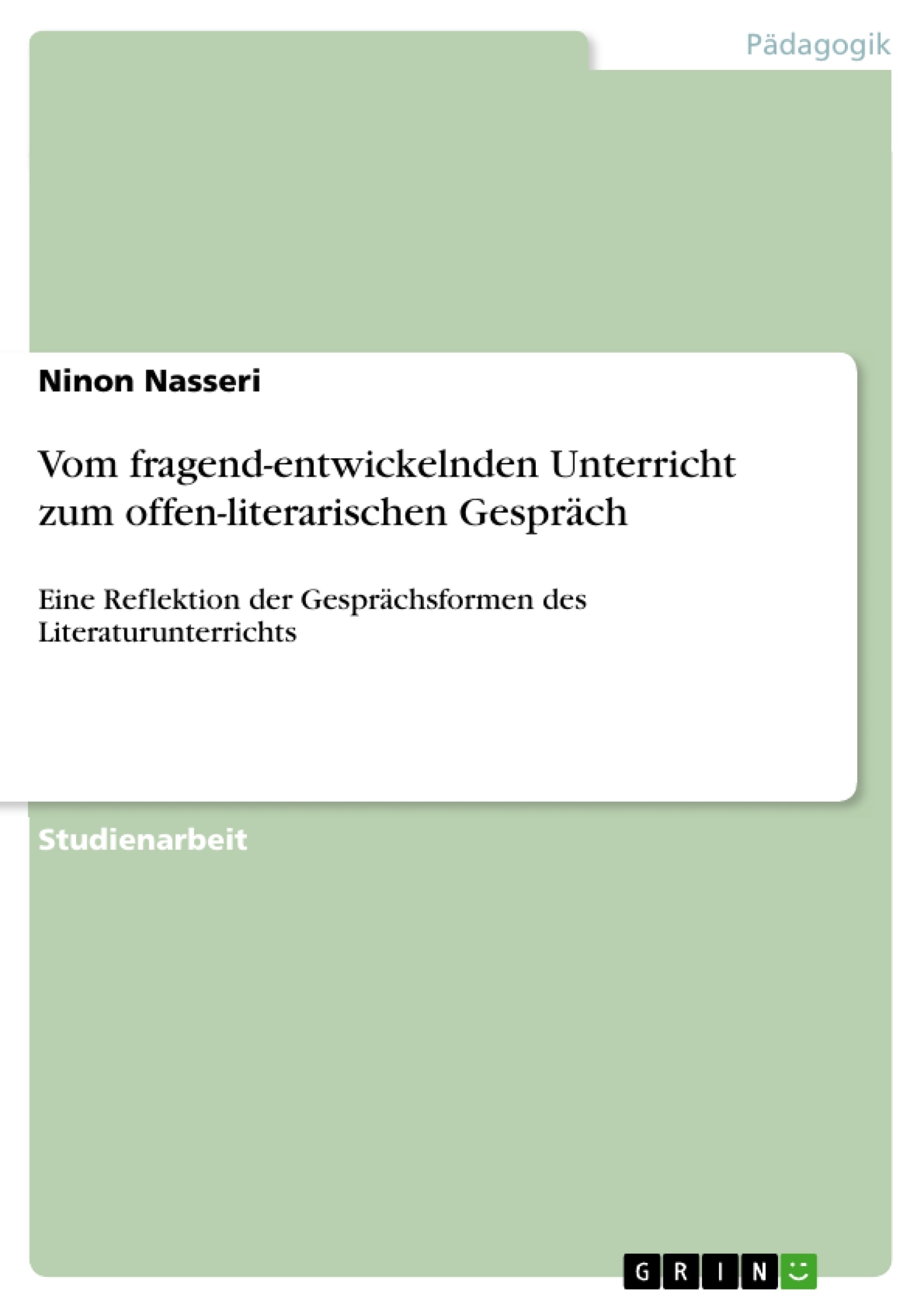Spätestens seit den 1980er Jahren herrscht innerhalb der Literaturdidaktik ein lebhafter Austausch darüber, wie man bei Schülerinnen und Schülern die Freude am Lesen wecken, ihnen den Wert von Literatur vermitteln und diese erkenntnisreich analysieren kann. Im Zuge dieser Diskussionen sind verschiedene didaktische Ansätze entstanden, die in dieser Arbeit behandelt werden.
Die übergeordnete Fragestellung lautet dabei, ob es eine Methode gibt, die sich für den Literaturunterricht am besten eignet. Dafür werden unterschiedliche Ansätze erörtert, miteinander verglichen und kritisch reflektiert.
Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Abbildung der historischen Entwicklung des Literaturunterrichts in Deutschland, dann wird der Verlauf vom fragend-entwickelnden über den handlungs- und produktionsorientierten Unterricht zum offen-literarischen Gespräch und dem Konzept des Heidelberger Modells nachvollzogen. Da all diese Unterrichtsformen stark von den Tätigkeiten der Lehrperson abhängen, wird in einem Unterkapitel die Klassifikation von Lehrimpulsen nach Hartmut Thiele behandelt, bevor es zu einer Reflektion der Gesprächsarten und schließlich einem Fazit kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung des Literaturunterrichts in Deutschland
- Gesprächsformen des Literaturunterrichts
- Das fragend-entwickelnde Gespräch im Literaturunterricht
- Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht
- Das offen-literarische Unterrichtsgespräch und das Heidelberger Modell
- Klassifikation der Lehrtätigkeiten bei literarischen Unterrichtsgesprächen nach Thiele
- Kritische Reflektion der Methoden des Literaturunterrichts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene didaktische Ansätze im Literaturunterricht und evaluiert deren Eignung. Sie verfolgt die Entwicklung von traditionellen Methoden bis hin zu modernen Gesprächsformen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich und der kritischen Reflexion dieser Ansätze.
- Historische Entwicklung des Literaturunterrichts in Deutschland
- Vergleich verschiedener Gesprächsformen im Literaturunterricht
- Kritisches Hinterfragen der Wirksamkeit verschiedener Methoden
- Die Rolle des Lehrers in verschiedenen Unterrichtsmodellen
- Prinzipien erfolgreichen Literaturunterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Suche nach der optimalsten Methode im Literaturunterricht. Sie skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der die historische Entwicklung des Literaturunterrichts nachzeichnet und verschiedene didaktische Ansätze erörtert, vergleicht und kritisch reflektiert. Die Einleitung benennt die übergeordnete Forschungsfrage nach der effektivsten Methode und kündigt die schrittweise Analyse verschiedener Ansätze an, beginnend mit einem historischen Überblick und endend mit einer kritischen Reflexion und einem Fazit.
Historische Entwicklung des Literaturunterrichts in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Literaturunterrichts von der klassischen Rhetorik bis zu modernen rezeptionstheoretischen Ansätzen. Es beschreibt die Etablierung eines national-literarischen Kanons im 19. Jahrhundert, den nationalistischen Missbrauch im Dritten Reich und die Umorientierung nach 1945 hin zu einer Öffnung für moderne Werke. Die "rezeptionstheoretische Wende" in den 1970er Jahren und die daraus resultierenden handlungs- und produktionsorientierten Unterrichtsformen sowie die offen-literarischen Gespräche werden als Meilensteine der Entwicklung herausgestellt. Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Wilhelm von Humboldt und Robert H. Hiecke auf die Entwicklung wird hervorgehoben, ebenso wie die zunehmende Bedeutung empirischer Forschung zur Überprüfung der didaktischen Ansätze. Das Kapitel zeichnet einen umfassenden historischen Bogen und demonstriert die Wandlung des Literaturunterrichts von einem eher textzentrierten hin zu einem rezipientenorientierten Ansatz.
Gesprächsformen des Literaturunterrichts: Dieses Kapitel differenziert zwischen Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Gesprächen im Literaturunterricht. Es analysiert die Struktur von Lehrer-Schüler-Gesprächen, die durch Anrede und Erwiderung gekennzeichnet sind und eine unterschiedlich starke Lenkung durch die Lehrkraft aufweisen. Der Fokus liegt dabei auf der gemeinsamen Bearbeitung einer Fragestellung durch gegenseitige Stimuli und dem dialogischen Charakter des Austauschs. Im Gegensatz dazu werden Schüler-Schüler-Gespräche als symmetrische Kommunikationssituationen beschrieben, in denen der Lehrer primär eine korrigierende Rolle einnimmt. Die Kapitel liefert eine systematische Klassifizierung verschiedener Gesprächsformen und hebt deren spezifische Merkmale und Ziele hervor. Es bildet die Grundlage für den späteren Vergleich und die kritische Reflexion der unterschiedlichen Ansätze.
Schlüsselwörter
Literaturunterricht, Didaktik, Gesprächsformen, fragend-entwickelnder Unterricht, handlungs- und produktionsorientierter Unterricht, offen-literarisches Gespräch, Heidelberger Modell, Rezeptionstheorie, empirische Forschung, Interpretationsansätze, Lehrimpulse, Textverstehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Didaktische Ansätze im Literaturunterricht
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Texts?
Der Text befasst sich umfassend mit verschiedenen didaktischen Ansätzen im Literaturunterricht. Er untersucht deren historische Entwicklung, vergleicht unterschiedliche Gesprächsformen und reflektiert deren Wirksamkeit kritisch.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung des Literaturunterrichts in Deutschland, verschiedene Gesprächsformen (fragend-entwickelnd, handlungs- und produktionsorientiert, offen-literarisch, Heidelberger Modell), die kritische Reflexion dieser Methoden, die Rolle des Lehrers und Prinzipien erfolgreichen Literaturunterrichts.
Welche Gesprächsformen im Literaturunterricht werden im Detail analysiert?
Der Text analysiert detailliert Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Gespräche, unterscheidet verschiedene Arten von Lehrer-Schüler-Gesprächen hinsichtlich der Lenkung durch den Lehrer und beschreibt Schüler-Schüler-Gespräche als symmetrische Kommunikationssituationen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem fragend-entwickelnden Gespräch, dem handlungs- und produktionsorientierten Unterricht und dem offen-literarischen Unterrichtsgespräch inklusive des Heidelberger Modells.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Einleitung, Kapitel zur historischen Entwicklung, Kapitel zu Gesprächsformen, Kapitel zur kritischen Reflexion und Fazit gegliedert. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche historischen Entwicklungen im Literaturunterricht werden dargestellt?
Der Text beschreibt die Entwicklung vom traditionellen, textzentrierten Literaturunterricht über die Etablierung eines national-literarischen Kanons im 19. Jahrhundert und den nationalistischen Missbrauch im Dritten Reich bis hin zur rezeptionstheoretischen Wende in den 1970er Jahren und der damit verbundenen Entwicklung handlungs- und produktionsorientierter Ansätze und offen-literarischen Gesprächen. Der Einfluss von Persönlichkeiten wie Wilhelm von Humboldt und Robert H. Hiecke wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des Texts relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Literaturunterricht, Didaktik, Gesprächsformen, fragend-entwickelnder Unterricht, handlungs- und produktionsorientierter Unterricht, offen-literarisches Gespräch, Heidelberger Modell, Rezeptionstheorie, empirische Forschung, Interpretationsansätze, Lehrimpulse und Textverstehen.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt des Texts?
Die zentrale Fragestellung ist die Suche nach der optimalsten Methode im Literaturunterricht. Der Text versucht, verschiedene didaktische Ansätze zu evaluieren und deren Eignung zu überprüfen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text zieht keine expliziten Schlussfolgerungen, sondern liefert eine umfassende Analyse verschiedener didaktischer Ansätze und deren Entwicklung. Das Fazit fasst die Ergebnisse der kritischen Reflexion zusammen und bietet eine Gesamtperspektive auf die diskutierten Methoden. Eine abschließende Bewertung der "optimalsten Methode" wird nicht explizit vorgenommen.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit Didaktik des Literaturunterrichts auseinandersetzen, z.B. Lehramtsstudierende, Lehrkräfte und Wissenschaftler im Bereich der Literaturdidaktik.
- Quote paper
- Ninon Nasseri (Author), 2012, Vom fragend-entwickelnden Unterricht zum offen-literarischen Gespräch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215367