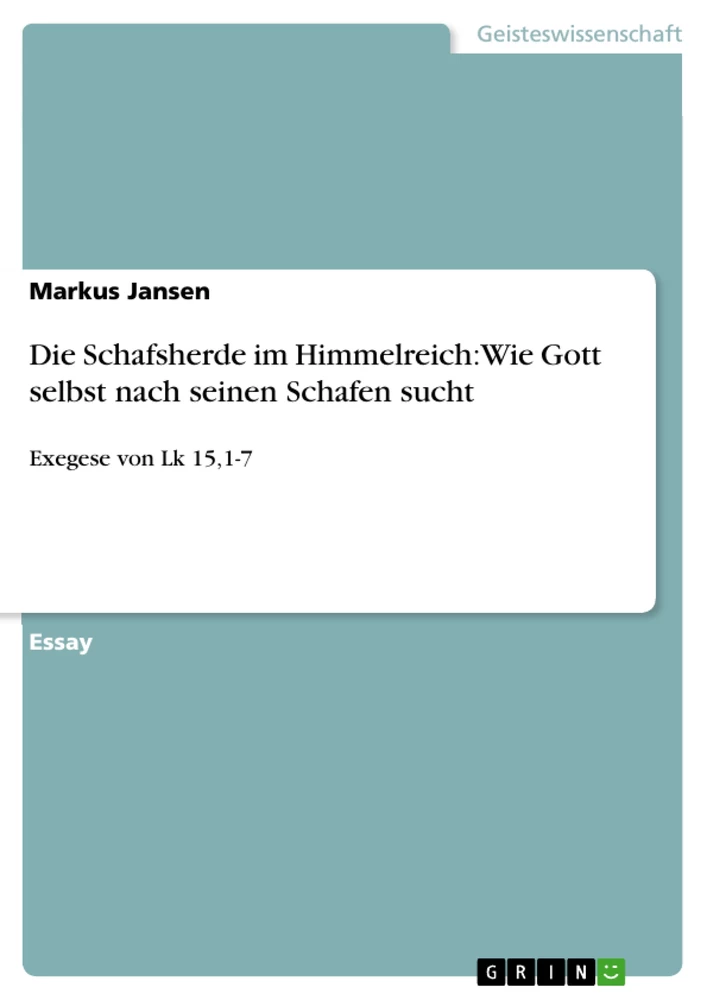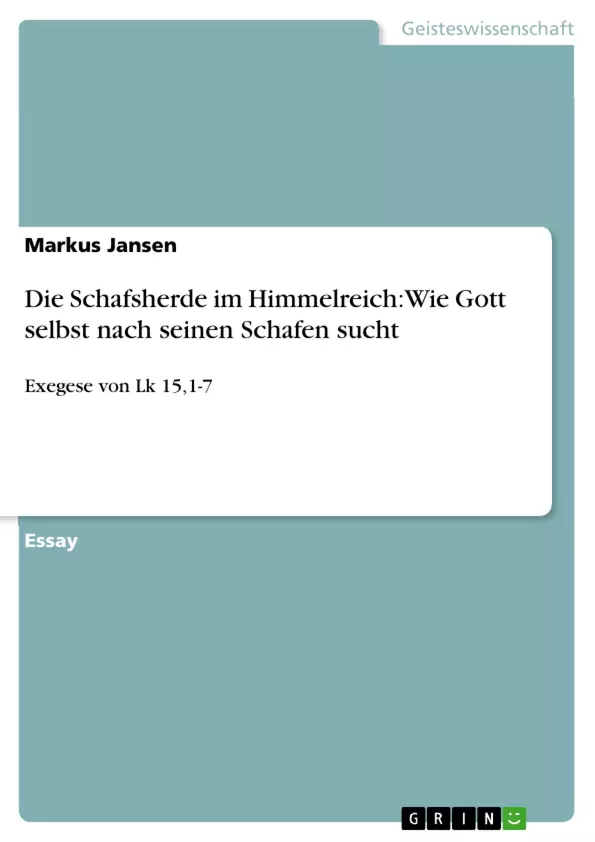Das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15,1-7) bildet mit den bei Lukas anschließenden Gleichnissen von der verlorenen Drachme (Lk 15,8-10) sowie dem Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) eine in sich geschlossene Reihe von Gleichnissen, welche sich mit dem Verlieren und dem Finden beschäftigt. Diese Gleichnisse gehören zu den bekanntesten des neuen Testaments. Insgesamt bilden sie im Lukasevangelium eine umfassende Reihe von Gleichnissen zur neuen Ordnung im Himmelreich und sind dem Wirken und den Lehren Jesu auf seinem Weg von Galiläa nach Jerusalem zuzuordnen.
Ausgangspunkt für das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist die Empörung der Pharisäer und Schriftgelehrten über den Umstand, dass sich Jesus mit Sündern und Zöllnern umgibt und mit ihnen isst. Jesus erzählt dann das Gleichnis, in welchem ein Mensch eine Herde von 100 Schafen hütet und ein Schaf von diesen 100 verloren geht. Der Hirte lässt daraufhin die übrigen 99 Schafe zurück um das verlorene Schaf zu suchen und, sobald er es gefunden hat, das Schaf auf seine Schultern zu nehmen, um es nach Hause zu tragen. Dort ruft er all seine Freunde und Nachbarn zusammen, damit sich diese mit ihm freuen können. Im Anschluss an das Gleichnis deutet Jesus selber das Gleichnis und sagt, dass die Freude im Himmel über jeden umgekehrten Sünder größer ist als über 99 Gerechte, die eine Umkehr nicht nötig haben.
In dieser Arbeit wird das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Evangelium nach Lukas näher betrachtet und dabei insbesondere der Frage nach der Möglichkeit zur Buße und zur Umkehr nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ausgangspunkt für das Gleichnis vom verlorenen Schaf
- 2. Provokation der Gelehrten und Pharisäer
- 3. Das Motiv des guten Hirten
- 4. Freude und Mitfreude über Vergebung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukas Evangelium. Der Fokus liegt auf der Deutung des Gleichnisses im Kontext der damaligen religiösen und gesellschaftlichen Verhältnisse und dessen Aktualität für die heutige Zeit. Die Analyse beleuchtet die theologischen Implikationen und die Bedeutung von Buße und Umkehr.
- Die Reaktion Jesu auf die Kritik der Pharisäer und Schriftgelehrten
- Das Bild Gottes als guter Hirte und dessen Bedeutung im Alten und Neuen Testament
- Die Frage nach der Buße und Umkehr im Kontext des Gleichnisses
- Der Vergleich der Darstellungen des Gleichnisses in den Evangelien nach Lukas und Matthäus
- Die Rolle von Freude und Mitfreude in der Vergebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangspunkt für das Gleichnis vom verlorenen Schaf: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext des Gleichnisses, beginnend mit der Empörung der Pharisäer und Schriftgelehrten über Jesu Umgang mit Sündern. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf wird eingeführt, in dem ein Hirte ein Schaf aus seiner Herde von 100 Schafen sucht und es nach dem Auffinden freudig nach Hause bringt. Jesus deutet das Gleichnis und betont die Freude im Himmel über einen reuige Sünder. Das Kapitel kündigt die detaillierte Analyse des Gleichnisses vom verlorenen Schaf an und erwähnt die eingeschränkte Betrachtung anderer Texte wie Matthäus und das Thomasevangelium aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit. Es wird die zentrale Frage nach Buße und Umkehr und deren Bedeutung im Kontext des Kreuzestodes Jesu angesprochen und die Absicht erläutert, die gängige Interpretation des alleinigen Glaubens an Jesus Christus für den Einzug ins Himmelreich zu überprüfen und die Aktualität des Gleichnisses für die heutige Kirche zu unterstreichen. Die verschiedenen Versionen des Gleichnisses bei Matthäus und Lukas werden kurz angesprochen, wobei die grundlegende Struktur, jedoch unterschiedliche Schwerpunkte und Deutungsmöglichkeiten betont werden.
2. Provokation der Gelehrten und Pharisäer: Dieses Kapitel analysiert die rhetorische Strategie Jesu im Gleichnis. Durch die direkte Ansprache der Schriftgelehrten und Pharisäer ("Wenn einer von euch hundert Schafe hat...") provoziert Jesus seine Kritiker, die ihm einen unangemessenen Umgang mit Sündern vorwerfen. Die Formulierung dient gleichzeitig dazu, jeden Menschen anzusprechen und die Identifikation mit dem Hirten zu erleichtern. Das Handeln des Hirten, der 99 Schafe zurücklässt, um ein einziges zu suchen, wird als Bruch mit konventionellen Verhaltensregeln und als ökonomisch nicht rational interpretiert. Der Verzicht auf Eigentum und die Identifikation mit einem einfachen Hirten werden als Provokationen gegen die Gelehrten dargestellt, die Hirten als ungebildet und ohne religiöse Kenntnisse ansahen. Die Erhebung des Hirten zu einer gottgleichen Figur stellt eine weitere Herausforderung für die Schriftgelehrten und Pharisäer dar.
3. Das Motiv des guten Hirten: In diesem Kapitel wird das Motiv des guten Hirten als zentrales Bild für Gott im Gleichnis herausgestellt. Der Bezug zu künstlerischen und musikalischen Verarbeitungen, sowie zu entsprechenden Bildern im Alten Testament (Psalm 23) wird hergestellt. Das Gleichnis bietet eine radikale Neuerung des bekannten Bildes Gottes als Hirte, indem die Gottes suche nach verlorenen Menschen und seine Bereitschaft zu Vergebung betont wird. Im Gegensatz dazu steht die Ablehnung von Sündern durch die Pharisäer, die eher Bestrafung als Umkehr erwarten. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der gegenseitigen Vergebung und den Anspruch, selbst zum Hirten zu werden, der sich zwischen dem Festhalten an der Herde und der Suche nach dem Verlorenen entscheiden muss.
4. Freude und Mitfreude über Vergebung: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Unterschieden in der Darstellung der Freude im Gleichnis bei Matthäus und Lukas. Matthäus betont die überschwängliche Freude über das Auffinden des verlorenen Schafes und dessen Bedeutung für den göttlichen Willen. Lukas hebt die Mitfreude hervor, indem der Hirte seine Freunde und Nachbarn zur gemeinsamen Freude einlädt. Obwohl der Grund der Freude in beiden Versionen die Umkehr eines Sünders ist, wird die Freude unterschiedlich dargestellt. Matthäus betont die Vorbildfunktion und die Bedeutung der Gemeinde für die Wiederaufnahme abtrünniger Mitglieder, Lukas betont die Freude über den geretteten Sünder. Das Kapitel verdeutlicht den gemeinsamen Nenner: Gottes Willen, auch Sündern zu vergeben und nach ihnen zu suchen. Die Unsicherheit des Erfolgs der Suche wird herausgestellt, da beide Evangelien offenlassen, ob das Schaf tatsächlich gefunden wird. Der Weg zur Rückkehr zu Gott wird als abhängig vom Willen des Menschen zum Finden lassen und zur Umkehr beschrieben.
Schlüsselwörter
Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukas-Evangelium, Buße, Umkehr, Vergebung, guter Hirte, Pharisäer, Schriftgelehrte, Gott, Himmelreich, Matthäus-Evangelium, Theologie, Interpretation, Aktualität, Mitfreude, Provokation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gleichnis vom verlorenen Schaf
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus dem Lukas-Evangelium. Der Fokus liegt auf der Interpretation des Gleichnisses im Kontext der damaligen religiösen und gesellschaftlichen Verhältnisse und seiner Bedeutung für die heutige Zeit. Die Analyse beleuchtet die theologischen Implikationen und die Bedeutung von Buße und Umkehr.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Ausgangspunkt für das Gleichnis vom verlorenen Schaf; 2. Provokation der Gelehrten und Pharisäer; 3. Das Motiv des guten Hirten; 4. Freude und Mitfreude über Vergebung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse eines Aspekts des Gleichnisses.
Wie wird der Kontext des Gleichnisses dargestellt?
Kapitel 1 beschreibt den Kontext, der durch die Empörung der Pharisäer und Schriftgelehrten über Jesu Umgang mit Sündern geprägt ist. Das Gleichnis selbst wird eingeführt und seine zentrale Aussage, die Freude Gottes über einen reuigen Sünder, hervorgehoben. Es wird auch die begrenzte Betrachtung anderer Evangelien (Matthäus, Thomasevangelium) aufgrund des Umfangs der Arbeit erwähnt.
Welche Rolle spielen die Pharisäer und Schriftgelehrten?
Kapitel 2 analysiert Jesu rhetorische Strategie im Umgang mit den Kritikern. Jesus provoziert sie durch die direkte Ansprache und stellt deren konventionelle Verhaltensregeln und ihre Sichtweise auf Hirten und Sünder in Frage. Das Handeln des Hirten wird als Bruch mit diesen Konventionen interpretiert.
Welche Bedeutung hat das Motiv des guten Hirten?
Kapitel 3 konzentriert sich auf das zentrale Bild des guten Hirten als Darstellung Gottes. Der Bezug zu alttestamentarischen Bildern und künstlerischen Interpretationen wird hergestellt. Die radikale Neuerung des Bildes Gottes durch das Gleichnis, die Betonung der Gottes suche nach verlorenen Menschen und seine Bereitschaft zur Vergebung, wird hervorgehoben.
Wie wird die Freude und Mitfreude über Vergebung behandelt?
Kapitel 4 vergleicht die Darstellung der Freude im Gleichnis bei Matthäus und Lukas. Matthäus betont die überschwängliche Freude, während Lukas die Mitfreude und die Einladung zu gemeinsamer Freude hervorhebt. Obwohl der Grund der Freude – die Umkehr eines Sünders – gleich ist, wird die Freude unterschiedlich dargestellt. Die Unsicherheit des Erfolgs der Suche wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die Arbeit behandelt Schlüsselwörter wie Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukas-Evangelium, Buße, Umkehr, Vergebung, guter Hirte, Pharisäer, Schriftgelehrte, Gott, Himmelreich, Matthäus-Evangelium, Theologie, Interpretation, Aktualität, Mitfreude und Provokation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Schaf, um dessen Bedeutung im Kontext der damaligen und heutigen Zeit zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Deutung des Gleichnisses, den theologischen Implikationen und der Bedeutung von Buße und Umkehr.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Fragen zur Reaktion Jesu auf die Kritik der Pharisäer, der Bedeutung des Bildes Gottes als guter Hirte, der Buße und Umkehr im Kontext des Gleichnisses, dem Vergleich der Darstellungen in den Evangelien nach Lukas und Matthäus und der Rolle von Freude und Mitfreude in der Vergebung.
- Citar trabajo
- Markus Jansen (Autor), 2012, Die Schafsherde im Himmelreich: Wie Gott selbst nach seinen Schafen sucht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214562