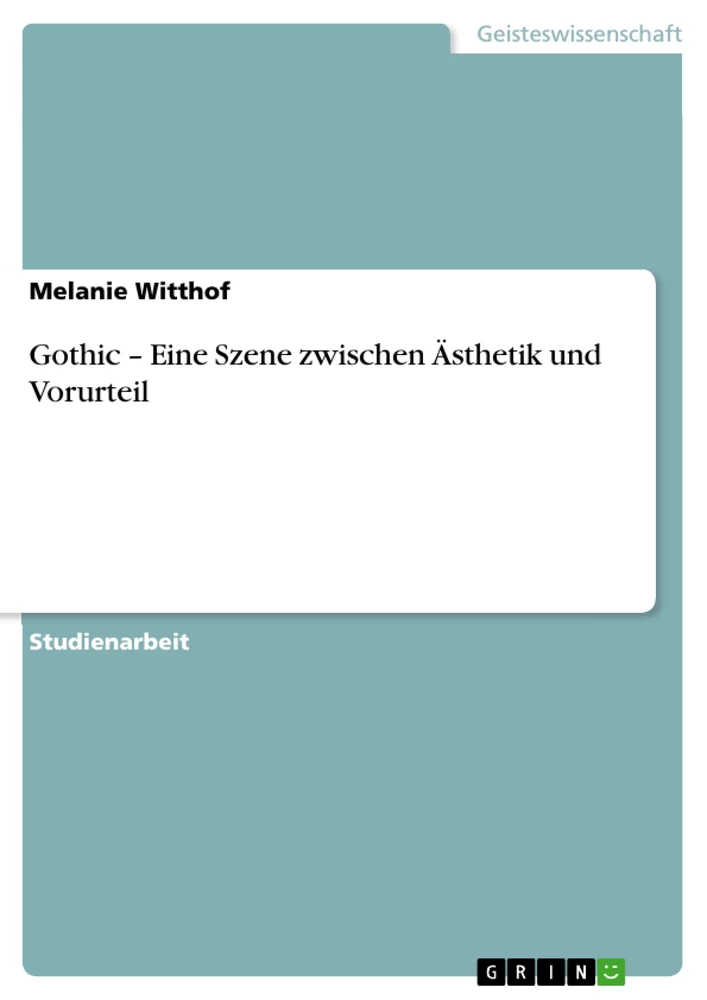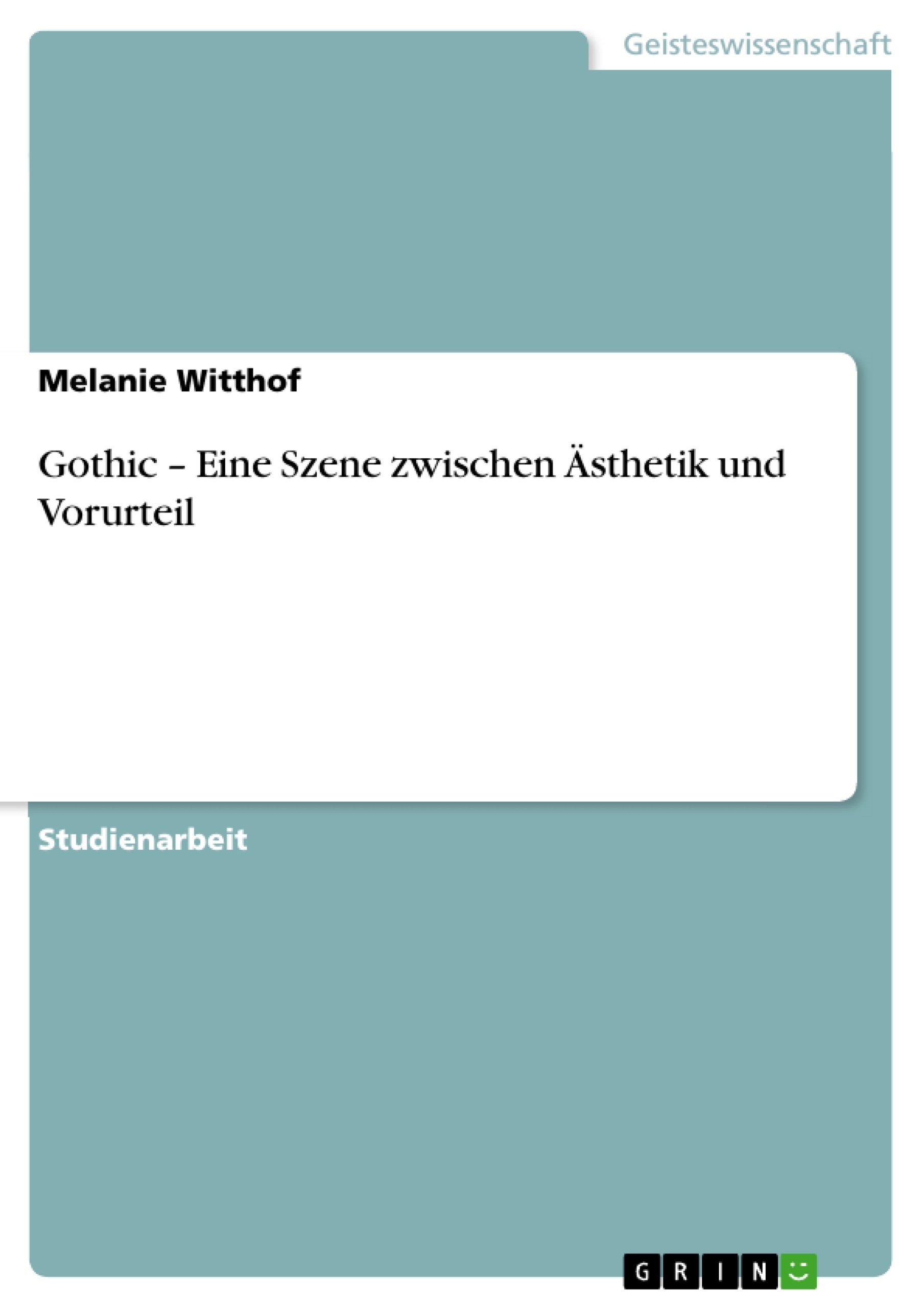Die Gothic - Szene ist alles andere als homogen, dennoch erkennt der Außenstehende ihre Mitglieder sofort: In schwarzen Mänteln, Kleidern und Schuhen, mit schwarzgefärbten Haaren und oftmals bleich geschminkt, inszenieren die Anhänger sich selbst und ihr vermeintlich pessimistisches Lebensgefühl. Doch wer sind diese Gothics, Schwarze oder Grufties? Was verbirgt sich hinter ihrer schwarzen Kluft? Wie ist ihre Weltanschauung? Haben sie tatsächlich etwas mit Satanismus zu tun? Und was steckt hinter dem Vorwurf, die Szene würde neuerdings rechte Tendenzen aufweisen? Auf all diese Fragen können im Rahmen dieser Arbeit selbstverständlich keine allumfassenden und klärenden Antworten gegeben werden. Dennoch möchte ich sie als „roten Faden“ nutzen, um einen pointierten Einblick in die Szene zu geben und vor allem zu klären, warum diese Szene vermutlich wie keine Zweite mit so vielen Vorurteilen behaftet ist. Diese Arbeit baut auf den Inhalten des Referates vom 05.01.2012 auf und soll diese noch vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
- Gothic - Eine Szene zwischen Ästhetik und Vorurteil
- Wer sind die Gothics?
- Schwarz als Farbe
- Farbe bekennen
- Das schwarze Styling und die Provokation
- Gothics und Satanismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gothic-Szene in Deutschland, beleuchtet ihre Vielschichtigkeit und räumt mit gängigen Vorurteilen auf. Sie untersucht die Bedeutung von Symbolen, insbesondere der Farbe Schwarz, und deren Rolle in der Selbstinszenierung der Szene. Die Arbeit basiert auf einem vorherigen Referat und vertieft dessen Inhalte.
- Die Vielschichtigkeit und Heterogenität der Gothic-Szene
- Die symbolische Bedeutung der Farbe Schwarz in der Gothic-Szene und im gesellschaftlichen Kontext
- Die Ambivalenz der Selbstinszenierung der Gothics und die Rolle der Provokation
- Die Verbindung zwischen der Gothic-Szene und dem Vorurteil des Satanismus
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung der Gothic-Szene
Zusammenfassung der Kapitel
Gothic - Eine Szene zwischen Ästhetik und Vorurteil: Diese Einleitung beschreibt die Gothic-Szene als heterogen, aber durch ihre schwarze Kleidung und Ästhetik leicht erkennbar. Sie stellt zentrale Fragen nach der Identität der Gothics, ihrer Weltanschauung und den Vorurteilen, die sie umgeben, und kündigt an, diese Fragen im Verlauf der Arbeit zu untersuchen. Die Arbeit zielt darauf ab, einen pointierten Einblick in die Szene zu geben und zu klären, warum sie mit so vielen Vorurteilen behaftet ist.
Wer sind die Gothics?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, die Gothic-Szene eindeutig zu definieren. Es beschreibt ihren Ursprung in England als entpolitisierte Antwort auf den Punk und ihre Entwicklung in den 1990er Jahren, die zu einer Öffnung für verschiedene Musikrichtungen und Subkulturen führte. Die hohe Vielschichtigkeit der Szene wird hervorgehoben, wobei das verbindende Element die Farbe Schwarz ist.
Schwarz als Farbe: Dieses Kapitel analysiert die symbolische Bedeutung der Farbe Schwarz in der Gesellschaft. Es wird die negative Konnotation von Schwarz im christlichen und wissenschaftlichen Verständnis, im Gegensatz zur positiven Konnotation von Weiß, herausgestellt. Es wird gezeigt, wie Farben im sozio-kulturellen Kontext Bedeutung erlangen und Schwarz im Laufe der Zeit unterschiedliche symbolische Bedeutungen, wie Trauer, Armut und Opposition, angenommen hat.
Farbe bekennen: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Tragens von Schwarz in der Gothic-Szene. Es wird argumentiert, dass die schwarze Kleidung ein düsteres Lebensgefühl, Melancholie, und eine Kritik an der Oberflächlichkeit der Gesellschaft ausdrückt. Die Inszenierung der traurigen Seiten der menschlichen Existenz und die Ablehnung etablierter Werte werden als zentrale Motive genannt.
Das schwarze Styling und die Provokation: Dieses Kapitel diskutiert die Ambivalenz des Stylings innerhalb der Gothic-Szene. Es wird der Unterschied zwischen „Modegrufties“ und „ernsthaften“ Grufties thematisiert, sowie die strengen optischen Kriterien für die Zugehörigkeit zur Szene. Die Problematik wird angesprochen, dass die Ablehnung von Oberflächlichkeit mit einem strengen Dresscode kollidiert. Das schwarze Styling dient auch der Provokation, insbesondere durch das Kokettieren mit dem „Bösen“.
Gothics und Satanismus: Dieses Kapitel behandelt das weit verbreitete Vorurteil, die Gothic-Szene stehe im Zusammenhang mit Satanismus. Es wird erklärt, wie das Klischee des Gothics und das stereotype Bild von Satanismus aufeinandertreffen und die Angst vor Kriminalität und Gewalttätigkeit schüren. Die Ambivalenz der Szene, die gleichzeitig Tiefe und Provokation ausdrücken will, wird analysiert.
Schlüsselwörter
Gothic-Szene, Subkultur, Schwarz, Symbolismus, Selbstinszenierung, Provokation, Vorurteile, Satanismus, Identität, Jugendkultur, Ästhetik, Melancholie, Opposition, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Gothic - Eine Szene zwischen Ästhetik und Vorurteil"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die deutsche Gothic-Szene, untersucht ihre Vielschichtigkeit und widerlegt gängige Vorurteile. Sie beleuchtet die Bedeutung von Symbolen, insbesondere der Farbe Schwarz, und deren Rolle in der Selbstinszenierung der Szene. Die Arbeit basiert auf einem vorherigen Referat und vertieft dessen Inhalte, indem sie verschiedene Aspekte der Szene detailliert untersucht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Heterogenität der Gothic-Szene, die symbolische Bedeutung von Schwarz im gesellschaftlichen Kontext und innerhalb der Szene, die Ambivalenz der Selbstinszenierung und die Rolle der Provokation, die Verbindung zwischen der Gothic-Szene und dem Vorurteil des Satanismus, sowie die gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung der Szene.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Eine Einführung in die Gothic-Szene, eine Auseinandersetzung mit der Definition von "Gothics", eine Analyse der symbolischen Bedeutung der Farbe Schwarz, die Rolle von Schwarz im Gothic-Styling, die Ambivalenz des schwarzen Stylings und die damit verbundene Provokation, und schließlich die Verbindung zwischen der Gothic-Szene und dem Vorurteil des Satanismus.
Was ist das zentrale Argument der Arbeit?
Die Arbeit argumentiert, dass die Gothic-Szene komplex und vielschichtig ist und nicht durch einfache Klischees und Vorurteile erfasst werden kann. Sie betont die Bedeutung der Selbstinszenierung und der symbolischen Verwendung von Schwarz als Ausdruck eines spezifischen Lebensgefühls, das sich von der Mainstream-Gesellschaft abgrenzt. Sie räumt mit dem Vorurteil auf, Gothics seien automatisch satanisch.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Arbeit enthält die Kapitel: "Gothic - Eine Szene zwischen Ästhetik und Vorurteil" (Einleitung), "Wer sind die Gothics?" (Definition und Geschichte), "Schwarz als Farbe" (symbolische Bedeutung), "Farbe bekennen" (Schwarz im Gothic-Kontext), "Das schwarze Styling und die Provokation" (Ambivalenz des Stylings), und "Gothics und Satanismus" (Aufarbeitung von Vorurteilen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Gothic-Szene, Subkultur, Schwarz, Symbolismus, Selbstinszenierung, Provokation, Vorurteile, Satanismus, Identität, Jugendkultur, Ästhetik, Melancholie, Opposition, Gesellschaft.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Subkulturen, Jugendkultur, Soziologie, oder die Bedeutung von Symbolen und Ästhetik in der Gesellschaft interessieren. Sie ist besonders hilfreich für diejenigen, die ein tieferes Verständnis der Gothic-Szene erlangen möchten und mit den weit verbreiteten Vorurteilen aufräumen wollen.
- Quote paper
- Melanie Witthof (Author), 2012, Gothic – Eine Szene zwischen Ästhetik und Vorurteil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212899