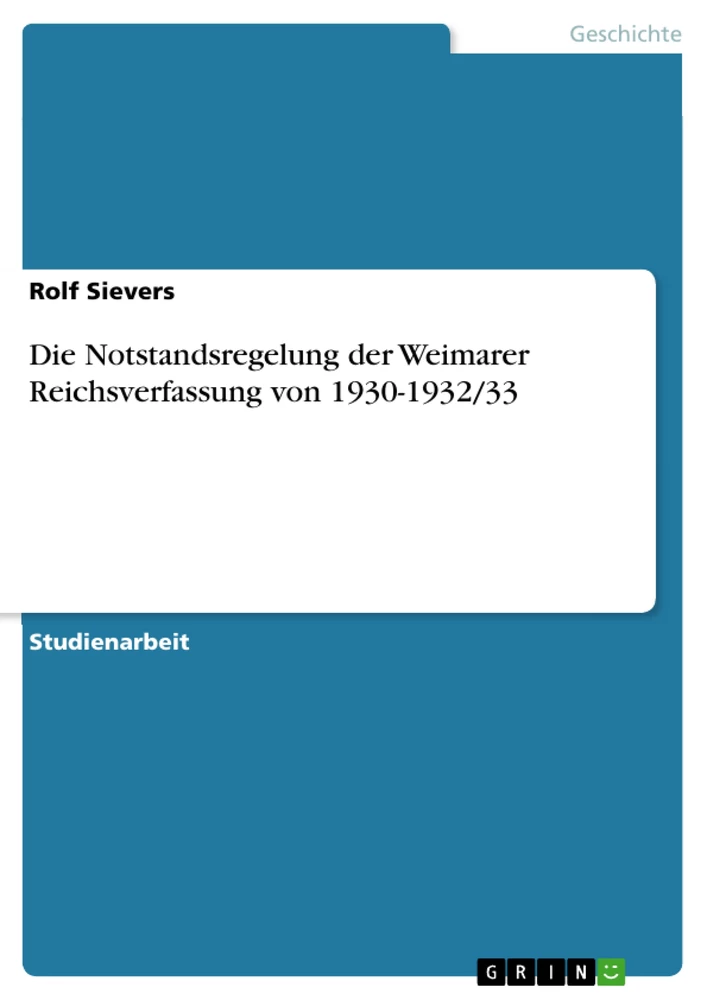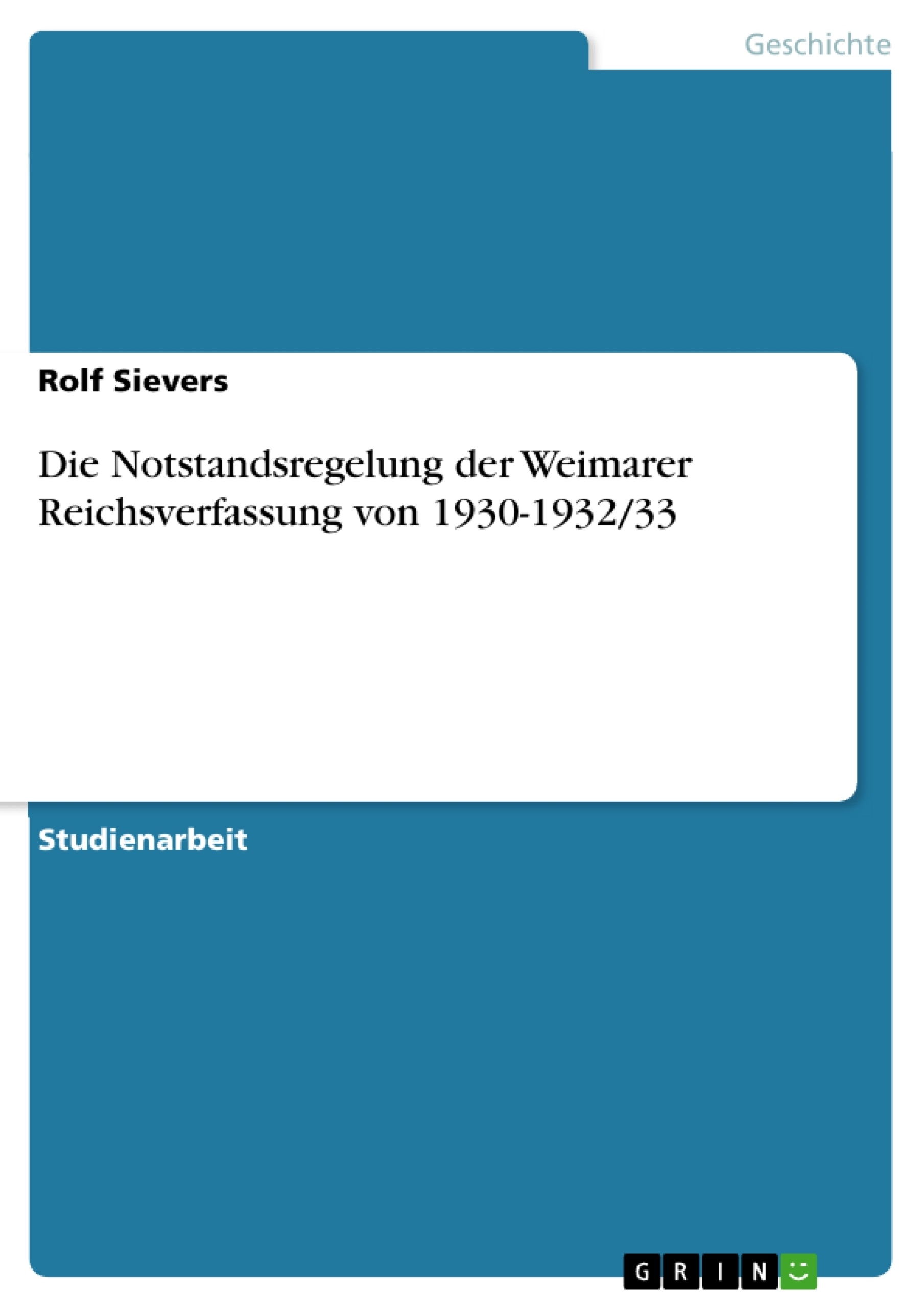Bei aller Kritik lässt sich festhalten, die von Hugo Preuß geschaffene Weimarer Verfassung war besser als ihr Ruf. So fand „der lateinamerikanische Verfassungsgeber das Vorbild für eine liberal-sozialstaatliche Grundordnung in der damals modernsten Verfassung Kontinentaleuropas, der Weimarer Verfassung.“.Es ist daher durchaus Lewinski zuzustimmen, der sie als „Gesellenstück“ auf dem Weg zur parlamentarischen Demokratie bezeichnet hat. Hätte dem Reichspräsidenten in den Anfangsjahren der Republik nicht ein so machtvolles Instrument zur Bewältigung innerer Notstände zur Verfügung gestanden, würde die Weimarer Republik die ersten Jahre nicht überstanden haben. Auch wurde von der Mehrheit der Bevölkerung die Diktaturgewalt des Reichspräsidenten als ungefährlich angesehen. Dies entsprach einem tiefen Wunsch der Bevölkerung nach Wiederherstellung der Ordnung im Reich. Allerdings wurde das parlamentarische System ab 1930 nach dem Zerbrechen der Großen Koalition durch die fast ausschließliche Anwendung der Reserveverfassung des Art. 48 ad absurdum geführt. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren war damit bereits vor Hitler eingestellt worden. Die Hauptursache hierfür lag vornehmlich an der Unfähigkeit der im Reichstag vertretenen Parteien, zu entsprechenden Mehrheiten zu gelangen und damit das "tote Parlament" wieder zum Leben zu erwecken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entstehungsgeschichte der Weimarer Verfassung und der Notstandsregelung nach Artikel 48 WRV
- 2.1 Oktoberverfassung
- 2.2 Verfassungsneuordnung im Zeichen des Umbruchs von 1918/19
- 2.3 Der Reichsbelagerungszustand als Vorläufer des Artikels 48 WRV
- 3 Stellung und Befugnisse des Reichspräsidenten
- 3.1 Der Reichspräsident als Gegengewicht zum Parlament
- 3.2 Umfang der Reservekompetenz - „Diktaturgewalt“ nach Art. 48 II WRV
- 3.3 Einsatz der bewaffneten Macht nach Art. 48 II WRV
- 3.4 Reichsexekution Art. 48 I WRV
- 3.5 Schranken der Diktaturgewalt und parlamentarische Kontrolle
- 3.6 Fehlendes Ausführungsgesetz Art. 48 V WRV
- 3.7 Auflösung des Reichstages Art. 25 WRV
- 4 Weltwirtschaftskrise und Ende der Großen Koalition
- 4.1 Weltwirtschaftskrise
- 4.2 Bruch der Großen Koalition 1930
- 4.3 Präsidialkabinett Brüning
- 4.4 Präsidiale Notverordnungen im Bereich von Wirtschaft und Finanzen
- 4.5 Der Sturz Brünings
- 5 Die Auflösung der Republik und Vorbereitung der Diktatur
- 5.1 Kabinett von Papen 1932
- 5.2 „Staatsstreich in Preußen“ 1932
- 5.3 Richterliche Kontrolle – Urteil des Staatsgerichtshofs
- 5.4 Rücktritt der Regierung Papen - Kabinett Schleicher
- 6 Aushöhlung und Durchbrechung der Weimarer Verfassung
- 6.1 Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 1933
- 6.2 Schubladenverordnung
- 6.3 Reichstagsbrandverordnung
- 7 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Notstandsregelung des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung im Kontext der Jahre 1930 bis 1933. Die Zielsetzung besteht darin, zu analysieren, inwieweit die Anwendung dieses Artikels zum Scheitern der Weimarer Republik beigetragen hat. Dies geschieht anhand der Analyse von Regierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen.
- Die Entstehungsgeschichte des Artikels 48 WRV und seine Vorläufer.
- Die Befugnisse des Reichspräsidenten und die Auslegung des Artikels 48 WRV.
- Der Einfluss der Weltwirtschaftskrise und das Ende der Großen Koalition.
- Die Rolle der Präsidialkabinette und der Notverordnungen.
- Die Aushöhlung der Weimarer Verfassung durch die Anwendung des Artikels 48 WRV.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung. Sie skizziert den Forschungsstand und benennt die zentralen Fragestellungen der Arbeit, die sich auf die Anwendung des Artikels 48 in den Jahren 1930-1933 und dessen Beitrag zum Untergang der Weimarer Republik konzentrieren. Die Einleitung hebt die Notwendigkeit hervor, die Vorgeschichte der Notstandsregelung zu verstehen, um das Handeln der Präsidialkabinette in den historischen Kontext einzuordnen.
2 Entstehungsgeschichte der Weimarer Verfassung und der Notstandsregelung nach Artikel 48 WRV: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Weimarer Verfassung und die Entwicklung der Notstandsregelung im Artikel 48. Es untersucht die Vorläufer des Artikels 48, wie den Reichsbelagerungszustand, und analysiert den Entstehungskontext vor dem Hintergrund des Umbruchs von 1918/19. Die Analyse umfasst die Oktoberverfassung und die damit verbundenen Herausforderungen. Der Fokus liegt auf den politischen und gesellschaftlichen Umständen, die die Formulierung und den Inhalt des Artikels 48 prägten.
3 Stellung und Befugnisse des Reichspräsidenten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Stellung und den Befugnissen des Reichspräsidenten im Kontext des Artikels 48. Es analysiert den Umfang seiner Reservekompetenz, die als "Diktaturgewalt" bezeichnet wird, und untersucht den Einsatz der bewaffneten Macht. Weiterhin werden die Schranken der Diktaturgewalt und die parlamentarische Kontrolle beleuchtet. Das Fehlen eines Ausführungsgesetzes zum Artikel 48 V WRV und die Möglichkeit der Auflösung des Reichstages nach Artikel 25 WRV werden ebenfalls thematisiert. Die Analyse konzentriert sich auf die rechtlichen und politischen Implikationen dieser Befugnisse.
4 Weltwirtschaftskrise und Ende der Großen Koalition: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Weimarer Republik und den Zusammenbruch der Großen Koalition im Jahr 1930. Es analysiert die Entstehung der Präsidialkabinette unter Brüning und die damit einhergehende verstärkte Nutzung von Notverordnungen im Bereich der Wirtschaft und der Finanzen. Die Maßnahmen der Regierung und die Reaktionen des Reichstages, insbesondere der SPD-Fraktion, werden detailliert untersucht. Der Fokus liegt auf dem Wechsel von parlamentarischer zu präsidialer Regierungsführung.
5 Die Auflösung der Republik und Vorbereitung der Diktatur: Dieses Kapitel analysiert die Regierungszeit der Kabinette Papen und Schleicher nach dem Sturz Brünings. Es untersucht den "Preußenschlag" und die darauf folgenden Versuche, die Republik durch autoritäre Maßnahmen umzugestalten. Die Rolle der Justiz und die Urteile des Staatsgerichtshofs werden ebenfalls thematisiert. Das Kapitel beleuchtet die zunehmende Schwächung demokratischer Institutionen und die Vorbereitung des Weges für die nationalsozialistische Diktatur.
Schlüsselwörter
Weimarer Reichsverfassung, Artikel 48 WRV, Notstandsregelung, Reichspräsident, Präsidialkabinette, Weltwirtschaftskrise, Große Koalition, Notverordnungen, Demokratie, Diktatur, Verfassungsbruch, Republik, Hugo Preuß, Reichstag, SPD.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Artikel 48 WRV
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Notstandsregelung des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung im Kontext der Jahre 1930 bis 1933. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, inwieweit die Anwendung dieses Artikels zum Scheitern der Weimarer Republik beigetragen hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte des Artikels 48 WRV und seiner Vorläufer, die Befugnisse des Reichspräsidenten und die Auslegung des Artikels 48 WRV, den Einfluss der Weltwirtschaftskrise und das Ende der Großen Koalition, die Rolle der Präsidialkabinette und der Notverordnungen sowie die Aushöhlung der Weimarer Verfassung durch die Anwendung des Artikels 48 WRV.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Entstehungsgeschichte des Artikels 48 WRV, Stellung und Befugnisse des Reichspräsidenten, Weltwirtschaftskrise und Ende der Großen Koalition, Auflösung der Republik und Vorbereitung der Diktatur, Aushöhlung und Durchbrechung der Weimarer Verfassung und Schluss.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Bedeutung des Artikels 48 WRV, skizziert den Forschungsstand und benennt die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit, die Vorgeschichte der Notstandsregelung zu verstehen.
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung der Weimarer Verfassung und die Entwicklung der Notstandsregelung im Artikel 48. Es untersucht Vorläufer wie den Reichsbelagerungszustand und analysiert den Entstehungskontext im Umbruch von 1918/19. Die Oktoberverfassung und die damit verbundenen Herausforderungen werden ebenfalls thematisiert.
Was wird in Kapitel 3 behandelt?
Kapitel 3 befasst sich mit der Stellung und den Befugnissen des Reichspräsidenten im Kontext des Artikels 48. Es analysiert den Umfang seiner Reservekompetenz ("Diktaturgewalt"), den Einsatz der bewaffneten Macht, die Schranken der Diktaturgewalt und die parlamentarische Kontrolle. Das Fehlen eines Ausführungsgesetzes und die Auflösung des Reichstages werden ebenfalls behandelt.
Was wird in Kapitel 4 behandelt?
Kapitel 4 untersucht die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, den Zusammenbruch der Großen Koalition 1930, die Entstehung der Präsidialkabinette unter Brüning und die verstärkte Nutzung von Notverordnungen. Die Maßnahmen der Regierung und die Reaktionen des Reichstages werden detailliert untersucht.
Was wird in Kapitel 5 behandelt?
Kapitel 5 analysiert die Regierungszeit der Kabinette Papen und Schleicher, den "Preußenschlag" und die Versuche, die Republik autoritär umzugestalten. Die Rolle der Justiz und Urteile des Staatsgerichtshofs werden thematisiert. Das Kapitel beleuchtet die Schwächung demokratischer Institutionen und die Vorbereitung der nationalsozialistischen Diktatur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Weimarer Reichsverfassung, Artikel 48 WRV, Notstandsregelung, Reichspräsident, Präsidialkabinette, Weltwirtschaftskrise, Große Koalition, Notverordnungen, Demokratie, Diktatur, Verfassungsbruch, Republik, Hugo Preuß, Reichstag, SPD.
- Quote paper
- Rolf Sievers (Author), 2011, Die Notstandsregelung der Weimarer Reichsverfassung von 1930-1932/33, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211798