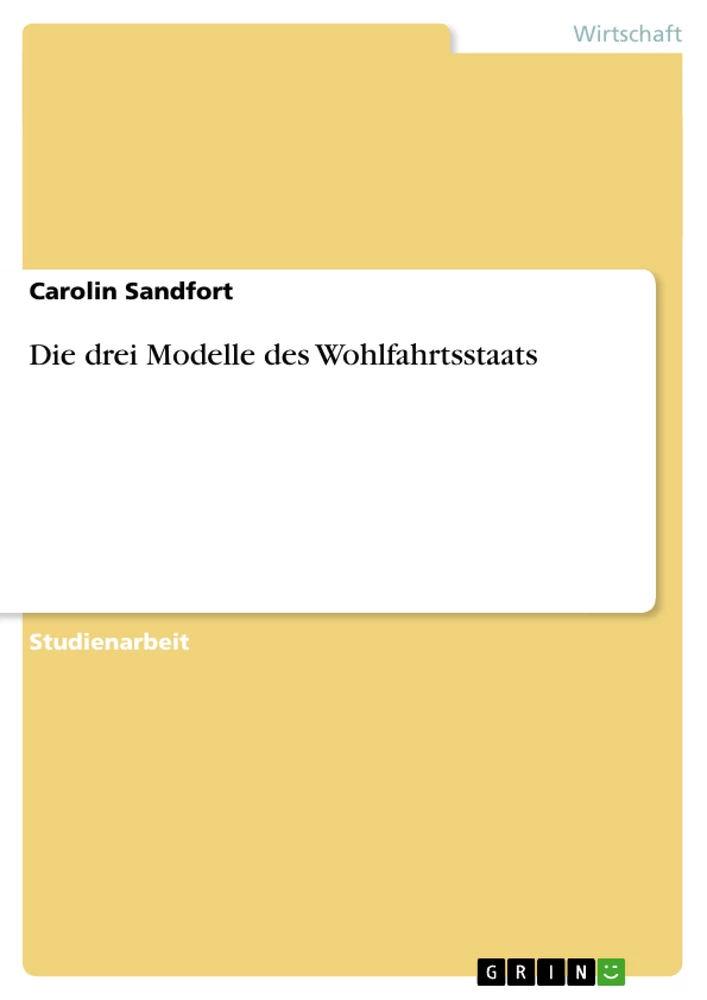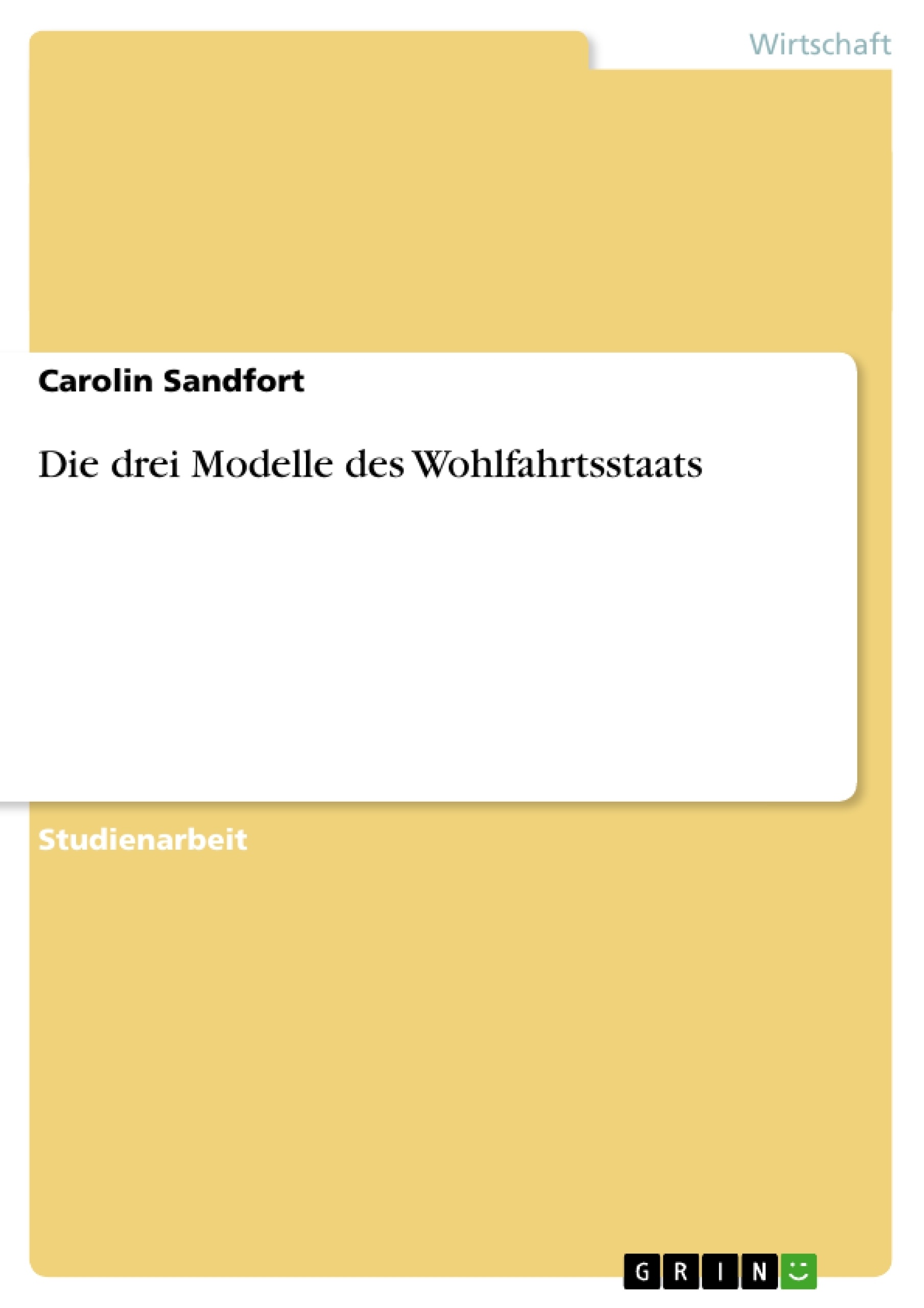Die absehbare demographische Entwicklung wird die Finanzierungs- und damit auch die Abgabenlast künftig wesentlich verschärfen. Seit Mitte der 60er Jahre ist die Geburtenrate drastisch gesunken; die deutsche Bevölkerung schrumpft und beginnt zu überaltern. Was besonders bei der Rentenversicherung zu einer Ausgabenexplosion bei gleichzeitigem Rückgang der Einnahmen führt. Aufgrund dieser Fakten stellt sich die Frage, ob der deutsche Sozialstaat womöglich falsch konzipiert ist, sich somit den aktuellen Entwicklungen nicht anpassen kann und schlussendlich nicht mehr finanzierbar ist. Um diese Frage zu beantworten werden im Folgenden die verschiedenen Modelle des Wohlfahrtsstaats erörtert. Darüber hinaus wird der deutsche S ozialstaat im internationalen Vergleich mit Großbritannien und Schweden betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Definition des Terminus „Wohlfahrtsstaat“
- 2.1 Unterscheidung Wohlfahrtsstaat - Sozialstaat - Sozialpolitik
- 2.2 Typisierung von Wohlfahrtsstaaten
- 3.0 Länderbeispiele für die drei Wohlfahrtsstaatstypen
- 3.1 Deutschland - der konservative Wohlfahrtsstaat
- 3.1.1 Charakteristika und Gestaltungsprinzipien
- 3.1.2 Sicherungssystem
- 3.2 Großbritannien - der liberale Wohlfahrtsstaat
- 3.2.1 Charakteristika und Gestaltungsprinzipien
- 3.2.2 Sicherungssystem
- 3.3 Schweden - der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat
- 3.3.1 Charakteristika und Gestaltungsprinzipien
- 3.3.2 Sicherungssystem
- 3.1 Deutschland - der konservative Wohlfahrtsstaat
- 4.0 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Modelle des Wohlfahrtsstaats und analysiert deren Finanzierbarkeit im Kontext demografischer Veränderungen. Der Fokus liegt auf einem Vergleich des deutschen konservativen Modells mit dem liberalen Modell Großbritanniens und dem sozialdemokratischen Modell Schwedens.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Wohlfahrtsstaat“
- Typisierung von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen
- Charakteristika der konservativen, liberalen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten
- Analyse der Finanzierbarkeit der verschiedenen Modelle
- Internationaler Vergleich der Wohlfahrtsstaaten
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die aktuelle Krise des Sozialstaats, die vor allem durch die steigenden Sozialleistungen und die demografische Entwicklung hervorgerufen wird. Sie führt die Problematik der Finanzierbarkeit des deutschen Sozialstaats aus und kündigt die anschließende Erörterung verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle und den internationalen Vergleich mit Großbritannien und Schweden an. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit der Untersuchung verschiedener Wohlfahrtsstaatsmodelle im Kontext der deutschen Situation.
2.0 Definition des Terminus „Wohlfahrtsstaat“: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Wohlfahrtsstaat“, der als ein Vergesellschaftungsmodus beschrieben wird, der sozial Schwächere unterstützt und in das Wirtschaftsleben eingreift. Es differenziert zwischen staatlichen Interventionen in die Verteilung von Lebenschancen und der sozialen Sicherung gegen Lebensrisiken. Der moderne Wohlfahrtsstaat wird als eine institutionalisierte Verpflichtung zur sozialen Sicherung und Förderung der Bürger definiert. Die rein deskriptive Verwendung des Terminus wird betont.
2.1 Unterscheidung Wohlfahrtsstaat - Sozialstaat - Sozialpolitik: Dieser Abschnitt klärt die Unterschiede zwischen den Begriffen Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat und Sozialpolitik. Er erläutert die historische Entwicklung des Begriffs Sozialstaat in Deutschland und hebt die unterschiedlichen Bedeutungen und Zielsetzungen der drei Konzepte hervor. Es wird deutlich gemacht, warum der Begriff „Sozialstaat“ im weiteren Verlauf der Arbeit nicht verwendet wird.
2.2 Typisierung von Wohlfahrtsstaaten: Dieses Kapitel beschreibt die Typisierung von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen, der drei Typen unterscheidet: sozialdemokratisch, liberal und konservativ. Jeder Typ wird charakterisiert durch seine politische Machtbasis, Organisation der Sozialpolitik, sowie die Art und Weise der Sozialleistungen. Die Unterschiede in Bezug auf soziale Bürgerrechte, Leistungsniveau und Eingriffe in den Markt werden herausgestellt.
3.0 Länderbeispiele für die drei Wohlfahrtsstaatstypen: Dieses Kapitel präsentiert Länderbeispiele für die drei Wohlfahrtsstaatstypen. Es liefert eine detaillierte Übersicht über die Charakteristika und Gestaltungsprinzipien der jeweiligen Systeme und vergleicht sie miteinander. Der Fokus liegt auf dem deutschen konservativen Modell, dem britischen liberalen Modell und dem schwedischen sozialdemokratischen Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Wohlfahrtsstaatsvergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht verschiedene Modelle des Wohlfahrtsstaats und analysiert deren Finanzierbarkeit im Kontext demografischer Veränderungen. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich des deutschen konservativen Modells mit dem liberalen Modell Großbritanniens und dem sozialdemokratischen Modell Schwedens.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung des Begriffs „Wohlfahrtsstaat“, Typisierung von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen, Charakteristika der konservativen, liberalen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, Analyse der Finanzierbarkeit der verschiedenen Modelle und ein internationaler Vergleich der Wohlfahrtsstaaten.
Wie wird der Begriff "Wohlfahrtsstaat" definiert?
Der Begriff "Wohlfahrtsstaat" wird als ein Vergesellschaftungsmodus definiert, der sozial Schwächere unterstützt und in das Wirtschaftsleben eingreift. Es wird zwischen staatlichen Interventionen in die Verteilung von Lebenschancen und der sozialen Sicherung gegen Lebensrisiken differenziert. Der moderne Wohlfahrtsstaat wird als eine institutionalisierte Verpflichtung zur sozialen Sicherung und Förderung der Bürger definiert.
Welche Unterschiede bestehen zwischen Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat und Sozialpolitik?
Die Arbeit klärt die Unterschiede zwischen den Begriffen Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat und Sozialpolitik. Sie erläutert die historische Entwicklung des Begriffs Sozialstaat in Deutschland und hebt die unterschiedlichen Bedeutungen und Zielsetzungen der drei Konzepte hervor. Es wird begründet, warum der Begriff „Sozialstaat“ im weiteren Verlauf der Arbeit nicht verwendet wird.
Wie werden Wohlfahrtsstaaten typisiert?
Die Arbeit beschreibt die Typisierung von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen, der drei Typen unterscheidet: sozialdemokratisch, liberal und konservativ. Jeder Typ wird charakterisiert durch seine politische Machtbasis, Organisation der Sozialpolitik, sowie die Art und Weise der Sozialleistungen. Die Unterschiede in Bezug auf soziale Bürgerrechte, Leistungsniveau und Eingriffe in den Markt werden herausgestellt.
Welche Länderbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit präsentiert detaillierte Fallstudien zu Deutschland (konservatives Modell), Großbritannien (liberales Modell) und Schweden (sozialdemokratisches Modell). Es werden die Charakteristika und Gestaltungsprinzipien der jeweiligen Systeme vorgestellt und verglichen.
Was ist der Fokus der Ländervergleiche?
Der Fokus liegt auf den Charakteristika und Gestaltungsprinzipien der jeweiligen Wohlfahrtsstaatsmodelle (konservativ, liberal, sozialdemokratisch) in Deutschland, Großbritannien und Schweden. Die Sicherungssysteme der einzelnen Länder werden ebenfalls analysiert.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und ggf. weitere Forschungsfragen aufwirft (dies ist aus der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit ersichtlich).
- Quote paper
- Carolin Sandfort (Author), 2003, Die drei Modelle des Wohlfahrtsstaats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21167