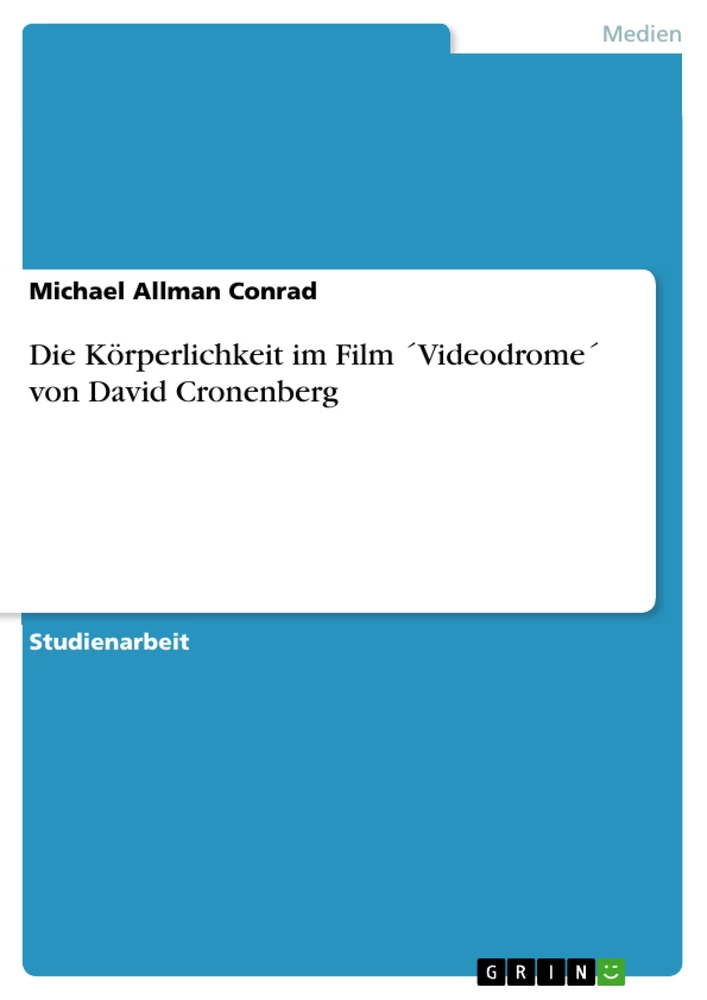In der vorliegenden Arbeit wird versucht, verschiedene Arten von konstruierter Körperlichkeit anhand des Filmes ,,Videodrome" (Kanada, 1982) des kanadischen Regisseurs David Cronenberg (*15.03.1943 Toronto) zu untersuchen. Nach einem analytischen Teil (Kapitel 2) werden in den anschließenden Kapiteln 3 - 5 mittels der Theorien von Marshall McLuhan, Jean Baudrillard und Georges Bataille, Ansätze zur Interpretation sowohl der dargestellten Körperlichkeiten als auch der Hauptthemen des Filmes gegeben. Dass die Arbeit diesbezüglich keine Vollständigkeit anstrebt, versteht sich bereits aufgrund der gebotenen Kürze. Manche Sachverhalte werden daher nur grob skizziert oder beiläufig erwähnt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Was ist ein anagrammatischer Körper?
- 2. Videodrome
- 2.1. Inhaltsangabe
- 2.2. Schlüsselszenen
- 2.2.1. Der Fernseher wird lebendig
- 2.2.2. Die Narbe im Bauch
- 2.2.3. Die Pistole und die Hand
- 3. „Das neue Fleisch“ – Marshall McLuhan
- 3.1. Vom Verlassen der Gutenberg-Galaxie
- 3.1.1. The extension of man
- 3.1.2. Die Amputation der Sinne
- 3.2. McLuhan und „Videodrome“
- 3.1. Vom Verlassen der Gutenberg-Galaxie
- 4. „Ich glaub’, ich bin im Film“ – Jean Baudrillard
- 4.1. Vom Verschwinden der Wirklichkeit
- 4.2. Baudrillard und „Videodrome“
- 5. „Sex and Crime“ – Georges Bataille
- 5.1. Von der Nähe zwischen Eros und Thanatos
- 5.2. Sexualität und Gewalt am Körper
- 6. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Arten konstruierter Körperlichkeit anhand des Films „Videodrome“ von David Cronenberg. Die Analyse fokussiert auf die Darstellung von Körperlichkeit im Film und interpretiert diese im Kontext der Theorien von McLuhan, Baudrillard und Bataille. Aufgrund der Kürze der Arbeit werden manche Aspekte nur skizziert.
- Die Konstruktion von Körperlichkeit im Film „Videodrome“
- Die Rolle von Medien und Technologie in der Gestaltung von Körpererfahrung
- Die Vermischung von Realität und Halluzination
- Der Einfluss von Gewalt und Sexualität auf die Körperwahrnehmung
- Die Interpretation der Filmhandlung durch verschiedene theoretische Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Was ist ein anagrammatischer Körper?: Die Einleitung führt den Begriff des „anagrammatischen Körpers“ ein, angelehnt an die Werke von Breton und Bellmer. Sie beschreibt den Körper als ein Konstrukt, formbar durch künstlerische Gestaltung, kulturelle Praktiken und soziokulturelle Einflüsse, wobei die moderne Schönheitschirurgie als Beispiel für die Manipulation des Körpers genannt wird. Der Film „Videodrome“ dient als Fallbeispiel für die Untersuchung verschiedener Arten konstruierter Körperlichkeit.
2. Videodrome: Dieses Kapitel bietet eine Inhaltsangabe des Films „Videodrome“, die die komplexe Interaktion von Realität und Halluzination hervorhebt. Es folgt eine Analyse von Schlüsselszenen, welche die zentrale Thematik von Körperlichkeit, Gewalt und Medienkonsum veranschaulichen. Die Zusammenfassung der Inhaltsangabe stellt die Verschwimmung der Grenzen zwischen Realität und Fiktion im Film dar und zeigt die zunehmende Desorientierung der Hauptfigur. Die Schlüsselszenen werden als visuelle Manifestationen der zentralen Themen des Films präsentiert.
3. „Das neue Fleisch“ – Marshall McLuhan: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss von Marshall McLuhans Medienphilosophie auf die Interpretation von „Videodrome“. Es analysiert McLuhans Konzepte wie „The extension of man“ und „Die Amputation der Sinne“ im Kontext des Films und deren Bedeutung für die dargestellte Körperlichkeit. Die Zusammenfassung dieses Kapitels verbindet McLuhans Thesen mit der Darstellung der Medien als transformative Kraft, die die Wahrnehmung und den Körper selbst verändert. Der Fokus liegt auf der Beeinflussung der körperlichen und mentalen Realität des Protagonisten durch die Medien.
4. „Ich glaub’, ich bin im Film“ – Jean Baudrillard: Dieses Kapitel betrachtet den Film durch die Linse von Jean Baudrillards Theorie der Simulakra und Simulation. Es analysiert, wie „Videodrome“ die Grenzen zwischen Realität und Simulation auflöst und die Konstruktion der Wirklichkeit hinterfragt. Die Zusammenfassung konzentriert sich auf Baudrillards Konzept der simulierten Realität und wie dies im Film durch die halluzinatorischen Erfahrungen des Protagonisten dargestellt wird. Der Film als Darstellung einer medieninduzierten Realität, die der Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion entzieht.
5. „Sex and Crime“ – Georges Bataille: Hier wird die Beziehung zwischen Sexualität, Gewalt und Körperlichkeit im Film im Lichte von Georges Batailles Werk untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf Batailles Konzepte von Eros und Thanatos und deren Interaktion im Film. Die Zusammenfassung dieses Kapitels konzentriert sich auf die Darstellung von Gewalt und Sexualität als untrennbar miteinander verbundene Aspekte der Körperlichkeit und wie diese Darstellung Batailles Thesen widerspiegelt. Die Symbiose aus Eros und Thanatos wird in Bezug auf die im Film dargestellte Körperlichkeit im Detail erörtert.
Schlüsselwörter
Videodrome, Körperlichkeit, Medien, Technologie, Realität, Halluzination, Gewalt, Sexualität, McLuhan, Baudrillard, Bataille, Film, Medienphilosophie, Postmoderne, Anagramm, Konstrukt.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von "Videodrome"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert verschiedene Arten konstruierter Körperlichkeit anhand des Films „Videodrome“ von David Cronenberg. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Körperlichkeit im Film und deren Interpretation im Kontext der Theorien von Marshall McLuhan, Jean Baudrillard und Georges Bataille.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion von Körperlichkeit im Film, die Rolle von Medien und Technologie in der Gestaltung von Körpererfahrung, die Vermischung von Realität und Halluzination, den Einfluss von Gewalt und Sexualität auf die Körperwahrnehmung und die Interpretation der Filmhandlung durch verschiedene theoretische Ansätze.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Analyse stützt sich auf die Medienphilosophie von Marshall McLuhan (insbesondere "The extension of man" und "Die Amputation der Sinne"), die Theorie der Simulakra und Simulation von Jean Baudrillard und die Konzepte von Eros und Thanatos von Georges Bataille.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Begriff des „anagrammatischen Körpers“ einführt. Es folgt eine detaillierte Analyse von „Videodrome“, einschließlich einer Inhaltsangabe und einer Interpretation wichtiger Schlüsselszenen. Die folgenden Kapitel widmen sich der Anwendung der Theorien von McLuhan, Baudrillard und Bataille auf den Film. Die Arbeit schließt mit Schlussbemerkungen.
Welche Schlüsselszenen aus "Videodrome" werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Schlüsselszenen, die die zentrale Thematik von Körperlichkeit, Gewalt und Medienkonsum veranschaulichen. Beispiele sind "Der Fernseher wird lebendig", "Die Narbe im Bauch" und "Die Pistole und die Hand". Diese Szenen werden als visuelle Manifestationen der zentralen Themen des Films präsentiert und im Kontext der jeweiligen Theorien interpretiert.
Wie wird der Begriff "anagrammatischer Körper" definiert?
Der Begriff "anagrammatischer Körper", angelehnt an die Werke von Breton und Bellmer, beschreibt den Körper als ein Konstrukt, formbar durch künstlerische Gestaltung, kulturelle Praktiken und soziokulturelle Einflüsse. Moderne Schönheitschirurgie dient als Beispiel für die Manipulation des Körpers. Der Film "Videodrome" wird als Fallbeispiel für die Untersuchung verschiedener Arten konstruierter Körperlichkeit genutzt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie "Videodrome" die Grenzen zwischen Realität und Simulation auflöst und die Konstruktion der Wirklichkeit hinterfragt. Sie verdeutlicht die transformative Kraft der Medien auf die Wahrnehmung und den Körper selbst und untersucht die Verknüpfung von Gewalt und Sexualität als untrennbar miteinander verbundene Aspekte der Körperlichkeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Videodrome, Körperlichkeit, Medien, Technologie, Realität, Halluzination, Gewalt, Sexualität, McLuhan, Baudrillard, Bataille, Film, Medienphilosophie, Postmoderne, Anagramm, Konstrukt.
- Citation du texte
- Michael Allman Conrad (Auteur), 2001, Die Körperlichkeit im Film ´Videodrome´ von David Cronenberg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2109