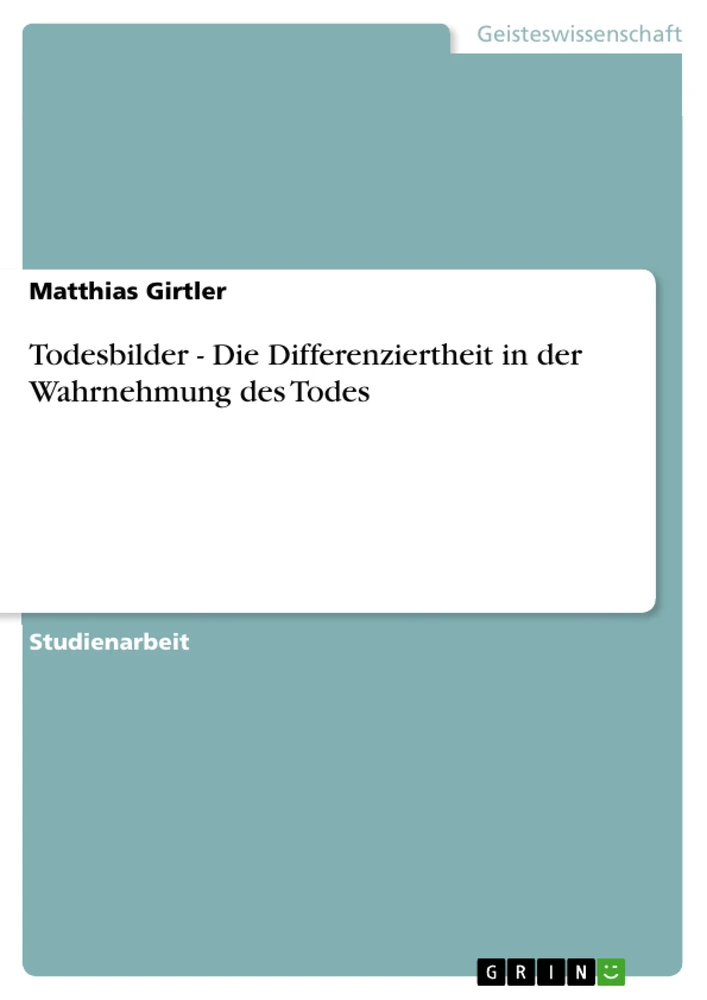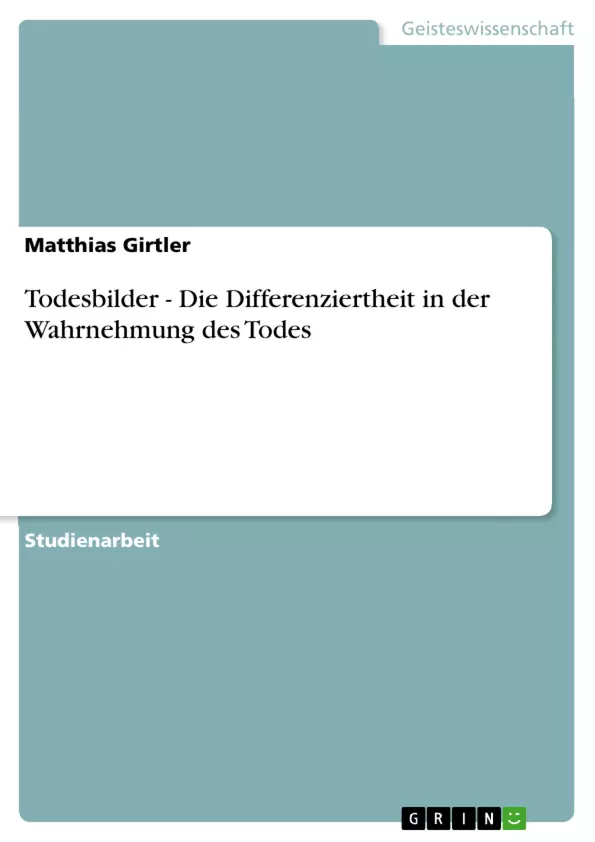1. Einleitung...................................................................3
2. Die veränderte Wahrnehmung des Todes......................................4
2.1. Funktional differenzierte Todesdefinitionen / -bilder...................4
2.2. Der juristisch / medizinische Tod..........................................................................5
2.3. Die neue Sichtbarkeit des Todes........................................................................6
2.3.1. Darstellung in Nachrichten..................................................................6
2.3.2. Verdrängung der Körper.......................................................................8
3. Der Tod als absoluter Schlusspunkt................................................................10
4. Die Vielfalt der Todesbilder als eine Folge des
Individualisierungsprozesses................................................11
5. Schluss.....................................................................12
6. Literaturverzeichnis........................................................13
1. Einleitung
"Der Tod enthüllt sich zwar als Verlust, aber mehr als solcher, den die Verbleibenden erfahren. Im Erleiden des Verlustes wird jedoch nicht der Seinsverlust als solcher zugänglich, den der Sterbende «erleidet». Wir erfahren nicht im genuinen Sinne das Sterben der Anderen, sondern sind höchstens immer nur «dabei»." (Heidegger 1972, S. 239)
Unsere Gesellschaft scheint die Thematik des Todes und den Umgang damit immer mehr aus dem Bewusstsein der Individuen bzw. der gesellschaftlichen Diskussion zu drängen.
Wir beschäftigen uns nicht mehr derart mit dieser Thematik, da es nicht nötig ist weil diese nicht mehr zu unserem Alltag gehört. So oder so ähnlich lautet eine häufig formulierte These, die von einer Verdrängung des Todes ausgeht. Doch scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein, geht man von einer Zunahme der Individualisierung und einer damit verbundenen Zunahme der Todesbilder aus. Die Unsicherheit nimmt zu, eben weil eindeutige Anschlussmöglichkeiten nicht (mehr) existieren, da jedes System geschlossen operiert und sich selbst reproduziert und somit Antworten schafft die sich bewähren oder nicht.
Der Tod ist somit als solcher nicht erfahrbar, nicht definierbar. Man kann nichts über ihn sagen und doch gibt es soviel über ihn zu sagen. Es gibt keine Gewissheit darüber was er ist und wie er zu deuten ist. Die Einschränkung auftretender Kontingenz kann somit nicht mehr mit einer...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die veränderte Wahrnehmung des Todes
- 2.1. Funktional differenzierte Todesdefinitionen / -bilder
- 2.2. Der juristische / medizinische Tod
- 2.3. Die neue Sichtbarkeit des Todes
- 2.3.1. Darstellung in Nachrichten
- 2.3.2. Verdrängung der Körper
- 3. Der Tod als absoluter Schlusspunkt
- 4. Die Vielfalt der Todesbilder als eine Folge des Individualisierungsprozesses
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die veränderte Wahrnehmung des Todes in der modernen Gesellschaft. Sie hinterfragt die gängige These von der Verdrängung des Todes und analysiert stattdessen die zunehmende Vielfalt an Todesbildern im Kontext der funktionalen Differenzierung. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie verschiedene gesellschaftliche Systeme (Recht, Medizin, Ethik) den Tod definieren und mit ihm umgehen.
- Veränderte Wahrnehmung des Todes in der modernen Gesellschaft
- Funktional differenzierte Todesdefinitionen in verschiedenen Systemen
- Die Rolle der Individualisierung bei der Entstehung vielfältiger Todesbilder
- Der Tod als Störung gesellschaftlicher Systeme
- Die Grenzen zwischen Leben und Tod in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der veränderten Wahrnehmung des Todes in den Mittelpunkt. Sie problematisiert die gängige Verdrängungsthese und argumentiert für eine differenziertere Betrachtung der Thematik, die die zunehmende Vielfalt an Todesbildern berücksichtigt. Heideggers Aussage über die Unmöglichkeit, den Tod eines Anderen wirklich zu erfahren, wird als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Konstruktion des Todes genutzt. Die Arbeit kündigt eine Analyse der Antworten verschiedener Funktionssysteme auf die Frage nach Leben und Tod an und betont die Notwendigkeit, die Entstehung dieser Frage selbst zu untersuchen.
2. Die veränderte Wahrnehmung des Todes: Dieses Kapitel widerlegt die These einer einfachen Verdrängung des Todes. Stattdessen wird von einer veränderten Wahrnehmung und Darstellung gesprochen, die durch Prozesse der Verwissenschaftlichung, Politisierung, Ökonomisierung, Medikalisierung und Juridifizierung geprägt ist. Die zunehmende Kommunikationsfülle macht einen Rückgang der Beschäftigung mit dem Tod paradox. Das Kapitel leitet zur Diskussion über die Definition des Todes in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen über.
2.1. Funktional differenzierte Todesdefinitionen / -bilder: Dieses Unterkapitel erläutert den Begriff der funktionalen Differenzierung und seine Relevanz für die Definition des Todes. Die zunehmende Differenzierung von Todesbildern erfordert eine präzise Definition des Todes, um Sicherheit zu gewährleisten und die Folgen für Hinterbliebene zu regeln. Die unterschiedlichen Antworten der Systeme werden als miteinander verbundene, aber nicht identische Perspektiven dargestellt, wobei Expertenwissen als ein wichtiger Faktor hervorgehoben wird.
2.2. Der juristische / medizinische Tod: Hier wird die fehlende explizite Todesdefinition im Rechtssystem aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen natürlichem und unnatürlichem Tod, wobei der Herzstillstand als oft verwendetes, aber nicht uneingeschränktes Kriterium genannt wird. Das Transplantationsgesetz wird als Beispiel für die dynamische Definition des Todes im Kontext medizinischer Fortschritte angeführt. Der Unterschiedliche Umgang mit Sterbehilfe und Abtreibung verdeutlicht die Einmischung ethischer Erwägungen in die Frage der Todesdefinition.
Schlüsselwörter
Tod, Wahrnehmung, Individualisierung, Funktional Differenzierung, Todesbilder, Medizin, Recht, Ethik, Verdrängung, Verwissenschaftlichung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Veränderte Wahrnehmung des Todes in der modernen Gesellschaft
Was ist der zentrale Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die veränderte Wahrnehmung des Todes in der modernen Gesellschaft. Er hinterfragt die gängige These von der Verdrängung des Todes und analysiert stattdessen die zunehmende Vielfalt an Todesbildern im Kontext der funktionalen Differenzierung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung, wie verschiedene gesellschaftliche Systeme (Recht, Medizin, Ethik) den Tod definieren und mit ihm umgehen.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Hauptthemen umfassen die veränderte Wahrnehmung des Todes in der modernen Gesellschaft, funktional differenzierte Todesdefinitionen in verschiedenen gesellschaftlichen Systemen (Recht, Medizin, Ethik), die Rolle der Individualisierung bei der Entstehung vielfältiger Todesbilder, den Tod als Störung gesellschaftlicher Systeme und die Grenzen zwischen Leben und Tod in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten. Der Text beleuchtet auch die Herausforderungen, die durch die zunehmende Verwissenschaftlichung, Politisierung, Ökonomisierung und Medikalisierung des Todes entstehen.
Wie strukturiert sich der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur veränderten Wahrnehmung des Todes (mit Unterkapiteln zu funktional differenzierten Todesdefinitionen und dem juristischen/medizinischen Tod), ein Kapitel zum Tod als absolutem Schlusspunkt, ein Kapitel zur Vielfalt der Todesbilder im Kontext des Individualisierungsprozesses und einen Schluss. Zusätzlich enthält er ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche These wird im Text widerlegt?
Der Text widerlegt die These einer einfachen Verdrängung des Todes in der modernen Gesellschaft. Stattdessen argumentiert er für eine veränderte Wahrnehmung und Darstellung des Todes, die durch verschiedene gesellschaftliche Prozesse geprägt ist. Die zunehmende Kommunikationsfülle steht dabei paradoxerweise zu einer vermeintlich geringeren Beschäftigung mit dem Tod.
Welche Rolle spielt die funktionale Differenzierung?
Die funktionale Differenzierung spielt eine zentrale Rolle im Text. Sie erklärt die Entstehung vielfältiger Todesbilder, da verschiedene gesellschaftliche Systeme (Recht, Medizin, Ethik etc.) den Tod unterschiedlich definieren und mit ihm umgehen. Diese unterschiedlichen Definitionen werden als miteinander verbunden, aber nicht identisch dargestellt.
Wie wird der Tod in juristischen und medizinischen Kontexten definiert?
Der Text zeigt auf, dass es im Rechtssystem keine explizite Definition des Todes gibt. Die Unterscheidung zwischen natürlichem und unnatürlichem Tod wird thematisiert, wobei der Herzstillstand als oft verwendetes, aber nicht uneingeschränktes Kriterium genannt wird. Das Transplantationsgesetz wird als Beispiel für eine dynamische Definition des Todes im Kontext medizinischer Fortschritte angeführt. Ethische Erwägungen, wie bei Sterbehilfe und Abtreibung, beeinflussen die Todesdefinition zusätzlich.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Tod, Wahrnehmung, Individualisierung, Funktionale Differenzierung, Todesbilder, Medizin, Recht, Ethik, Verdrängung, Verwissenschaftlichung, Kommunikation.
- Citar trabajo
- Matthias Girtler (Autor), 2012, Todesbilder - Die Differenziertheit in der Wahrnehmung des Todes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210719