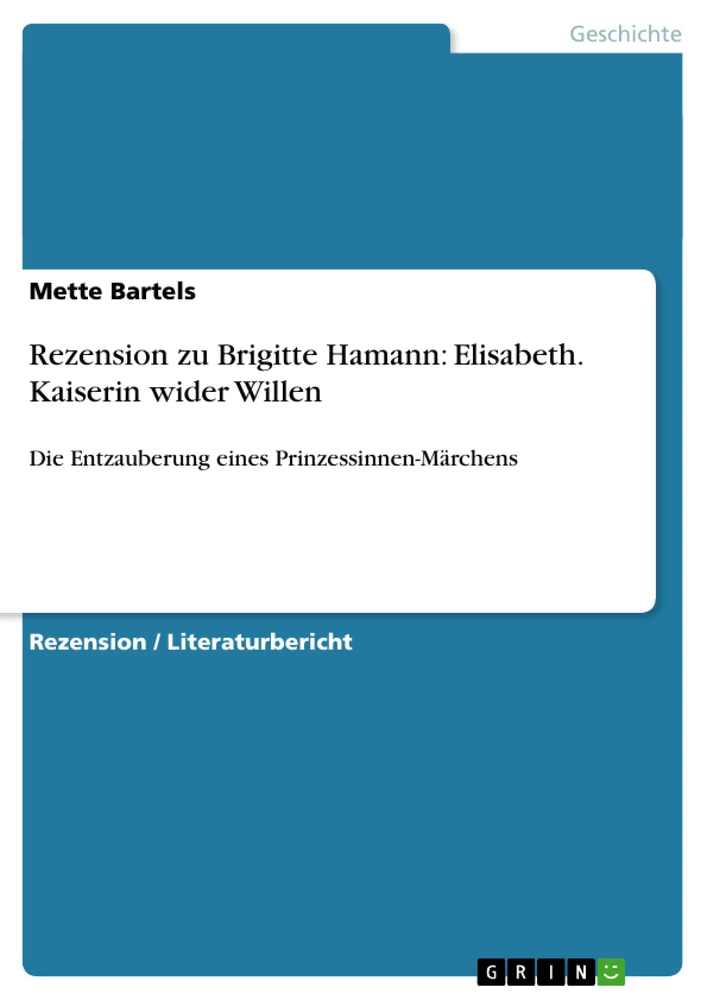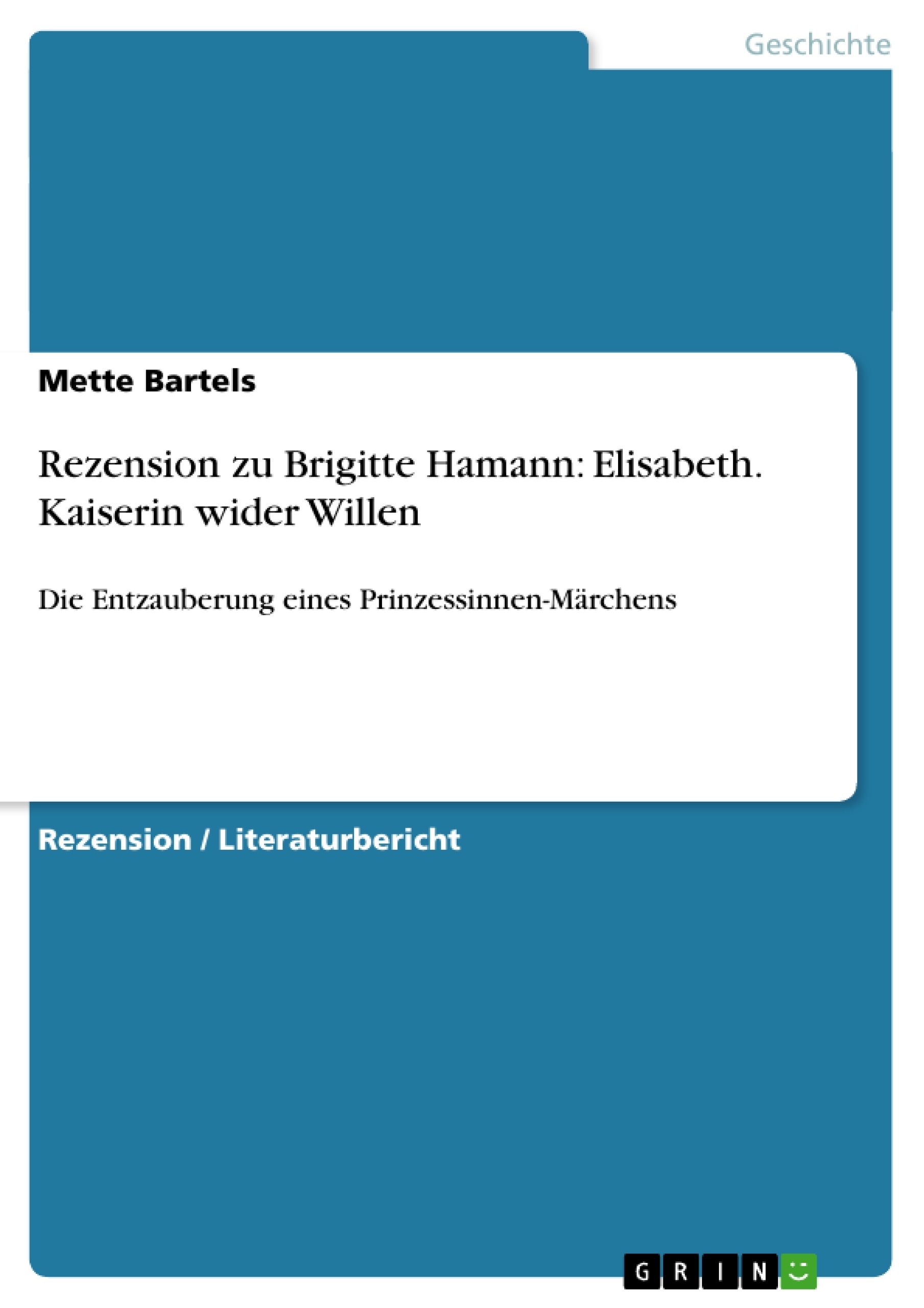„Ihr lieben Völker im weiten Reich – so ganz im Geheimen bewundere ich euch: da nähret ihr mit eurem Fleische und Blut gutmütig diese verkommene Brut.“ Zeilen aus dem Tagebuch einer Kaiserin, die keine sein wollte: Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Un-garn. Bei diesem Namen haben die meisten die junge Romy Schneider in Marischkas Sissi-Trilogie der 1950er Jahre vor Augen: Elisabeth als pflichtbewusste Monarchin, liebende Gattin, treusorgende Mutter und lebensfrohen Familienmenschen – quasi das „süßes Hascher“, wie der Wiener sagen würde, und aufopfernde Kaiserin in einer Person.
Die deutsch-österreichische Historikerin Brigitte Hamann räumt in ihrer Biographie „Elisabeth. Kaiserin wider Willen“ kräftig mit diesem romantischen Kitsch-Bild auf. Wer weiter an das süße Sissi-Klischee glauben möchte, sollte das Buch von Hamann lieber nicht zur Hand nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1-3: Die arrangierte Hochzeit und die Überforderung am Wiener Hof
- Kapitel 4-5: Der Kuraufenthalt und die Erlangung der Selbstbestimmung
- Kapitel 5-8: Privates Leben, Schönheitskult und finanzielle Unabhängigkeit
- Kapitel 9-13: Die 1880er Jahre, Gedichte, Griechenlandliebe und Isolation
- Kapitel 14: Die Ermordung in Genf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Biographie "Elisabeth. Kaiserin wider Willen" von Brigitte Hamann zielt darauf ab, das romantisierte Bild der Kaiserin Elisabeth ("Sissi") zu dekonstruieren und ein differenzierteres, wissenschaftlich fundiertes Porträt zu zeichnen. Dies geschieht durch die Einbeziehung bisher unbekannten Quellenmaterials, insbesondere der Gedichte Elisabeths.
- Die Entzauberung des "Sissi"-Mythos und die Darstellung Elisabeths als komplexe Persönlichkeit.
- Die Auseinandersetzung mit Elisabeths Streben nach Selbstverwirklichung und ihrem Konflikt mit der Rolle als Kaiserin.
- Die Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts im Habsburgerreich.
- Die Analyse von Elisabeths Beziehungen zu ihrem Ehemann, ihren Kindern und ihrem Umfeld.
- Die Bedeutung von Elisabeths Gedichten als Quelle für das Verständnis ihrer Persönlichkeit und ihrer Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1-3: Die arrangierte Hochzeit und die Überforderung am Wiener Hof: Diese Kapitel schildern die arrangierte Hochzeit Elisabeths mit Kaiser Franz Joseph und die damit verbundene Überforderung der jungen Kaiserin am strengen Wiener Hof. Die unkonventionelle Erziehung in Bayern steht im starken Kontrast zum starren Hofzeremoniell und den Konflikten mit der Schwiegermutter. Elisabeths anfängliche Unsicherheit und ihr wachsendes Unbehagen in ihrer Rolle werden detailliert beschrieben. Die Darstellung der Italienkrise von 1859 und die Niederlage von Solferino unterstreichen den politischen Kontext und die Herausforderungen, denen Elisabeth ausgesetzt war. Die Kapitel legen den Grundstein für Elisabeths spätere Rebellion und ihren Wunsch nach Selbstbestimmung.
Kapitel 4-5: Der Kuraufenthalt und die Erlangung der Selbstbestimmung: Nach einer psychosomatischen Erkrankung verlässt Elisabeth Wien für einen Kuraufenthalt und entwickelt während dieser Zeit ein wachsendes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Dieser Abschnitt beschreibt ihre Transformation zu einer selbstbewussten Frau, die sich ihrem Umfeld und den Erwartungen des Hofes zunehmend widersetzt. Sie setzt dem Kaiser ein Ultimatum und erkämpft sich eine größere Selbstbestimmung über ihr Leben. Der Fokus liegt auf Elisabeths Entwicklung von Abhängigkeit hin zu Unabhängigkeit und der Begründung ihrer späteren Lebensführung.
Kapitel 5-8: Privates Leben, Schönheitskult und finanzielle Unabhängigkeit: Diese Kapitel beleuchten Elisabeths Fokus auf ihr Privatleben und ihren Schönheitskult. Sie widmet sich ihren privaten Interessen, treibt exzessiven Sport und vernachlässigt ihre sozialen Aufgaben als Kaiserin. Der Abschnitt beleuchtet ihre kostspieligen Lebensgewohnheiten und ihre finanzielle Unabhängigkeit. Die Kapitel zeigen den Widerspruch zwischen Elisabeths persönlichem Lebensstil und ihren öffentlichen Pflichten, sowie ihre bewusste Provokation der Wiener Gesellschaft. Die Kapitel verdeutlichen auch, wie Elisabeth ihre hohe Stellung und das damit verbundene Vermögen für ihre persönlichen Zwecke nutzt.
Kapitel 9-13: Die 1880er Jahre, Gedichte, Griechenlandliebe und Isolation: Dieser Abschnitt ist zentral für das Verständnis des neuen Bildes Elisabeths. Die Kapitel behandeln die 1880er Jahre, die Zeit der Entstehung von Elisabeths poetischem Tagebuch, in dem sie ihre Abneigung gegenüber dem Haus Habsburg und der Monarchie offen zum Ausdruck bringt. Die Analyse ihrer Gedichte enthüllt ihre tiefsten Gefühle, ihre Isolation, und ihre Kritik am bestehenden System. Ihre Griechenlandliebe und ihre Beschäftigung mit Spiritualismus zeigen weitere Facetten ihrer Persönlichkeit. Diese Kapitel stellen Elisabeths persönliche und politische Einstellungen im Detail dar und verdeutlichen die Bedeutung ihrer literarischen Hinterlassenschaft.
Schlüsselwörter
Kaiserin Elisabeth, Sissi-Mythos, Selbstverwirklichung, Habsburgermonarchie, 19. Jahrhundert, politische Geschichte Österreichs, Frauenrolle, Biographie, Gedichte, Quellenkritik, Individualismus, Rebellion.
Häufig gestellte Fragen zu "Elisabeth. Kaiserin wider Willen" von Brigitte Hamann
Was ist der Inhalt des Buches "Elisabeth. Kaiserin wider Willen"?
Die Biografie von Brigitte Hamann zeichnet ein differenziertes und wissenschaftlich fundiertes Porträt von Kaiserin Elisabeth ("Sissi"), welches den romantisierten "Sissi"-Mythos dekonstruiert. Sie beleuchtet Elisabeths Leben von der arrangierten Hochzeit bis zu ihrer Ermordung, unter Berücksichtigung bisher unbekannter Quellen, insbesondere ihrer Gedichte. Das Buch analysiert Elisabeths Streben nach Selbstverwirklichung, ihren Konflikt mit der Rolle als Kaiserin, ihre Beziehungen und ihren Einfluss auf das 19. Jahrhundert im Habsburgerreich.
Welche Kapitel umfasst das Buch und worum geht es jeweils?
Das Buch ist in 14 Kapitel gegliedert. Kapitel 1-3 behandeln die arrangierte Hochzeit und Elisabeths Überforderung am Wiener Hof. Kapitel 4-5 schildern ihren Kuraufenthalt und die Erlangung von Selbstbestimmung. Kapitel 5-8 beleuchten ihr Privatleben, den Schönheitskult und ihre finanzielle Unabhängigkeit. Kapitel 9-13 konzentrieren sich auf die 1880er Jahre, Elisabeths Gedichte, ihre Griechenlandliebe und Isolation. Kapitel 14 beschreibt schließlich ihre Ermordung in Genf.
Welche Themenschwerpunkte werden im Buch behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entzauberung des "Sissi"-Mythos, Elisabeths Streben nach Selbstverwirklichung und ihr Konflikt mit der Rolle als Kaiserin. Weitere Schwerpunkte sind die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts im Habsburgerreich, Elisabeths Beziehungen und die Bedeutung ihrer Gedichte als Quelle für das Verständnis ihrer Persönlichkeit und ihrer Zeit.
Welche Quellen wurden für das Buch verwendet?
Die Biografie basiert auf einer umfassenden Quellenrecherche, die auch bisher unbekannte Quellenmaterialien, insbesondere Elisabeths Gedichte, einbezieht. Dies ermöglicht eine differenzierte und wissenschaftlich fundierte Darstellung von Elisabeths Leben und Persönlichkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Kaiserin Elisabeth, Sissi-Mythos, Selbstverwirklichung, Habsburgermonarchie, 19. Jahrhundert, politische Geschichte Österreichs, Frauenrolle, Biographie, Gedichte, Quellenkritik, Individualismus, Rebellion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin mit diesem Buch?
Die Autorin zielt darauf ab, ein differenzierteres und wissenschaftlich fundiertes Bild von Kaiserin Elisabeth zu zeichnen, welches den gängigen, romantisierten Mythos hinterfragt und durch die Einbeziehung bisher unbekannter Quellen erweitert.
- Quote paper
- Mette Bartels (Author), 2012, Rezension zu Brigitte Hamann: Elisabeth. Kaiserin wider Willen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210320