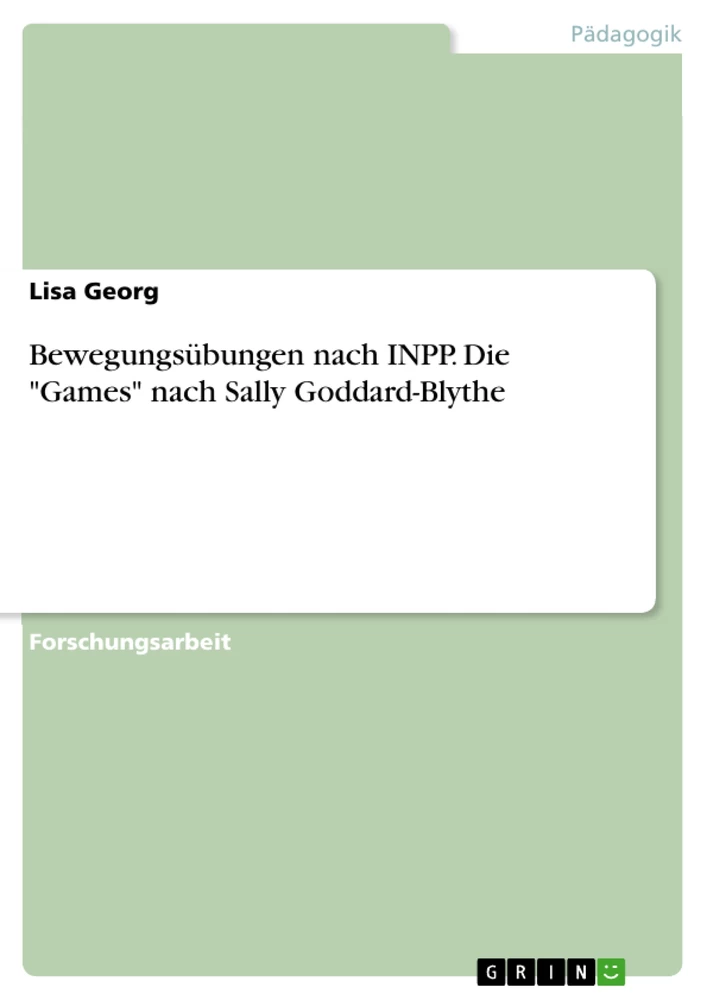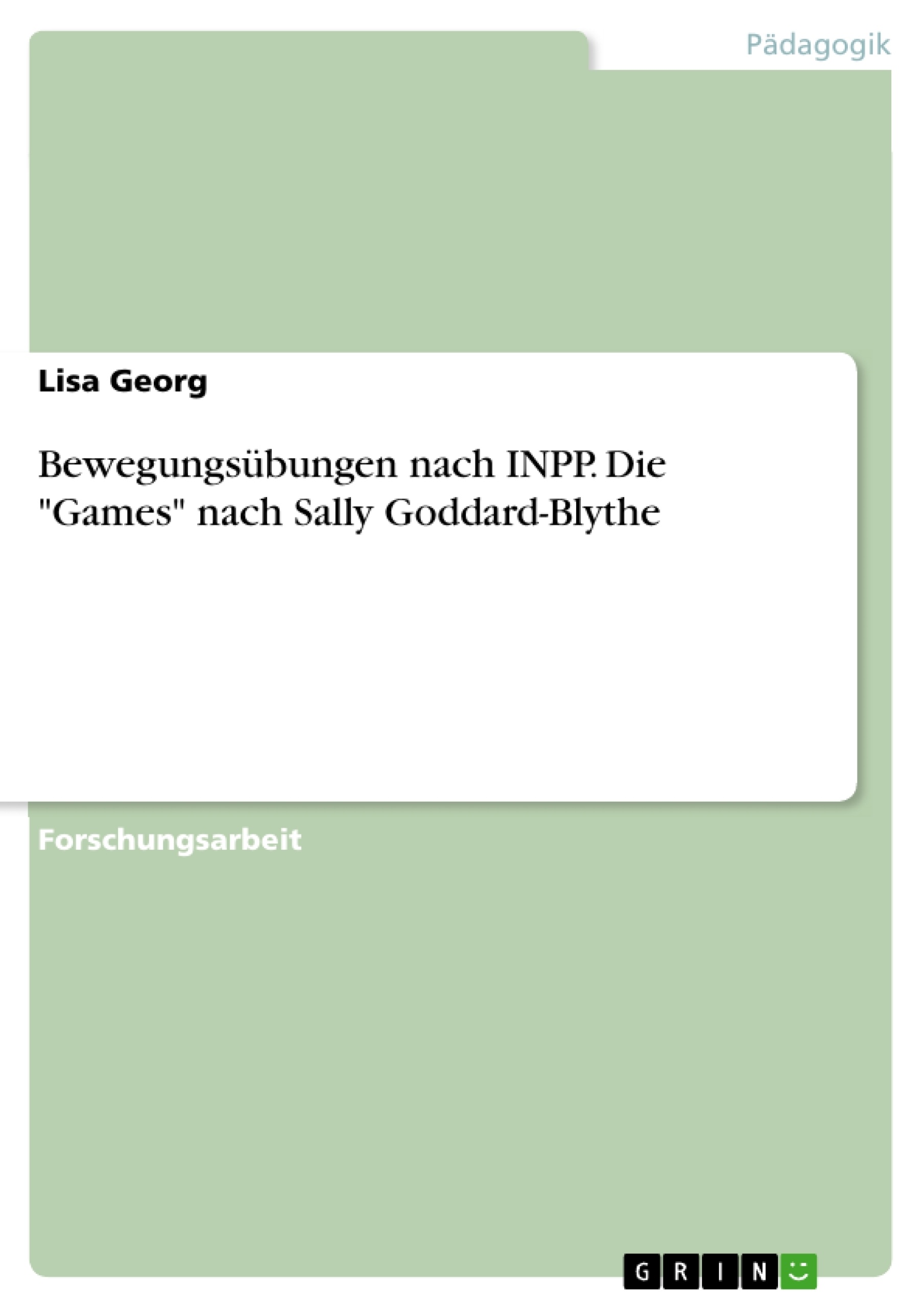Das Bewegungsprogramm für den (Vor-)Schulbereich nach Goddard-Blythe soll helfen, persistierende frühkindliche Reflexe in reife Bewegungsmuster weiterzuentwickeln und so die gesamte Motorik verbessern. Dadurch werden im Hinblick auf Schule die Lernfähigkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration gefördert.
Diese Forschungsarbeit widmet sich der Frage, inwieweit die Durchfühung eines solchen Bewegungsprogrammes im Kindergarten a) möglich und b) sinnvoll ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage, Hintergrund, Information
- Über persistierende Reflexe
- Bedeutung der Thematik für meine Arbeit im Waldorfkindergarten
- Die „Games“ - Das INPP Bewegungsprogramm
- Forschungsziel
- Fragestellung und Hypothese
- Vorgehensweise und Forschungsdesign
- Erhebungsphase
- Vorbereitung
- Durchführung
- Beobachtungen
- Reflexion und Fazit zur ursprünglichen Forschungsfrage
- Erweiterung der Praxis-Forschung
- erweiterte Fragestellung
- erweiterte Forschungshypothese
- Zweite Erhebungsphase
- Vorbereitung und konkrete Veränderungen
- Beobachtungen
- Reflexion und Fazit zur erweiterten Fragestellung
- Auswertung der Praxis-Forschung
- Auswertung der Beobachtungen
- pädagogische Konsequenz
- Bedeutung des Themas für den Studiengang Kindheitspädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Praxisforschung untersucht den Einfluss eines sensomotorischen Förderprogramms (INPP „Games“) auf die Integration persistierender frühkindlicher Reflexe bei Kindergartenkindern. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Übungen in Bezug auf die Förderung der Bewegungsentwicklung zu evaluieren und deren praktische Anwendung im Kindergartenalltag zu reflektieren.
- Persistierende frühkindliche Reflexe und deren Auswirkungen auf die Bewegungsentwicklung
- Wirksamkeit des INPP Bewegungsprogramms ("Games") zur Integration von Reflexen
- Praktische Umsetzung des Programms im Kindergartenalltag
- Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder
- Pädagogische Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beschreibt den Ausgangspunkt der Forschung, ausgelöst durch die Erfahrung mit persistierenden frühkindlichen Reflexen bei Kindergartenkindern und die anschließende Teilnahme an einer Fortbildung zum INPP-Bewegungsprogramm. Die Autorin erläutert ihre Motivation, die Wirksamkeit der „Games“ zu untersuchen und deren Integration in den Kindergartenalltag zu erforschen.
Ausgangslage, Hintergrund, Information: Dieses Kapitel beleuchtet das Thema persistierende frühkindliche Reflexe, ihre Auswirkungen auf die motorische, kognitive und soziale Entwicklung von Kindern und die Bedeutung dieser Thematik für die Arbeit im Waldorfkindergarten. Es wird das INPP-Bewegungsprogramm mit seinen Übungen ("Games") detailliert vorgestellt und die Notwendigkeit der Forschungsarbeit begründet.
Forschungsziel: Hier werden die Forschungsfrage, die Hypothese und die Methodik der Studie definiert. Die Autorin skizziert ihre Vorgehensweise bei der Erhebung und Auswertung der Daten, um die Wirksamkeit des INPP-Programms zu untersuchen.
Erhebungsphase: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der ersten Erhebungsphase, einschließlich der Vorbereitung, Durchführung und der detaillierten Beobachtungen der Kinder während der Anwendung der INPP-Übungen. Die Autorin reflektiert die Ergebnisse im Hinblick auf die ursprüngliche Forschungsfrage.
Erweiterung der Praxis-Forschung: Aufgrund der Ergebnisse der ersten Erhebungsphase wird die Forschungsfrage erweitert und die Hypothese angepasst. Es werden neue Forschungsfragen formuliert, um die Untersuchung zu vertiefen und zu präzisieren.
Zweite Erhebungsphase: Die zweite Erhebungsphase wird beschrieben, inklusive der Anpassungen der Vorgehensweise und der Beobachtungen. Die Autorin analysiert die Ergebnisse im Lichte der erweiterten Forschungsfrage.
Auswertung der Praxis-Forschung: In diesem Kapitel werden die Beobachtungen aus beiden Erhebungsphasen ausgewertet und die pädagogischen Konsequenzen daraus abgeleitet. Die Bedeutung der Ergebnisse für den Studiengang Kindheitspädagogik wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Reflexe, persistierende Reflexe, Bewegungsentwicklung, INPP-Bewegungsprogramm, „Games“, Waldorfkindergarten, sensomotorische Förderung, Praxisforschung, pädagogische Konsequenzen, Kindheitspädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Praxisforschung: Einfluss eines sensomotorischen Förderprogramms auf die Integration persistierender frühkindlicher Reflexe bei Kindergartenkindern
Was ist der Gegenstand dieser Praxisforschung?
Die Praxisforschung untersucht den Einfluss des sensomotorischen INPP-Bewegungsprogramms ("Games") auf die Integration persistierender frühkindlicher Reflexe bei Kindergartenkindern im Waldorfkindergarten. Ziel ist die Evaluierung der Wirksamkeit der Übungen zur Förderung der Bewegungsentwicklung und deren Reflexion im Kindergartenalltag.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt persistierende frühkindliche Reflexe und deren Auswirkungen auf die motorische, kognitive und soziale Entwicklung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Wirksamkeit des INPP-Programms, seiner praktischen Umsetzung im Kindergartenalltag, der Beobachtung und Dokumentation der Kinderentwicklung und den daraus resultierenden pädagogischen Konsequenzen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Ausgangslage mit Hintergrundinformationen (inkl. Beschreibung des INPP-Programms), die Formulierung des Forschungsziels und der Hypothese, eine erste Erhebungsphase mit Beobachtungen und Reflexion, eine Erweiterung der Forschung mit angepasster Fragestellung und Hypothese, eine zweite Erhebungsphase, die Auswertung der Ergebnisse beider Phasen und deren pädagogische Konsequenzen sowie die Bedeutung für den Studiengang Kindheitspädagogik.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit beschreibt eine Praxisforschung mit einer zweistufigen Erhebungsphase. Die Methodik beinhaltet die Beobachtung und Dokumentation der Kinder während der Anwendung der INPP-Übungen ("Games"). Die Forschungsfrage und Hypothese wurden aufgrund der Ergebnisse der ersten Erhebungsphase angepasst und verfeinert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die konkreten Ergebnisse der Beobachtungen und deren Auswertung sind im Text detailliert beschrieben. Die Arbeit leitet daraus pädagogische Konsequenzen ab und diskutiert deren Bedeutung für den Studiengang Kindheitspädagogik. Die detaillierte Auswertung der Beobachtungen findet sich in den Kapiteln zur ersten und zweiten Erhebungsphase und der Auswertung der Praxisforschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühkindliche Reflexe, persistierende Reflexe, Bewegungsentwicklung, INPP-Bewegungsprogramm, „Games“, Waldorfkindergarten, sensomotorische Förderung, Praxisforschung, pädagogische Konsequenzen, Kindheitspädagogik.
Welche Fragestellung wird untersucht?
Die zentrale Fragestellung untersucht die Wirksamkeit des INPP-Bewegungsprogramms ("Games") zur Integration persistierender frühkindlicher Reflexe und deren Auswirkungen auf die Bewegungsentwicklung der Kinder. Diese Fragestellung wird im Laufe der Arbeit erweitert und präzisiert.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit formuliert eine Hypothese zur Wirksamkeit des INPP-Programms, die im Laufe der Arbeit aufgrund der Ergebnisse der ersten Erhebungsphase angepasst und erweitert wird.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Kindheitspädagogik, Erzieher*innen im Waldorfkindergarten und alle, die sich mit der sensomotorischen Entwicklung von Kindern und der Integration persistierender frühkindlicher Reflexe beschäftigen.
- Quote paper
- Lisa Georg (Author), 2011, Bewegungsübungen nach INPP. Die "Games" nach Sally Goddard-Blythe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210164