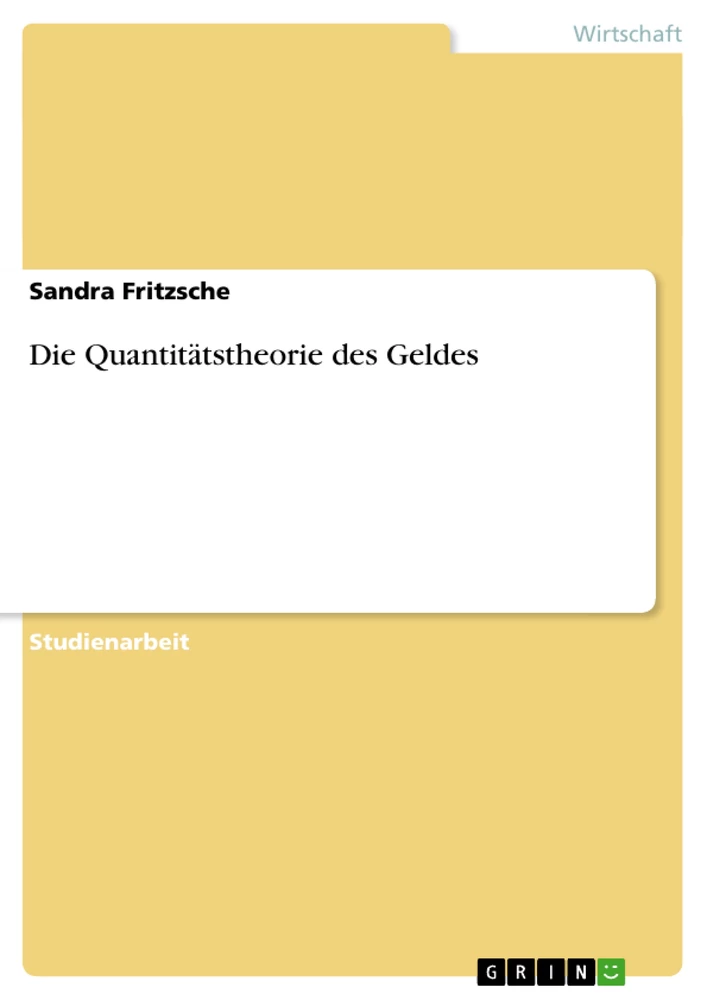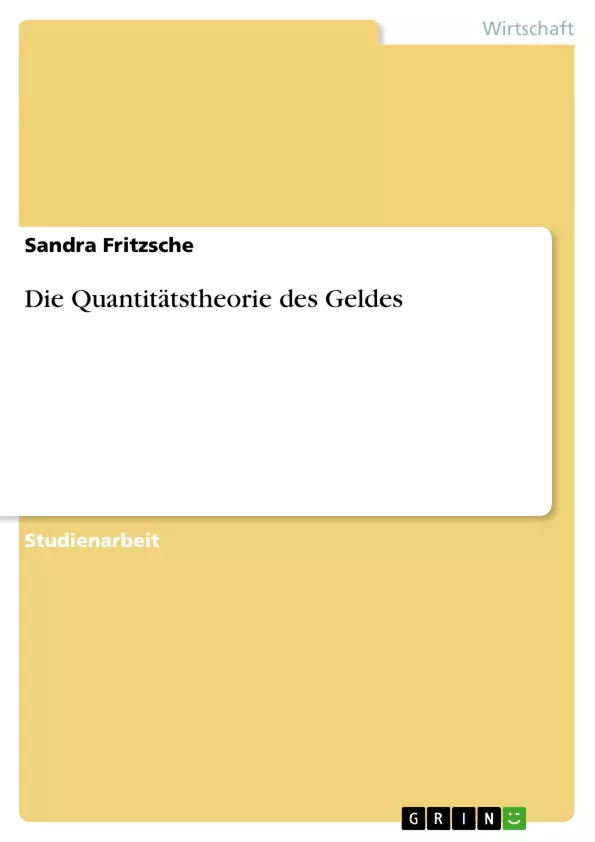Die Quantitätstheorie ist eine der ältesten ökonomischen Theorien überhaupt und
ist zudem, im Gegensatz zu anderen alten Theorien, auch noch heute aktuell.1
Insbesondere durch die zahlreichen Arbeiten und empirischen Untersuchungen
Friedmans seit 1956 ist die Quantitätstheorie zu der dominanten Theorie im
Bereich der monetären Ökonomie geworden. 2 Besondere Bedeutung kommt der
Quantitätstheorie zu, weil sie die Grundlage für die Geldpolitik der EZB und aller
anderen Notenbanken mit Geldmengenziel liefert.
Im Folgenden ist daher zunächst aufzuzeigen, welche Bedeutung den einzelnen
Variablen zukommt und welche Probleme damit verbunden sind. Anschließend
wird die dogmenhistorische Entwicklung der Quantitätstheorie von ihren
Anfängen in der frühen Neuzeit bis heute aufgezeigt.
1 Vgl. Graff, M.: Die Quantitätstheorie vom Mittelalter bis zur Gegenwart, in : Dresdener Beiträge
zur Volkswirtschaftslehre, Nr. 02/00, Dresden, 2000, S. 1.
2 Vgl. Issing, O.: Einführung in die Geldtheorie, 11. Auflage, München, 1998, S. 146.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die geldpolitische Bedeutung
- 2.1 Einkommen und Preisniveau
- 2.2 Die Geldmenge / Das Geldangebot
- 2.3 Die Umlaufgeschwindigkeit / Die Geldnachfrage
- 3. Dogmengeschichte
- 3.1 Die frühe Neuzeit
- 3.2 Ältere Quantitätstheorie
- 3.3 Die Neoquantitätstheorie
- 4. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Quantitätstheorie des Geldes, eine der ältesten und aktuellsten ökonomischen Theorien. Ziel ist es, die geldpolitische Bedeutung der Theorie, ihre historische Entwicklung und kritische Aspekte zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Geldmenge und ihrer Beziehung zum Preisniveau gewidmet.
- Geldpolitische Relevanz der Quantitätstheorie
- Historische Entwicklung der Quantitätstheorie
- Bedeutung der Geldmenge und des Preisniveaus
- Einfluss der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes
- Kritische Bewertung der zugrundeliegenden Annahmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Quantitätstheorie des Geldes als eine der ältesten und bis heute relevanten ökonomischen Theorien vor. Sie hebt die besondere Bedeutung der Theorie für die geldpolitische Praxis hervor, insbesondere im Kontext der Geldmengenziele von Zentralbanken wie der EZB. Die Einleitung kündigt den weiteren Aufbau der Arbeit an, der die geldpolitische Bedeutung der einzelnen Variablen, die dogmenhistorische Entwicklung und eine kritische Würdigung der Theorie umfasst.
2. Die geldpolitische Bedeutung: Dieses Kapitel untersucht die geldpolitische Bedeutung der Quantitätstheorie. Es erklärt die Cambridge-Gleichung und ihre Rolle bei der Bestimmung von Geldmengenzielen. Das Kapitel analysiert die Beziehungen zwischen Einkommen, Preisniveau, Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit. Es wird dargelegt, dass unter bestimmten Annahmen (konstantes Realeinkommen und kurzfristig konstante Umlaufgeschwindigkeit) die Geldmenge das Preisniveau determiniert – ein Kernelement des Monetarismus. Das Kapitel betont jedoch auch die Schwierigkeiten bei der empirischen Überprüfung dieser Annahmen und die Herausforderungen bei der Kontrolle der Geldmenge durch Notenbanken.
2.1 Einkommen und Preisniveau: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Güterseite der Quantitätsgleichung, repräsentiert durch das Produkt aus realem Einkommen und Preisniveau. Er diskutiert den Zusammenhang zwischen Inflation (Preisniveauanstieg) und monetärer Nachfrage. Es wird betont, dass bei konstantem Einkommen und Umlaufgeschwindigkeit ein Anstieg des Preisniveaus nur durch eine überproportionale Steigerung der Geldmenge erklärt werden kann. Die Auswirkungen von Inflation auf gesamtwirtschaftliche Größen werden angesprochen, wobei die Komplexität und Uneinigkeit in der ökonomischen Literatur zu diesem Thema hervorgehoben wird. Die Bedeutung von Preisstabilität als vorrangiges Ziel der Zentralbanken wird unterstrichen.
2.2 Die Geldmenge / Das Geldangebot: Dieser Abschnitt behandelt die Variable „Geldmenge“ (M) in der Quantitätsgleichung. Er erläutert die verschiedenen Definitionen der Geldmenge (z.B. M1, M3) und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Geldmenge und Geldkapital. Die Auswahl der geeigneten Geldmengendefinition hängt von der Nachweisbarkeit einer stabilen Geldnachfragefunktion ab. Der Abschnitt diskutiert die Herausforderungen der Geldmengenkontrolle durch die Notenbank, da die Geldmenge als Produkt aus monetärer Basis und Geldmultiplikator verstanden werden kann. Die Frage, ob die Notenbank beide Faktoren steuern kann, steht im Mittelpunkt der Diskussion.
2.3 Die Umlaufgeschwindigkeit / Die Geldnachfrage: Dieser Abschnitt beschreibt die Variable „Umlaufgeschwindigkeit“ (v) und den Kassehaltungskoeffizienten (k=1/v) in der Quantitätsgleichung. Um einen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau herzustellen, muss die Umlaufgeschwindigkeit entweder konstant oder als stabile Funktion nachweisbar sein. Die Untersuchung von Friedman und Schwartz zur Entwicklung der Umlaufgeschwindigkeit in den USA (1870-1960) wird erwähnt, die darauf hindeutet, dass die Umlaufgeschwindigkeit als stabile Funktion weniger Variablen erklärt werden kann.
Schlüsselwörter
Quantitätstheorie des Geldes, Geldpolitik, Geldmenge, Preisniveau, Umlaufgeschwindigkeit, Inflation, Monetarismus, Cambridge-Gleichung, Geldmengenziele, Notenbanken, EZB, dogmenhistorische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Quantitätstheorie des Geldes
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Quantitätstheorie des Geldes. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der geldpolitischen Bedeutung der Theorie, ihrer historischen Entwicklung und einer kritischen Würdigung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die geldpolitische Bedeutung (mit den Unterkapiteln 2.1 Einkommen und Preisniveau, 2.2 Die Geldmenge/Das Geldangebot, 2.3 Die Umlaufgeschwindigkeit/Die Geldnachfrage), 3. Dogmengeschichte und 4. Kritische Würdigung.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Arbeit untersucht die Quantitätstheorie des Geldes, ihre geldpolitische Relevanz, ihre historische Entwicklung und kritische Aspekte. Besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der Geldmenge und ihrer Beziehung zum Preisniveau gewidmet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die geldpolitische Relevanz der Quantitätstheorie, ihre historische Entwicklung, die Bedeutung der Geldmenge und des Preisniveaus, der Einfluss der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und eine kritische Bewertung der zugrundeliegenden Annahmen.
Was wird in Kapitel 2 ("Die geldpolitische Bedeutung") behandelt?
Kapitel 2 untersucht die geldpolitische Bedeutung der Quantitätstheorie, erklärt die Cambridge-Gleichung und analysiert die Beziehungen zwischen Einkommen, Preisniveau, Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau unter bestimmten Annahmen und diskutiert die Schwierigkeiten bei der empirischen Überprüfung dieser Annahmen und die Herausforderungen der Geldmengenkontrolle durch Notenbanken.
Was ist der Inhalt von Kapitel 2.1 ("Einkommen und Preisniveau")?
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Güterseite der Quantitätsgleichung und den Zusammenhang zwischen Inflation und monetärer Nachfrage. Es wird der Einfluss eines Anstiegs der Geldmenge auf das Preisniveau bei konstantem Einkommen und Umlaufgeschwindigkeit diskutiert, sowie die Auswirkungen von Inflation auf gesamtwirtschaftliche Größen.
Was wird in Kapitel 2.2 ("Die Geldmenge/Das Geldangebot") erläutert?
Kapitel 2.2 behandelt verschiedene Definitionen der Geldmenge (M1, M3 etc.), die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Geldmenge und Geldkapital und die Herausforderungen der Geldmengenkontrolle durch die Notenbank aufgrund des Geldmultiplikators.
Was ist der Fokus von Kapitel 2.3 ("Die Umlaufgeschwindigkeit/Die Geldnachfrage")?
Dieser Abschnitt beschreibt die Variable "Umlaufgeschwindigkeit" (v) und den Kassehaltungskoeffizienten (k=1/v) in der Quantitätsgleichung. Es wird die Bedeutung einer konstanten oder stabilen Umlaufgeschwindigkeit für den Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau diskutiert, und die Untersuchung von Friedman und Schwartz zur Entwicklung der Umlaufgeschwindigkeit in den USA wird erwähnt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Textes?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Quantitätstheorie des Geldes, Geldpolitik, Geldmenge, Preisniveau, Umlaufgeschwindigkeit, Inflation, Monetarismus, Cambridge-Gleichung, Geldmengenziele, Notenbanken, EZB, dogmenhistorische Entwicklung.
- Citation du texte
- Sandra Fritzsche (Auteur), 2003, Die Quantitätstheorie des Geldes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20986