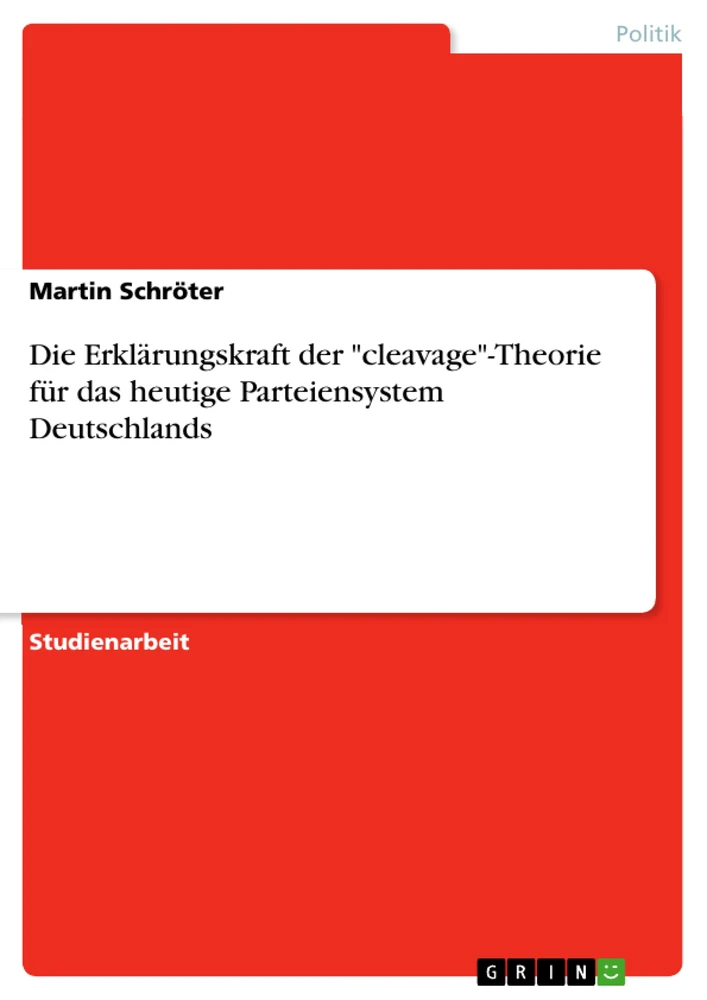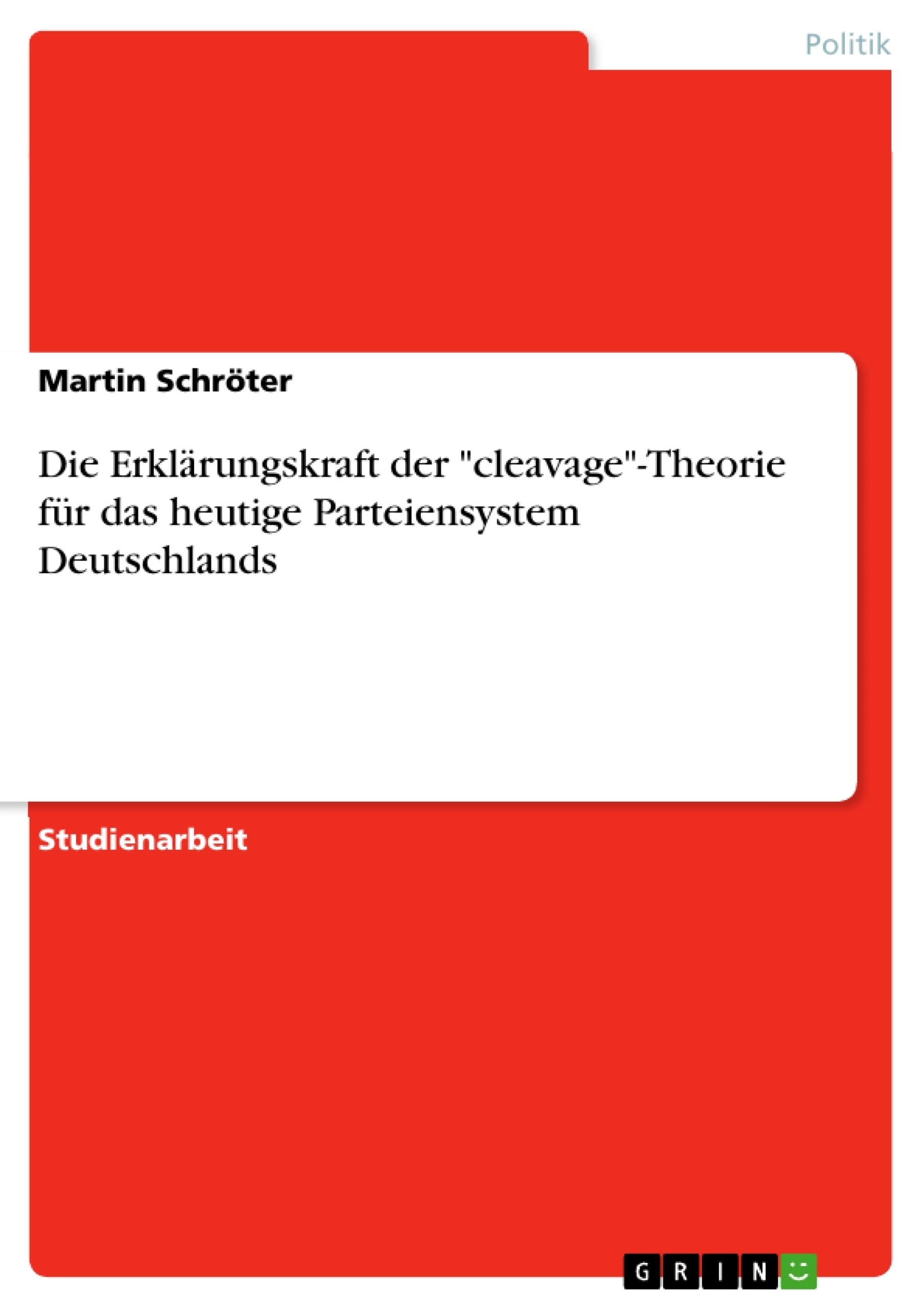Europäische Parteien und Parteiensysteme entstanden aufgrund tief greifender Konflikte („cleavages“) innerhalb europäischer Gesellschaften im 19.Jahrhundert. Dies ist die Hauptaussage der „cleavage“-Theorie, welche die Politikwissenschaftler Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan im Jahr 1967 in ihrem Aufsatz „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignment“ aufstellten. Mit diesem makrosoziologischen Ansatz bot die Politikwissenschaft für lange Zeit ein erfolgreiches Erklärungsmodell für die Entstehung von Parteien und Parteiensystemen in westeuropäischen Staaten. Heute jedoch wird die Gültigkeit dieser Theorie und deren Anwendbarkeit auf Parteiensysteme mehr als kritisch hinterfragt. Durch die Auflösung traditioneller Milieus und einer abnehmenden Parteibindung der Wähler verliert die „cleavage“-Theorie an Erklärungskraft. So kann sie beispielsweise weder das Auftreten von Parteien, die jenseits von diesen historischen „cleavages“ agieren, noch die hohe Bedeutung der Wechsel-, Protest- und Nichtwähler, erklären.
Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte dafür, dass sich die etablierten Parteien noch heute auf historische Konfliktlinien berufen, was sich in ihren Parteiprogrammen und in der Sozialstruktur ihrer Wählerschaft manifestiert.
Es stellt sich also die Frage in wie weit dieser makrosoziologische Ansatz einen ausreichenden Erklärungsansatz für das heutige Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland darstellt, in wie weit historische „cleavages“ ganz verschwunden sind oder möglicherweise sogar eine Renaissance erfahren. Dies ist die Aufgabe der folgenden Arbeit.
Zunächst werden daher die „cleavage“-Theorie und ihre grundlegenden Argumente dargestellt. Daraufhin wird die Kritik an diesem makrosoziologischen Ansatz aufgezeigt und die mögliche Entstehung neuer Konfliktlinien diskutiert.
Im Hauptteil der Arbeit werden die Parteiprogramme der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien sowie deren Wählerschaft hinsichtlich der Fragestellung analysiert.
In einem abschließenden Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und alternative, makrosoziologische Erklärungsversuche zur Analyse des heutigen Parteiensystems diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „cleavage“-Theorie nach Lipset und Rokkan
- 2.1 Definition
- 2.2 Die vier historischen Konfliktlinien
- Zentrum vs. Peripherie
- Staat vs. Kirche
- Stadt vs. Land
- Arbeit vs. Kapital
- 2.3 Kritik
- 2.4 „Neue“ Konfliktlinien?
- 3. Konfliktlinien im deutschen Parteiensystem
- 3.1 Geschichte
- 3.2 Parteiprogramme
- Staat vs. Kirche
- Arbeit vs. Kapital
- 3.3 Die Wählerschaft
- 4. Zusammenfassung / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erklärungskraft der „cleavage“-Theorie für das heutige Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland. Sie stellt zunächst die Theorie von Lipset und Rokkan vor und beleuchtet die historischen Konfliktlinien, die nach ihrer Ansicht die Entstehung von Parteiensystemen prägten. Anschließend wird die Kritik an der Theorie und die Frage nach neuen Konfliktlinien diskutiert. Der Hauptteil der Arbeit analysiert die Parteiprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien und die Sozialstruktur ihrer Wählerschaft im Hinblick auf die historischen Konfliktlinien. Im Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und alternative Erklärungsansätze für das heutige Parteiensystem betrachtet.
- Die „cleavage“-Theorie von Lipset und Rokkan und ihre Erklärungskraft für Parteiensysteme
- Die vier historischen Konfliktlinien: Zentrum vs. Peripherie, Staat vs. Kirche, Stadt vs. Land, Arbeit vs. Kapital
- Kritik an der „cleavage“-Theorie und die Frage nach neuen Konfliktlinien
- Analyse der Parteiprogramme und der Wählerschaft im Hinblick auf die historischen Konfliktlinien
- Alternative Erklärungsansätze für das heutige Parteiensystem in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die „cleavage“-Theorie von Lipset und Rokkan vor und erläutert ihre Bedeutung für die Analyse von Parteiensystemen. Sie stellt die zentrale Frage der Arbeit dar: Inwiefern bietet die Theorie noch eine ausreichende Erklärung für das heutige Parteiensystem in Deutschland?
2. Die „cleavage“-Theorie nach Lipset und Rokkan
Dieses Kapitel definiert den Begriff „cleavage“ und erläutert die drei Eigenschaften, die diese sozialen Spaltungen auszeichnen. Es werden die vier historischen Konfliktlinien (Zentrum vs. Peripherie, Staat vs. Kirche, Stadt vs. Land, Arbeit vs. Kapital) vorgestellt, die nach Lipset und Rokkan die Entstehung von Parteiensystemen in Westeuropa prägten.
3. Konfliktlinien im deutschen Parteiensystem
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit sich die historischen Konfliktlinien im deutschen Parteiensystem manifestieren. Es werden die Parteiprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien und die Sozialstruktur ihrer Wählerschaft im Hinblick auf die historischen Konfliktlinien analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „cleavage“-Theorie, Parteiensysteme, historische Konfliktlinien, politische Modernisierung, industrielle Revolution, Deutschland, Parteiprogramme, Wählerschaft, Makrosoziologie.
- Citar trabajo
- Martin Schröter (Autor), 2009, Die Erklärungskraft der "cleavage"-Theorie für das heutige Parteiensystem Deutschlands, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209603