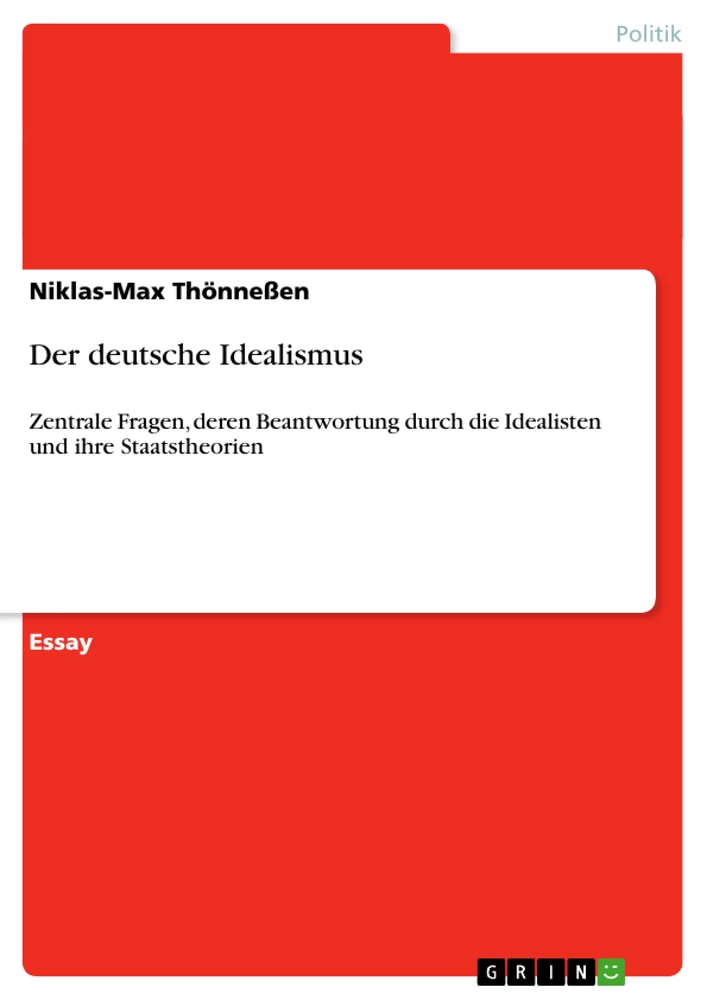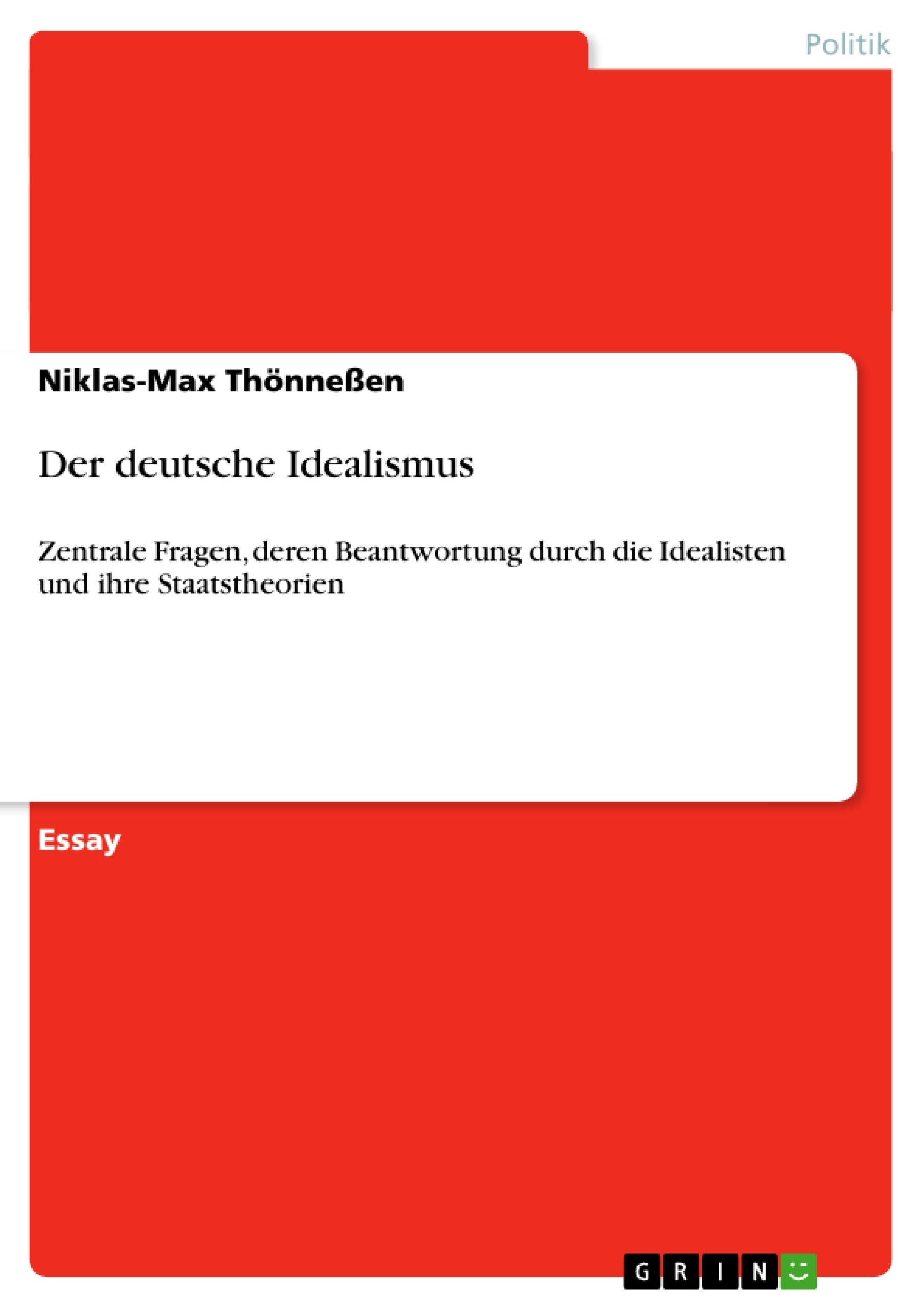„Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.“, schreibt Georg Friedrich Wilhelm Hegel in „Phänomenologie des Geistes“1. Und so setzt er in seinen Denksystemen, wie andere Philosophen des Deutschen Idealismus' auch, so wenig wie möglich als bekannt voraus und fragt nach der „Universalität des Logos“2. Sie hinterfragen die Wahrnehmung und dadurch die gegenständliche Welt selbst.
Zum Deutschen Idealismus zählt man den zitierten Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Johann Gottlieb Fichte. Strittig ist die Zuordnung Immanuel Kants. Einige Interpreten wie Rüdiger Bubner und Hans Jörg Sandkühler sehen auch Kant durch eine ähnliche Auswahl an bearbeiteten Themen als deutschen Idealisten. Ich würde mich aber dem Standpunkt von Gerhard Gamm anschließen und Kant lediglich als Ausgangs- und Anknüpfungspunkt der Deutschen Idealisten sehen.3 Die drei unstrittigen Denker beziehen sich zwar immer wieder auf Kant, führen sein Denken aber weiter.
Inhaltsverzeichnis
- Der Deutsche Idealismus
- Das Absolute
- Die Rolle des Absoluten bei Fichte
- Die Rolle des Absoluten bei Schelling
- Die Rolle des Absoluten bei Hegel
- Religion und Deutsche Idealisten
- Staatstheorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den Deutschen Idealismus, fokussiert auf die Konzepte des Absoluten und seine Manifestation bei Fichte, Schelling und Hegel. Die Rolle der Religion im Denken der Idealisten und deren Staatstheorien werden ebenfalls analysiert.
- Der Begriff des Deutschen Idealismus und seine ontologischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen
- Die unterschiedlichen Auffassungen des Absoluten bei Fichte, Schelling und Hegel
- Die Bedeutung der Religion für die Staatstheorien der Idealisten
- Ein Vergleich der Staatstheorien von Fichte und Hegel
- Die Rezeption des Deutschen Idealismus
Zusammenfassung der Kapitel
Der Deutsche Idealismus: Der Essay beginnt mit einer Begriffsklärung des „Deutschen Idealismus“, der als nachträgliche Bezeichnung durch Marx und Engels entstand. Er erläutert die ontologischen und erkenntnistheoretischen Implikationen des Idealismus im Gegensatz zum Materialismus, wobei die zentrale Frage nach dem Absoluten im Mittelpunkt steht – dem Gesamten der Welt, das Endliches und Unendliches verbindet. Die Einordnung Kants in diese Strömung wird diskutiert, wobei der Fokus auf Hegel, Schelling und Fichte liegt, deren Theorien, trotz Parallelen, zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen führen.
Das Absolute: Dieses Kapitel untersucht die Suche nach dem Absoluten bei den drei Hauptvertretern des Deutschen Idealismus. Es werden die unterschiedlichen Wege und Interpretationen des Absoluten vorgestellt, ohne jedoch bereits die jeweiligen Schlussfolgerungen vorwegzunehmen.
Die Rolle des Absoluten bei Fichte: Fichtes Auffassung vom Absoluten wird detailliert dargestellt, beginnend mit seiner frühen Vorstellung des Absoluten im individuellen Ich und dessen Setzung des Nicht-Ich. Spätere Modifikationen seiner Theorie, die das Absolute als transzendentale Instanz einbeziehen, werden ebenfalls erläutert, wobei der Fokus auf der Manifestation des Absoluten im Handeln des Individuums liegt.
Die Rolle des Absoluten bei Schelling: Schellings Suche nach dem Absoluten wird als Streben nach etwas Unbedingtem beschrieben, das in der absoluten Identität von Ich und Natur liegt. Die Rolle der menschlichen Freiheit im Kontext des Absoluten wird beleuchtet, wobei betont wird, dass Schelling das Absolute nicht im Individuum, sondern in der Freiheit der Menschheit sieht.
Die Rolle des Absoluten bei Hegel: Hegels dialektische Sichtweise des Absoluten, die die Dualismus-Vorstellung Kants mit der Subjektivität Fichtes verbindet, wird dargestellt. Der Prozess der Annäherung und Veränderung von Subjekt und Objekt in der Anschauung der Substanz wird erklärt, wobei das Absolute als ein Objekt außerhalb dieser Relationen beschrieben wird, das nur an sich ist.
Religion und Deutsche Idealisten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Vorwürfen des Atheismus, die den deutschen Idealisten gemacht wurden, und untersucht die Rolle der Religion in ihren Philosophien. Hegels Kritik am Christentum und seine Sicht auf die Religion als Grundlage des Sittlichen und des Staates werden detailliert analysiert, ebenso wie Fichtes und Schellings Auffassungen von Gott und dessen Beziehung zum Absoluten.
Staatstheorien: Abschließend werden die Staatstheorien von Fichte und Hegel verglichen. Fichtes „Geschlossener Handelsstaat“ mit seinen sozialistischen Zügen und zentralistischer Wirtschaftsplanung wird im Detail beschrieben, während Hegels Staatsauffassung nur kurz angerissen wird, da der Fokus auf dem Vergleich der beiden Hauptvertreter liegt.
Schlüsselwörter
Deutscher Idealismus, Absolutes, Fichte, Schelling, Hegel, Religion, Staatsphilosophie, Freiheit, Subjekt, Objekt, Dialektik, Identität, Autarkie, Planwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen zum Deutschen Idealismus
Was ist der Inhalt dieses Essays zum Deutschen Idealismus?
Dieser Essay bietet einen umfassenden Überblick über den Deutschen Idealismus, mit Fokus auf die Konzepte des Absoluten bei Fichte, Schelling und Hegel. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Rolle der Religion im Denken der Idealisten und deren Staatstheorien werden ebenfalls behandelt. Der Essay beginnt mit einer Begriffsklärung des Deutschen Idealismus und seiner ontologischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen, bevor er detailliert auf die Auffassungen des Absoluten bei den drei Hauptvertretern eingeht. Ein Vergleich der Staatstheorien von Fichte und Hegel bildet den Abschluss.
Was versteht der Essay unter "Deutschem Idealismus"?
Der Essay erklärt den "Deutschen Idealismus" als nachträgliche Bezeichnung, geprägt von Marx und Engels. Er erläutert die ontologischen und erkenntnistheoretischen Implikationen des Idealismus im Gegensatz zum Materialismus. Die zentrale Frage ist die nach dem Absoluten – dem Gesamten der Welt, das Endliches und Unendliches verbindet. Kants Einordnung in diese Strömung wird diskutiert, der Fokus liegt jedoch auf Hegel, Schelling und Fichte.
Wie wird das "Absolute" im Essay definiert und behandelt?
Das "Absolute" wird als zentrales Konzept des Deutschen Idealismus vorgestellt. Der Essay untersucht die unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen des Absoluten bei Fichte, Schelling und Hegel. Er beschreibt die Suche nach dem Unbedingten und die verschiedenen Wege, wie die drei Denker dieses Konzept interpretieren und in ihren Philosophien manifestieren, ohne die Schlussfolgerungen vorwegzunehmen.
Wie wird Fichtes Auffassung vom Absoluten dargestellt?
Fichtes Auffassung vom Absoluten wird detailliert dargestellt, beginnend mit seiner frühen Vorstellung des Absoluten im individuellen Ich und dessen Setzung des Nicht-Ich. Spätere Modifikationen seiner Theorie, die das Absolute als transzendentale Instanz einbeziehen, werden erläutert. Der Fokus liegt auf der Manifestation des Absoluten im Handeln des Individuums.
Wie wird Schellings Auffassung vom Absoluten dargestellt?
Schellings Suche nach dem Absoluten wird als Streben nach etwas Unbedingtem beschrieben, das in der absoluten Identität von Ich und Natur liegt. Die Rolle der menschlichen Freiheit im Kontext des Absoluten wird beleuchtet. Schelling sieht das Absolute nicht im Individuum, sondern in der Freiheit der Menschheit.
Wie wird Hegels Auffassung vom Absoluten dargestellt?
Hegels dialektische Sichtweise des Absoluten wird dargestellt, die die Dualismus-Vorstellung Kants mit der Subjektivität Fichtes verbindet. Der Prozess der Annäherung und Veränderung von Subjekt und Objekt in der Anschauung der Substanz wird erklärt. Das Absolute wird als ein Objekt außerhalb dieser Relationen beschrieben, das nur an sich ist.
Welche Rolle spielt die Religion im Deutschen Idealismus?
Der Essay thematisiert die Vorwürfe des Atheismus gegen die deutschen Idealisten und untersucht die Rolle der Religion in ihren Philosophien. Hegels Kritik am Christentum und seine Sicht auf die Religion als Grundlage des Sittlichen und des Staates werden detailliert analysiert. Ebenso werden Fichtes und Schellings Auffassungen von Gott und dessen Beziehung zum Absoluten beleuchtet.
Wie werden die Staatstheorien der deutschen Idealisten behandelt?
Der Essay vergleicht die Staatstheorien von Fichte und Hegel. Fichtes „Geschlossener Handelsstaat“ mit seinen sozialistischen Zügen und zentralistischer Wirtschaftsplanung wird detailliert beschrieben. Hegels Staatsauffassung wird nur kurz angerissen, da der Fokus auf dem Vergleich der beiden Hauptvertreter liegt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter des Essays sind: Deutscher Idealismus, Absolutes, Fichte, Schelling, Hegel, Religion, Staatsphilosophie, Freiheit, Subjekt, Objekt, Dialektik, Identität, Autarkie, Planwirtschaft.
- Quote paper
- Niklas-Max Thönneßen (Author), 2012, Der deutsche Idealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208759