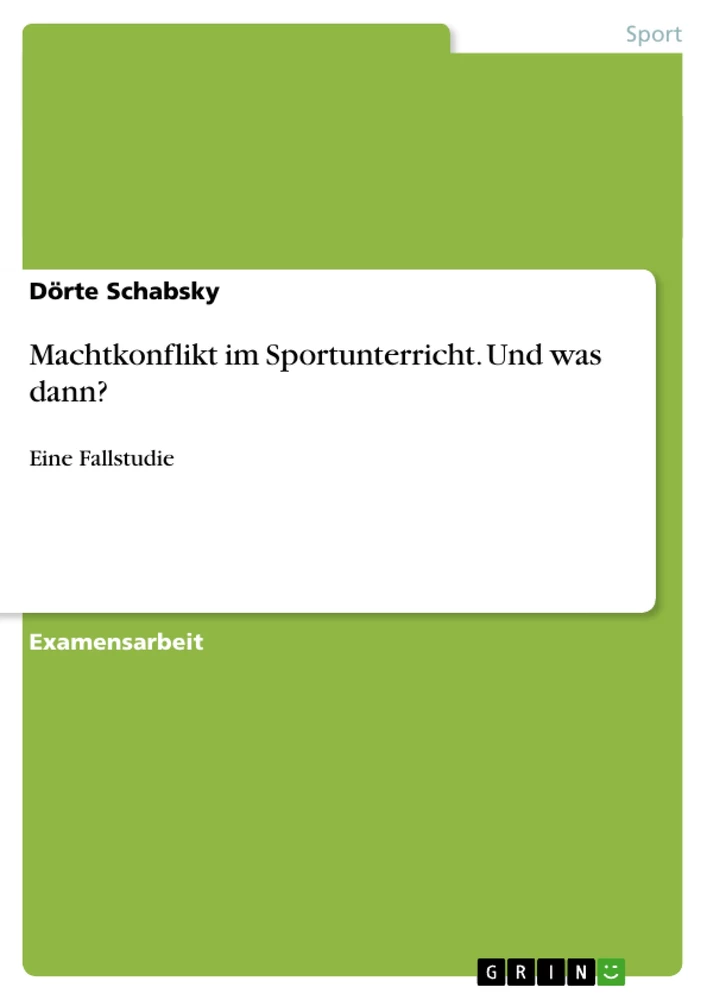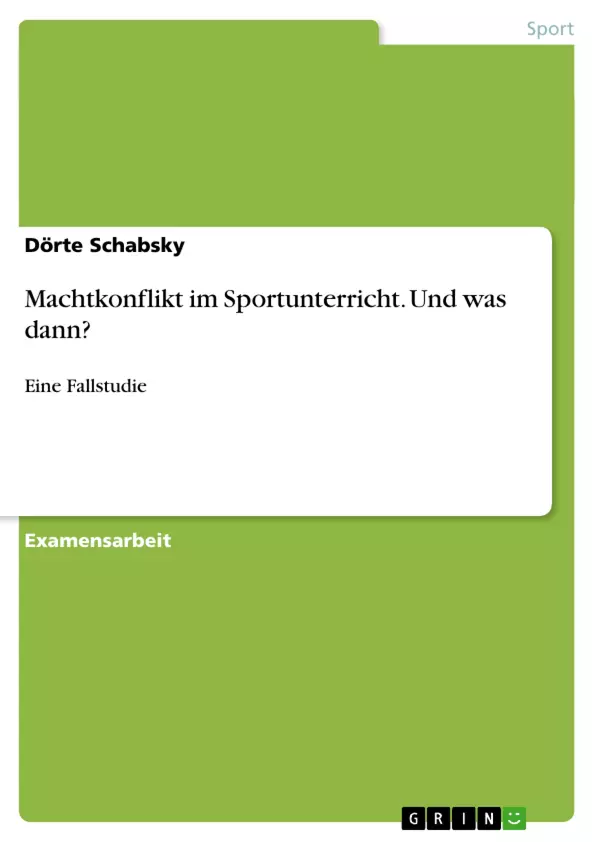Der Machtkampf ist ein Phänomen, dass laut Frau Dr. med. Davatz in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen immer noch sehr verbreitet ist.
In der sportdidaktischen Literatur finden sich nur sehr wenige Quellen, die sich explizit mit dem Thema Machtkampf beschäftigen (z.B. Scherler, 2000). Allgemein scheint dies daran zu liegen, dass es sich hierbei um ein Tabuthema bei Pädagogen handelt: „Machtkämpfe hat man einfach nicht.“
Aus diesem Grund wird für die Erklärung der Entstehung von Machtkämpfen auf die Texte von Bräutigam, Miethling, Scherler & Schirtz, Sieland und Werning zurückgegriffen und auf Anleihen aus der Erziehungswissenschaft und der Sozialwissenschaft, die sich bereits näher mit dem Thema der Machtkämpfe beschäftigt haben. Das soziale Phänomen „Machtkampf“ – oder „Machtkonflikt“ – ist in der Sozialwissenschaft bereits als Teil einer Konflikttheorie von H. Messmer dargestellt worden. Diese globale, sozialprozessorientierte Theorie wird auf den Sportunterricht übertragen werden. Eine scharfe Abgrenzung des Begriffes „Machtkampf“ ist sehr schwierig, weil jeder individuell definiert, wann er sich gestört fühlt und wann für ihn ein Machtkonflikt anfängt. Um diese Definitionsproblematik zu umgehen wird daher grundlegend die Definition des „Machtkonfliktes“ vom Messmer verwendet werden.
Doch auch in sportwissenschaftlichen Texten finden sich Andeutungen darüber, dass Unterrichtsstörungen, d.h. Konflikte im Unterricht, sich zu Machtkonflikten entwickeln können.
Besagte Konflikte können entweder durch eine Win-Win-Lösung beigelegt werden, bei der sowohl Lehrer als auch Schüler ohne Gesichtsverlust den Konflikt beenden können oder sie werden durch Eskalation zu einem Machtkampf, welcher eigentlich nur durch eine Win-Lose-Lösung beendet werden kann. Daher sollten Lehrer bemüht sein zum einen Machtkämpfe grundsätzlich zu vermeiden und zum anderen, wenn dies nicht möglich ist, eine möglichst akzeptable Lösung für beide Seiten zu finden. Wie derartige Lösungsmöglichkeiten aussehen können, wurde bisher nicht erforscht, es kursieren lediglich „präventive Tipps“.
Daher verfolgt diese Arbeit die Forschungsfrage: Welches Lehrerverhalten kann in einem Machtkonflikt einen glimpflichen Verlauf und Ausgang ermöglichen?
Um auf diesen bisher unerforschten Bereich der Sportwissenschaft ein erstes Licht zu werfen wurden Daten durch Experteninterviews mit fünf Sportlehrern von einem Gymnasium erhoben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bisherige Antworten zur Thematik
- 2.1 Theorie
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Wie entstehen Machtkonflikte
- 2.1.3 Folgen für die Beteiligten
- 2.1.4 Vorschläge zur Prävention und Bewältigung
- 2.2 Empirie
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Entwicklung und Formulierung der Fragestellung
- 3.2 Auswahl und Begründung der Erhebungsmethode und des Erhebungsinstrumentes
- 3.3 Beschreibung und Begründung der Untersuchungsdurchführung
- 3.4 Zusammenfassung des Interviews A
- 3.5 Zusammenfassung Interviews B
- 3.6 Zusammenfassung des Interviews C
- 3.7 Zusammenfassung des Interviews D
- 3.8 Zusammenfassung des Interviews E
- 3.9 Interpretation
- 3.10 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.11 Methodenkritische Reflexion
- 4 Reflexion und Rückbezug zur Theorie
- 5 Fazit
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Machtkonflikt“
- Ursachen und Verlauf von Machtkonflikten im Sportunterricht
- Folgen von Machtkonflikten für Lehrer und Schüler
- Mögliche Strategien zur Prävention und Bewältigung von Machtkonflikten
- Empirische Analyse von Fallbeispielen aus dem Sportunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Fallstudie untersucht das Phänomen von Machtkonflikten im Sportunterricht. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Entstehung, den Verlauf und die Folgen von Machtkonflikten im Kontext von Schule und Sportunterricht zu gewinnen. Zudem soll die Studie Aufschluss darüber geben, wie Lehrer mit Machtkonflikten im Sportunterricht umgehen und welche Strategien sich als hilfreich erweisen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problematik von Machtkonflikten im Sportunterricht vor und beleuchtet den Widerspruch zwischen der gängigen Lehrersicht und der tatsächlichen Häufigkeit von Machtkonflikten. Es wird zudem auf die Bedeutung des Themas im Kontext von Lehrer-Schüler-Beziehungen eingegangen. Kapitel 2 fasst den bisherigen Forschungsstand zur Thematik zusammen, sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht. Kapitel 3 präsentiert die empirische Untersuchung, die mit Hilfe von Interviews mit fünf Sportlehrern durchgeführt wurde. Die Darstellung und Auswertung der Interviews wird in den Kapiteln 3.4 bis 3.10 vorgestellt. Schließlich werden im letzten Abschnitt der Arbeit, Kapitel 4, Schlussfolgerungen aus den Interviews gezogen und in den Kontext des bisherigen theoretischen und empirischen Wissens gestellt.
Schlüsselwörter
Machtkonflikt, Sportunterricht, Lehrer-Schüler-Beziehung, Autorität, Prävention, Bewältigung, Empirie, Fallstudie, Interview, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem Machtkonflikt im Sportunterricht?
Ein Machtkonflikt entsteht, wenn Lehrer und Schüler in eine Eskalationsspirale geraten, in der es nicht mehr um die Sache, sondern um das Durchsetzen der eigenen Position und den Erhalt des „Gesichts“ geht.
Warum ist das Thema Machtkampf bei Pädagogen oft ein Tabu?
Viele Lehrer haben den Anspruch, solche Konflikte durch ihre Autorität gar nicht erst entstehen zu lassen. Ein Machtkampf wird daher oft fälschlicherweise als persönliches Versagen gewertet.
Wie können Lehrer Machtkämpfe grundsätzlich vermeiden?
Präventive Strategien umfassen eine klare Beziehungsarbeit, transparente Regeln, Deeskalationstechniken und das Anbieten von „Win-Win-Lösungen“, bei denen keine Seite ihr Gesicht verliert.
Welches Lehrerverhalten hilft in einem akuten Machtkonflikt?
Experteninterviews zeigen, dass Ruhe bewahren, den Konflikt aus der Öffentlichkeit der Klasse nehmen und das Reflektieren der eigenen Rolle einen glimpflichen Ausgang ermöglichen können.
Was ist eine „Win-Lose-Lösung“?
Dies ist ein Ausgang, bei dem eine Partei (meist der Lehrer durch Sanktionen) gewinnt und die andere Partei gedemütigt wird, was oft zu langfristigen Störungen der Lehrer-Schüler-Beziehung führt.
- Arbeit zitieren
- Dörte Schabsky (Autor:in), 2009, Machtkonflikt im Sportunterricht. Und was dann?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207990