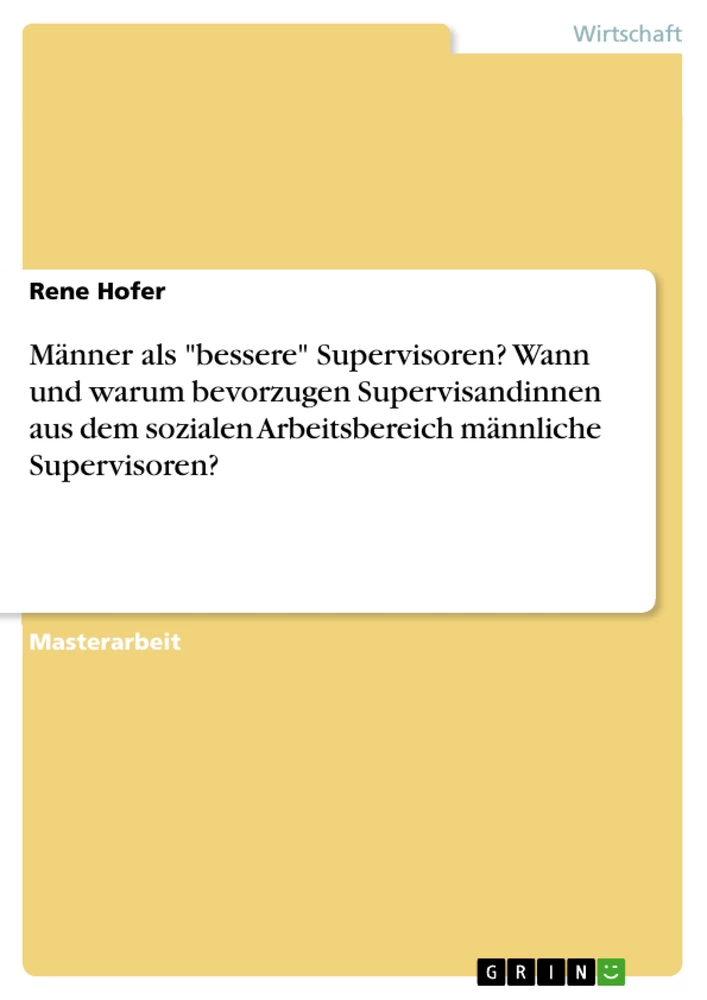Ziel dieser Masterthesis soll sein, einen Blick darauf zu werfen für welche Anlässe, in welchen Bereichen und zu welchen Thematiken weibliche Supervisandinnen aus dem sozialen
Arbeitsfeld einen männlichen Supervisor bevorzugen. Dabei werden Auswahlkriterien, entsprechende Rahmenbedingungen, sowie die Settingwahl beleuchtet und Erkenntnisse aus dem Vorgespräch, wie auch die Erwartungen an den Supervisionsprozess und im Zusammenhang damit eine Kompetenz- und Rollenzuschreibung als auch Stereotype
hinsichtlich der Geschlechtlichkeit bzw. der Geschlechtsunterschiede hinterfragt. Des Weiteren werden die Bereiche der Kommunikation, des Konkurrenzverhaltens, der Akzeptanz und der Einflussnahme von Übertragung und Gegenübertragung, wie auch geschlechtsspezifische Arbeitsinhalte und Methoden sowie erotische Spannungen im
Supervisionsprozess begutachtet.
Mit Hilfe qualitativer Interviews wurden acht Supervisandinnen mit und ohne Leitungsfunktion sowie einem Berufseinstiegsdatum vor und nach dem seit 1999 in Kraft
getretenen Gendermainstream aus dem Bereich der sozialen Arbeit befragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen in erster Linie, dass männliche Supervisoren im Besonderen
bevorzugt werden, wenn es darum geht weibliche Supervisionteilnehmerinne in Fallsupervisionen dahingehend zu begleiten, eine männliche Außenansicht darzustellen. Auch
hinsichtlich der in Anspruchnahme von Coaching durch Supervisandinnen mit Leitungsfunktion zeigt sich, dass diese zumindest auch die Begleitung eines männlichen Coaches in Anspruch nehmen und sich die dem männlichen Supervisor zugeschriebene Arbeitsweise wie beispielsweise eine entsprechende Zielorientiertheit, so wie Klarheit und Distanz im Supervisionsprozess zu Eigen machen. Ansonsten gilt es aus ganz persönlichen und individuellen Gründen heraus einen männlichen Supervisor für das Supervisionssetting zu engagieren.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung
- Abstrakt
- Abstract
- Einleitung
- Stellungnahme zur Fragestellung
- Hypothesen und Forschungsfragen
- Ziele der Arbeit
- Methodik
- Qualitative Forschung
- Interviews als Methode
- Interviewleitfaden
- Stichprobenbeschreibung
- Methodischer Rahmen
- Abgrenzung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Rahmen
- Supervision als Handlungsfeld
- Supervision aus unterschiedlichen Perspektiven
- Methoden der Supervision
- Theoretische Ansätze
- Supervision als Prozess
- Supervision im sozialen Arbeitsfeld
- Geschlechterrollen und stereotype Denkmuster
- Gendermainstream als Herausforderung im sozialen Arbeitsfeld
- Ergebnisse
- Interviewdaten
- Analyse der Interviews
- Ergebnisse der Interviews
- Auswahlkriterien für den Supervisor
- Geschlecht des Supervisors
- Rahmenbedingungen und Settingwahl
- Erwartungen an den Supervisionsprozess
- Kompetenz- und Rollenzuschreibung
- Stereotype
- Kommunikation
- Konkurrenzverhalten
- Akzeptanz
- Einflussnahme von Übertragung und Gegenübertragung
- Geschlechtsspezifische Arbeitsinhalte und Methoden
- Erotische Spannungen im Supervisionsprozess
- Diskussion
- Bedeutung der Ergebnisse
- Einfluss auf die Praxis
- Fortführung der Forschung
- Kritik und Limitationen
- Zusammenfassende Schlussfolgerung
- Literatur
- Bedeutung des Geschlechts des Supervisors im Kontext der Supervision
- Einfluss von Genderrollen und Stereotypen auf die Auswahl des Supervisors
- Analyse von Erwartungen an den Supervisionsprozess und die Rolle des Supervisors
- Untersuchung von Kommunikation, Konkurrenzverhalten und Akzeptanz im Supervisionsprozess
- Bedeutung von Übertragung und Gegenübertragung in Bezug auf das Geschlecht des Supervisors
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterthesis beleuchtet die Präferenz von weiblichen Supervisandinnen aus dem sozialen Arbeitsfeld für männliche Supervisoren. Sie untersucht die Gründe, die zu dieser Präferenz führen, und analysiert die spezifischen Rahmenbedingungen und Situationen, in denen diese Präferenz auftritt. Die Arbeit analysiert dabei Auswahlkriterien, Erwartungen an den Supervisionsprozess, Kompetenz- und Rollenzuschreibungen, stereotype Denkmuster sowie die Auswirkungen von Übertragung und Gegenübertragung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Einleitung, in der die Forschungsfrage, die Hypothesen und die Ziele der Arbeit definiert werden. Die Methodik der Arbeit wird erläutert, die sich auf qualitative Interviews mit Supervisandinnen aus dem sozialen Arbeitsfeld stützt. Der theoretische Rahmen der Arbeit umfasst eine umfassende Auseinandersetzung mit Supervision als Handlungsfeld, dem Supervisionsprozess und der Bedeutung des sozialen Arbeitsfeldes im Kontext von Genderrollen und Stereotypen.
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Interviews und analysiert die gewonnenen Daten. Es werden Auswahlkriterien, Erwartungen an den Supervisionsprozess, Kompetenz- und Rollenzuschreibungen, Kommunikation, Konkurrenzverhalten, Akzeptanz und die Auswirkungen von Übertragung und Gegenübertragung untersucht.
Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse, die die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und die Fortführung der Forschung thematisiert. Kritik und Limitationen der Arbeit werden ebenfalls angesprochen, bevor die Arbeit mit einer zusammenfassenden Schlussfolgerung endet.
Schlüsselwörter
Supervision, Supervisandinnen, männliche Supervisoren, soziales Arbeitsfeld, Genderrollen, Stereotype, Auswahlkriterien, Erwartungen, Kompetenz- und Rollenzuschreibung, Übertragung und Gegenübertragung, Kommunikation, Konkurrenzverhalten, Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen zu männlichen Supervisoren
Warum bevorzugen manche Supervisandinnen männliche Supervisoren?
Oft wird eine „männliche Außenansicht“ gesucht, besonders in der Fallsupervision. Männlichen Supervisoren werden zudem häufig Eigenschaften wie Zielorientiertheit, Klarheit und Distanz zugeschrieben.
Welche Rolle spielen Geschlechterstereotype bei der Auswahl?
Stereotype Vorstellungen über männliche und weibliche Arbeitsweisen beeinflussen die Erwartungen an den Prozess und die Kompetenzzuschreibung an den Supervisor.
Was ist der Einfluss von Gender Mainstreaming in der sozialen Arbeit?
Seit 1999 ist Gender Mainstreaming gesetzlich verankert. Es fordert eine bewusste Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf professionelle Beziehungen.
Was bedeuten Übertragung und Gegenübertragung in der Supervision?
Dies sind psychologische Prozesse, bei denen Gefühle aus früheren Beziehungen unbewusst auf den Supervisor übertragen werden, was durch das Geschlecht beeinflusst werden kann.
Gibt es erotische Spannungen im Supervisionsprozess?
Die Arbeit untersucht auch, inwieweit geschlechtsspezifische Spannungen oder erotische Untertöne den Prozess und die Akzeptanz des Supervisors beeinflussen können.
- Quote paper
- Rene Hofer (Author), 2012, Männer als "bessere" Supervisoren? Wann und warum bevorzugen Supervisandinnen aus dem sozialen Arbeitsbereich männliche Supervisoren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207795