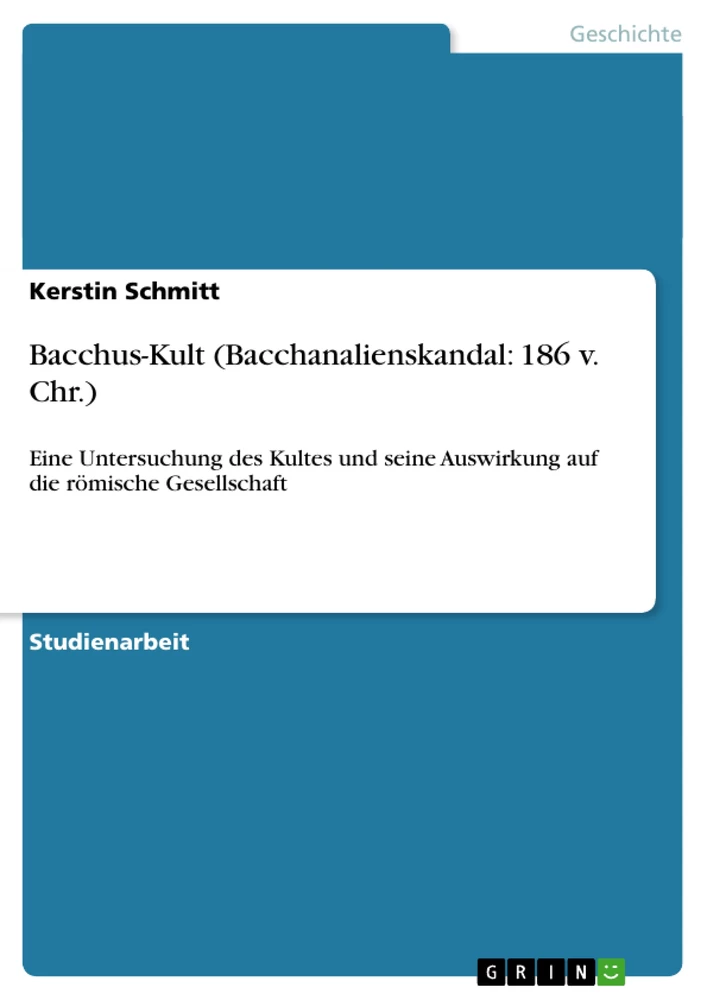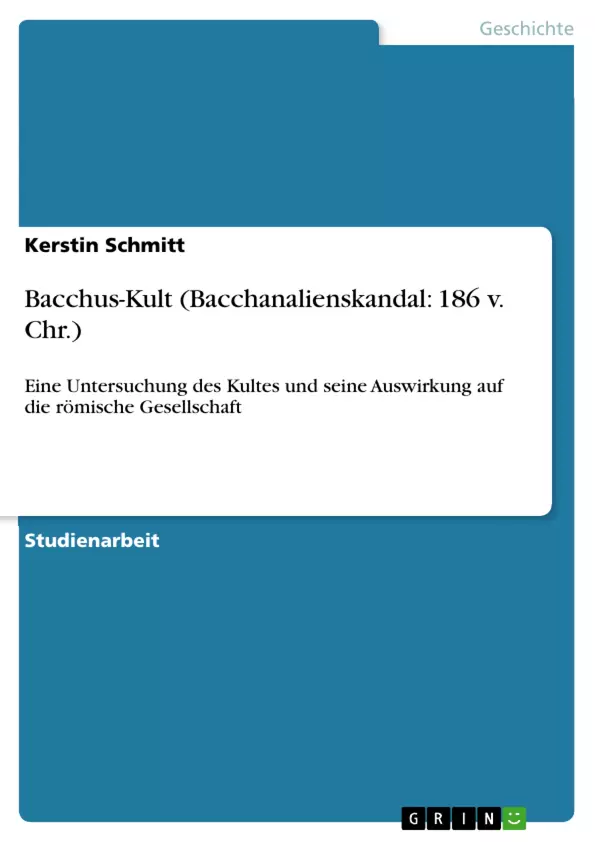Ein religiöser Kult entspricht nicht der Norm (in Ausmaßen und ekstatischen Wesen) und sprengt den Rahmen der Gesellschaft. Die Regierung ist im Zugzwang diese (religiösen) Auswüchse als gefährdend zu identifizieren. Ein Kult wird zur Gefährdung der Staatssicherheit und dies verlangt nach Kontrolle und Überwachung.
Diese Arbeit untersucht den Kult der Gottheit Bacchus anhand seiner Herkunft, Verbreitung und Verfolgung in Rom. Hinführend zur Thematik – der Verfolgung und des Verbotes des Bacchus-Kultes – werden die Verbindungen von Bacchus und den Gottheiten Dionysos und Liber untersucht. Dabei wird die Ikongraphie von Dionysos und Bacchus auf Gemeinsamkeiten sowie wesentliche Unterschiede hin betrachtet und nachfolgend die Mythologie des Dionysos in Bezug zu Bacchus und ihrem verehrenden Gefolge gesetzt.
Der Hauptbestandteil dieser Arbeit liegt in der kritischen Auseinandersetzung mit den überlieferten Quellen des Titus Livus und einem Senatsbeschluss aus dem Jahr 186 vor Christus. Im Zentrum der Untersuchung steht die Überlegung nach der Radikalität des Kultes und der Regierung. Gleichfalls soll untersucht werden, ob die Negation der Bacchanalien berechtigt und ‚maßvoll’ vollzogen wurde oder ob der Bacchanalienskandal eine staatliche Verschwörung darstellte und folglich eine (religiöse) Säuberung von diesem fremden Kult implizierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Bacchus: Gottheit und Kult
- Bacchischer Geheimkult: Herkunft und Praxis
- Ikonographie: Bacchus und Dionysos
- Dionysos: eine Verbindung zum Bacchus-Kult
- Bacchus: (s)ein Kult in Rom
- Die (Schreib-)Haltung des Titus Livius bezüglich des Bacchus-Kultes
- Der Bacchanalienskandal nach Titus Livius
- Die Reaktion des Staates: Senatus consultum de Bacchanalibus
- Der Senatsbeschluss: Analyse und Folgen
- Das Überleben des Bacchus-Kultes
- Die (Schreib-)Haltung des Titus Livius bezüglich des Bacchus-Kultes
- Resümee: ein bacchantischer Sturm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Bacchus-Kult im römischen Reich, seine Ursprünge, Verbreitung und die staatliche Reaktion auf ihn, insbesondere den Bacchanalienskandal von 186 v. Chr. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse der Quellen, insbesondere der Schriften von Titus Livius und des Senatsbeschlusses. Es wird die Frage nach der Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der staatlichen Maßnahmen untersucht.
- Die Ursprünge und Praxis des bacchischen Geheimkultes
- Die Verbindungen zwischen Bacchus, Dionysos und Liber
- Die Darstellung des Bacchus-Kultes bei Titus Livius
- Der Bacchanalienskandal und der Senatsbeschluss
- Die staatliche Reaktion auf den Kult und dessen Überleben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte: Die Einleitung skizziert die Thematik der Arbeit: die Untersuchung des Bacchus-Kultes in Rom, dessen Verfolgung und Verbot, und die Verbindungen zu Dionysos und Liber. Sie betont die Bedeutung des Kultes als Herausforderung für die römische Staatsgewalt und kündigt eine kritische Auseinandersetzung mit den Quellen an, insbesondere mit Titus Livius und dem Senatsbeschluss von 186 v. Chr. Die Arbeit befasst sich mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit der staatlichen Reaktion auf den Kult.
Bacchus: Gottheit und Kult: Dieses Kapitel identifiziert Bacchus als das römische Äquivalent des griechischen Dionysos, wobei die frühere Bezeichnung als Epiklese des Fruchtbarkeitsgottes betont wird. Es erörtert die weitere Verbindung mit der altitalischen Gottheit Liber und dessen Rolle innerhalb der römischen Religion. Das Kapitel beleuchtet die Verschmelzung der Gottheiten und die Ausbreitung des bacchischen Kultes in Rom, der durch seine orgiastischen und sexuell überschreitenden Elemente die etablierten römischen religiösen Vorstellungen herausforderte.
Bacchus: (s)ein Kult in Rom: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Bacchus-Kultes bei Titus Livius, insbesondere im Kontext des Bacchanalienskandals von 186 v. Chr. Es untersucht den Senatsbeschluss als Reaktion auf den Skandal und dessen Auswirkungen auf den Kult. Die Analyse umfasst eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage nach der Legitimität und Verhältnismäßigkeit der staatlichen Maßnahmen sowie dem weiteren Bestehen des Bacchus-Kultes trotz des Verbotes.
Schlüsselwörter
Bacchus, Dionysos, Liber, Bacchanalien, Bacchanalienskandal, römische Religion, Titus Livius, Senatsbeschluss, Geheimkult, Staatsgewalt, Religionspolitik, Fruchtbarkeitskult, orgiastische Rituale.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Bacchus: (s)ein Kult in Rom"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Bacchus-Kult im römischen Reich, seine Ursprünge, Verbreitung und die staatliche Reaktion darauf, insbesondere den Bacchanalienskandal von 186 v. Chr. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse der Quellen, vor allem Titus Livius und des Senatsbeschlusses. Es wird die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der staatlichen Maßnahmen hinterfragt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursprünge und Praktiken des bacchischen Geheimkultes, die Verbindungen zwischen Bacchus, Dionysos und Liber, die Darstellung des Kultes bei Titus Livius, den Bacchanalienskandal und den Senatsbeschluss, sowie die staatliche Reaktion auf den Kult und sein Überleben trotz des Verbots.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beginnt mit einleitenden Worten, die die Thematik und die methodische Vorgehensweise skizzieren. Das zweite Kapitel beschreibt Bacchus als Gottheit und seinen Kult, einschließlich seiner Verbindungen zu Dionysos und Liber. Das dritte Kapitel analysiert den Bacchus-Kult in Rom, insbesondere im Kontext des Bacchanalienskandals und des Senatsbeschlusses, unter Einbeziehung einer kritischen Betrachtung der staatlichen Maßnahmen und des Fortbestandes des Kultes.
Wer ist Titus Livius und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Titus Livius ist ein wichtiger römischer Historiker. Seine Schriften, insbesondere seine Darstellung des Bacchanalienskandals, bilden eine zentrale Quelle für die Untersuchung des Bacchus-Kultes in dieser Arbeit. Seine Sichtweise und die Interpretation seiner Texte werden kritisch analysiert.
Was war der Bacchanalienskandal und welche Folgen hatte er?
Der Bacchanalienskandal von 186 v. Chr. war ein Ereignis, das mit ausschweifenden und geheimnisvollen Ritualen des Bacchus-Kultes in Verbindung gebracht wird und zu einer staatlichen Intervention führte. Der Senatsbeschluss, der darauf folgte, untersagte den Kult und hatte weitreichende Folgen für dessen Ausübung, obwohl der Kult letztendlich nicht vollständig ausgelöscht werden konnte. Die Arbeit untersucht die Details des Skandals und die Gründe für die staatliche Reaktion.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bacchus, Dionysos, Liber, Bacchanalien, Bacchanalienskandal, römische Religion, Titus Livius, Senatsbeschluss, Geheimkult, Staatsgewalt, Religionspolitik, Fruchtbarkeitskult, orgiastische Rituale.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Schriften von Titus Livius und den Senatsbeschluss (Senatus consultum de Bacchanalibus) von 186 v. Chr. Diese Quellen werden kritisch analysiert und interpretiert.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung der Arbeit ist die Untersuchung der Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der staatlichen Reaktion auf den Bacchus-Kult im Kontext des Bacchanalienskandals. Es wird hinterfragt, wie die römische Staatsgewalt mit einer religiösen Bewegung umging, die als Bedrohung für die soziale Ordnung empfunden wurde.
- Citation du texte
- Kerstin Schmitt (Auteur), 2010, Bacchus-Kult (Bacchanalienskandal: 186 v. Chr.), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207319