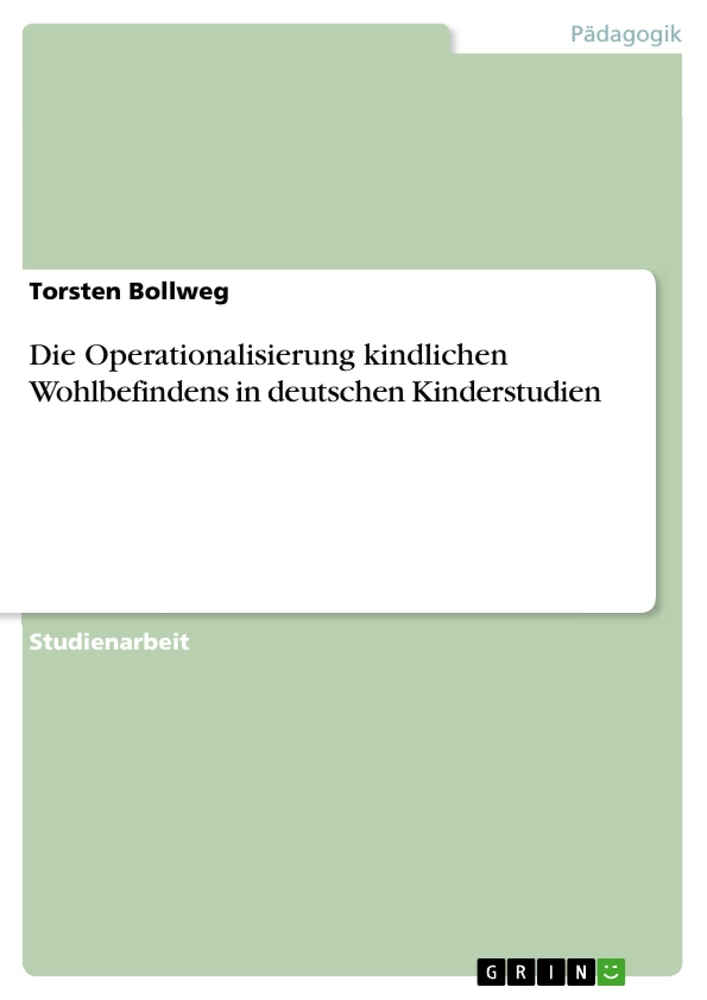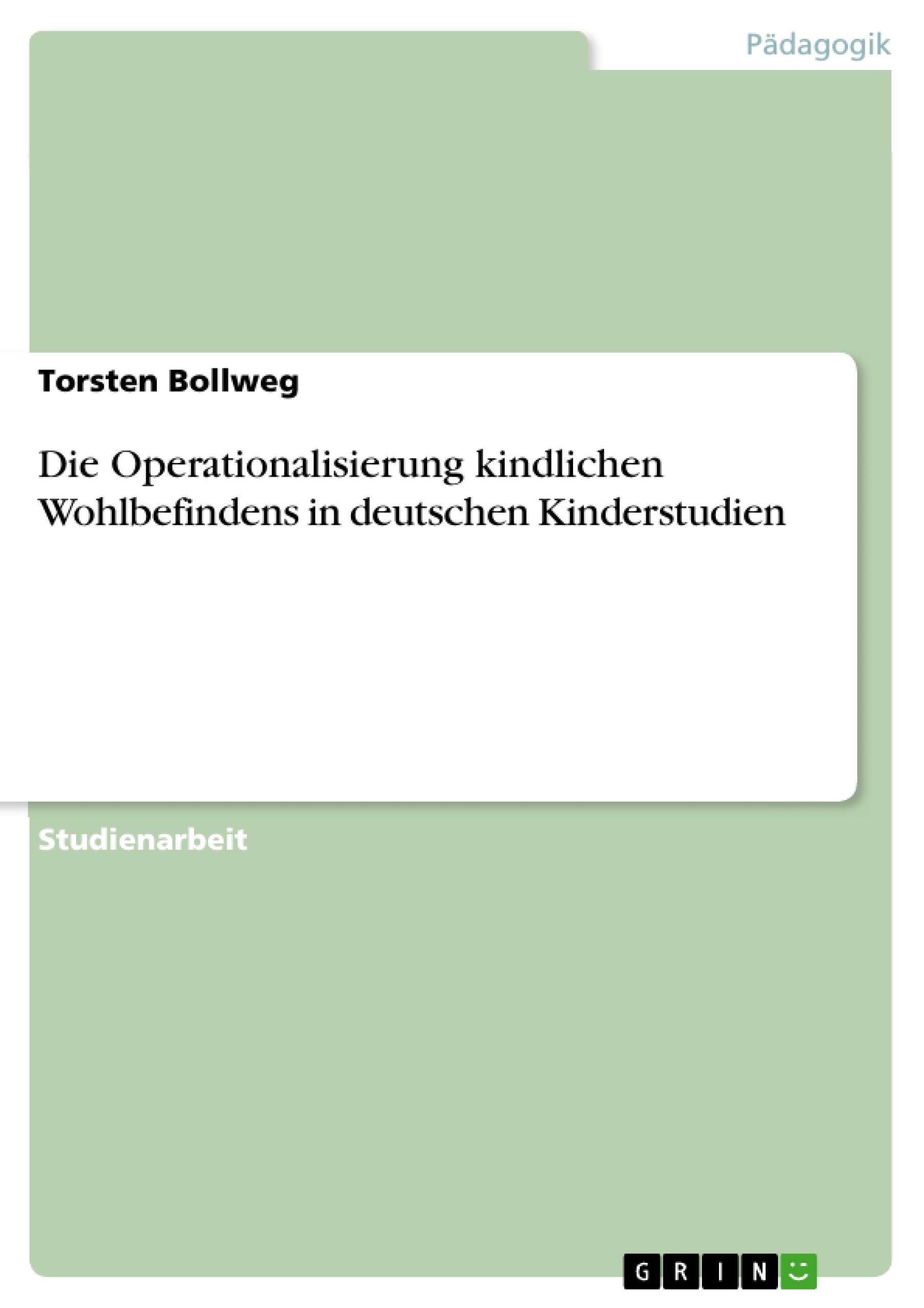Das kindliche Wohlbefinden ist in der jüngeren Vergangenheit immer mehr in den Fokus der Kindheitsforschung gelangt, so gibt es international sowie national bereits einige Studien zur Situation von Kinder. Deutsche Studien zum Thema Kindheit sind z.B.: Das LBS-Kinderbarometer, die World-Vision-Kinderstudien, der Unicef-Report zur Lage der Kinder in Deutschland, die KIGGS-Gesundheitsstudie, das DJI-Kinderpanel, die Shell-Jugendstudie und der Kinder- und Jugendbericht des Bundesministeriums für Familie. „Wohlbefinden“ ist dabei ein komplexes Konstrukt, dass je nach Schwerpunkt der Studien einerseits unterschiedlich intensiv behandelt, andererseits aber auch inhaltlich unterschiedlich ausgelegt wird. Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, verschiedene Konzepte zur Erfassung von Wohlbefinden vorzustellen und am konkreten Beispiel zu untersuchen, wie Wohlbefinden in zwei deutschen Kinderstudien, der LBS-Kinderarometer Studie (2009) und der 2. World-Vision-Kinderstudie (2010) operationalisiert wird. Dazu werden zuerst im zweiten Kapitel die Grundlegenden Begriffe „Kindheit“, „Wohlbefinden“ und „Operationalisierung“ definiert und darauf aufbauend, im dritten Kapitel, mögliche Operationalisierungen von kindlichem Wohlbefinden anhand der UNICEF-Studie „Child Well-Being in Rich Countries“ (2007) dargestellt. Desweiteren werden im dritten Kapitel die Operationalisierungen von kindlichem Wohlbefinden anhand der Fragebögen zu den genannten Studien analysiert und diskutiert. Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit im vierten Kapitel zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1. Kindheit
- 2.2. Wohlbefinden
- 2.3. Operationalisierung
- 3. Die Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens
- 3.1. Mögliche Operationalisierungen
- 3.2. Kindliches Wohlbefinden in deutschen Kinderstudien: Das LBS-Kinderbarometer
- 3.2.1. Fragen nach kindlichem Wohlbefinden
- 3.2.2. Indikatoren kindlichen Wohlbefindens
- 3.2.3. LBS-Kinderbarometer - Zusammenfassung
- 3.3. Kindliches Wohlbefinden in deutschen Kinderstudien: Die 2. World Vision Kinderstudie
- 3.3.1. Fragen nach kindlichem Wohlbefinden
- 3.3.2. Indikatoren kindlichen Wohlbefindens
- 3.3.3. Zweite World Vision Kinderstudie – Zusammenfassung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens in deutschen Kinderstudien. Ziel ist es, verschiedene Konzepte zur Erfassung von Wohlbefinden vorzustellen und an konkreten Beispielen zu analysieren, wie Wohlbefinden in zwei Studien – dem LBS-Kinderbarometer und der 2. World Vision Kinderstudie – operationalisiert wird. Die Arbeit beleuchtet dabei die Komplexität des Konstrukts „Wohlbefinden“ und die verschiedenen Perspektiven auf den Begriff „Kindheit“.
- Definition und Facetten des Begriffs „Kindheit“
- Definition und verschiedene Dimensionen des Begriffs „Wohlbefinden“
- Operationalisierung von kindlichem Wohlbefinden: Methoden und Herausforderungen
- Analyse der Operationalisierung in ausgewählten deutschen Kinderstudien
- Vergleich der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema kindliches Wohlbefinden in der Kindheitsforschung ein und beschreibt die Komplexität des Konstrukts „Wohlbefinden“. Sie benennt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Operationalisierung von Wohlbefinden in zwei deutschen Kinderstudien (LBS-Kinderbarometer und 2. World Vision Kinderstudie). Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und erwähnt relevante deutsche Studien zum Thema Kindheit.
2. Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Kindheit“, „Wohlbefinden“ und „Operationalisierung“. Es betont die Vielschichtigkeit dieser Begriffe und betrachtet verschiedene Perspektiven (biologisch, psychologisch, sozialwissenschaftlich) auf den Begriff „Kindheit“, inklusive des historischen Wandels und des Paradigmenwechsels in der Kindheitsforschung. Für „Wohlbefinden“ werden emotionale und kognitive Komponenten herausgestellt.
3. Die Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens: Dieses Kapitel stellt verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens vor, u.a. anhand der UNICEF-Studie „Child Well-Being in Rich Countries“. Es analysiert die Operationalisierung in den beiden ausgewählten Studien (LBS-Kinderbarometer und 2. World Vision Kinderstudie) detailliert, indem es die verwendeten Fragen und Indikatoren untersucht und zusammenfasst.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Operationalisierung Kindlichen Wohlbefindens in Deutschen Kinderstudien
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, wie kindliches Wohlbefinden in deutschen Kinderstudien operationalisiert wird. Sie analysiert verschiedene Konzepte zur Erfassung von Wohlbefinden und betrachtet konkrete Beispiele aus dem LBS-Kinderbarometer und der 2. World Vision Kinderstudie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte verschiedene Konzepte zur Erfassung von Wohlbefinden vorstellen und analysieren, wie diese in den zwei ausgewählten Studien angewendet werden. Sie beleuchtet die Komplexität des Konstrukts „Wohlbefinden“ und die verschiedenen Perspektiven auf den Begriff „Kindheit“.
Welche Studien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Operationalisierung von kindlichem Wohlbefinden im LBS-Kinderbarometer und in der 2. World Vision Kinderstudie. Sie untersucht die verwendeten Fragen und Indikatoren in beiden Studien.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe „Kindheit“, „Wohlbefinden“ und „Operationalisierung“. Es werden verschiedene Perspektiven (biologisch, psychologisch, sozialwissenschaftlich) auf den Begriff „Kindheit“ betrachtet, inklusive des historischen Wandels und des Paradigmenwechsels in der Kindheitsforschung. Für „Wohlbefinden“ werden emotionale und kognitive Komponenten herausgestellt.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel mit Begriffserklärungen, einem Kapitel zur Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens (inklusive der Analyse der beiden Studien), und einem Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt das Ziel der Arbeit. Das Kapitel zu den Begriffserklärungen definiert die zentralen Begriffe. Das Hauptkapitel analysiert die Operationalisierung von kindlichem Wohlbefinden in den ausgewählten Studien.
Welche Aspekte von „Kindheit“ und „Wohlbefinden“ werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Vielschichtigkeit des Begriffs „Kindheit“ aus verschiedenen Perspektiven (biologisch, psychologisch, sozialwissenschaftlich) und berücksichtigt den historischen Wandel und den Paradigmenwechsel in der Kindheitsforschung. Für „Wohlbefinden“ werden sowohl emotionale als auch kognitive Komponenten berücksichtigt.
Welche Herausforderungen bei der Operationalisierung werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet die Komplexität der Operationalisierung von kindlichem Wohlbefinden und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie zeigt, wie unterschiedlich Wohlbefinden in verschiedenen Studien erfasst wird.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit selbst ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten. Es kann nur geschlussfolgert werden, dass es einen Vergleich der Ergebnisse der beiden Studien und Schlussfolgerungen zur Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens enthalten wird.)
- Quote paper
- Torsten Bollweg (Author), 2012, Die Operationalisierung kindlichen Wohlbefindens in deutschen Kinderstudien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206735