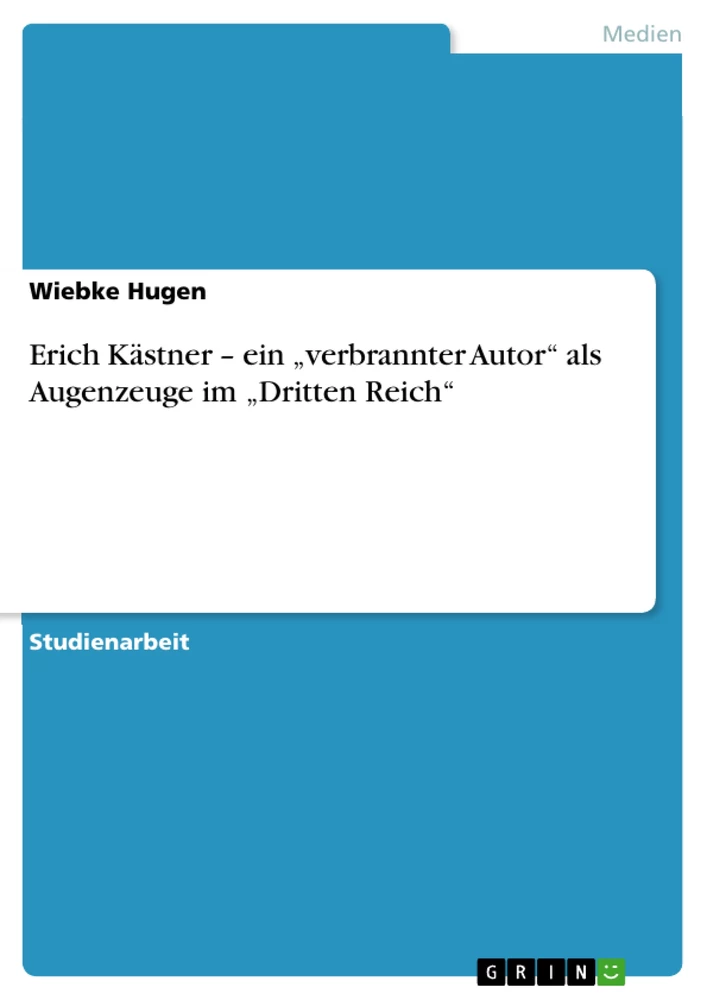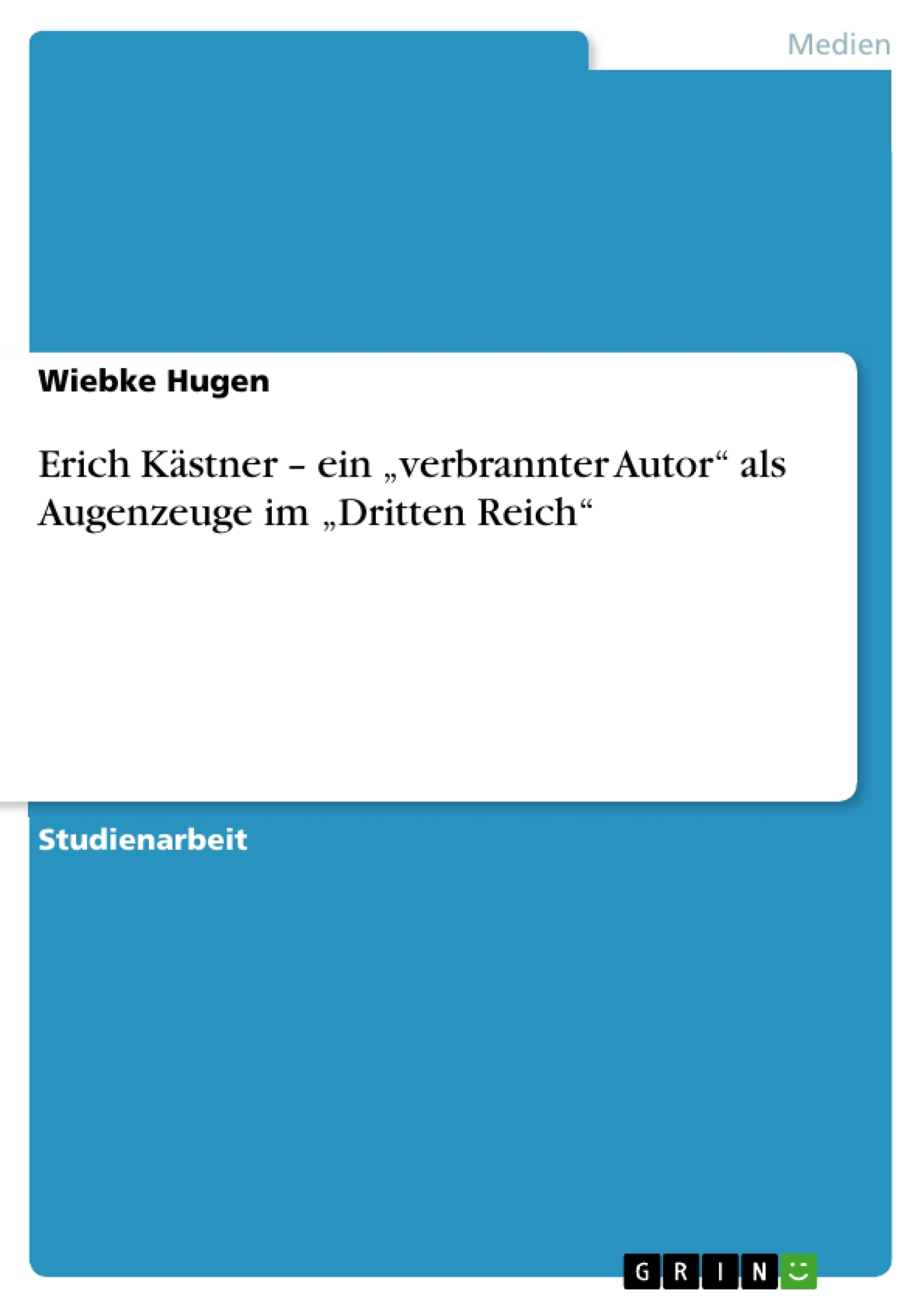"Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit."
Dies schreibt der Dichter, Schriftsteller und stete Systemkritiker Erich Kästner im Jahr 1932, ein Jahr vor der Machtergreifung Hitlers. Obwohl er selbst in seinen Werken immer wieder vor den Nationalsozialisten und dem, was sich da über Deutschland zusammenbraute, warnte, unterschätzt er das Regime bis in die Kriegsjahre hinein. Durch seine Entscheidung gegen die Emigration aus seiner Heimat wird er zwölf Jahre lang gezwungen sein, in diesem Zug als „stummer Passagier“ mitzufahren, um sein Leben nicht zu gefährden. Dies stößt bei anderen deutschen Exilanten auf Unverständnis und löst Misstrauen aus – wie kann ein Autor im Land, das sie verließen, ein Dutzend Jahre vergleichsweise unversehrt existieren, ohne sich dem Feind anzuschließen? Kästner wird sich dieser Frage noch lange nach dem Krieg stellen müssen und immer nach einer Erklärung suchen, wie es überhaupt zu einer Diktatur kommen konnte.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich vor allem Kästners Motive für seine Entscheidung gegen die Emigration herausheben und mich mit dem Konflikt auseinandersetzen, der sich dadurch für ihn während und nach der Nazizeit ergab.
Zudem soll verdeutlicht werden, wie ein (Über-)Leben als nicht nationalsozialistischer Intellektueller zwischen 1933 und 1945 in Deutschland möglich war, die Maßregelungen des Systems umgangen werden konnten und welche Kompromisse es mit sich und dem eigenen Idealismus zu schließen galt.
Bevor ich mich Kästners Werdegang ab dem Zeitpunkt der Machtübernahme Hitlers widme, möchte ich zum Einstieg einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Dichters und Schriftstellers bis zu diesem Zeitpunkt liefern, da seine Herkunft und Erfahrungen nicht unerheblich für spätere Entscheidungen sein werden.
Anschließend hebe ich einige besonders bedeutende Stationen im Leben Kästners ab 1933 hervor, so die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 und seine Mitarbeit am Film Münchhausen, der ihm trotz dessen Erfolgs viel Verdruss und Rechtfertigungsbedarf gegenüber den deutschen Emigranten bescherte.
Insgesamt möchte ich den Werdegang dieses außergewöhnlichen Autors nachvollziehbar machen und zeigen, dass er – wenn er auch kein „Held“ war – doch viel Mut und Nervenstärke beweisen musste, um im Regime zu überleben und der Welt bis zu seinem Tod großartige Werke zu liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Leben und Wirken bis 1933
- 3. Machtwechsel und Bücherverbrennung
- 4. Leben im Regime
- 4.1 Mitarbeit am Münchhausen 1942 und die Folgejahre
- 5. Leben nach Kriegsende
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Erich Kästners Entscheidung gegen die Emigration während des Nationalsozialismus und die daraus resultierenden Konflikte. Sie beleuchtet, wie ein nicht-nationalsozialistischer Intellektueller in dieser Zeit in Deutschland überleben konnte, welche Maßnahmen er ergriff und welche Kompromisse er eingehen musste. Der Fokus liegt auf Kästners Motiven und dem Spannungsfeld zwischen seinem Überleben und seinen Idealen.
- Kästners Motive für den Verbleib in Deutschland während des Nationalsozialismus
- Die Herausforderungen und Strategien des Überlebens als nicht-nationalsozialistischer Intellektueller
- Die Kompromisse zwischen persönlichem Überleben und ideologischer Integrität
- Die Reaktion des Exils auf Kästners Entscheidung
- Kästners Auseinandersetzung mit dem Aufstieg der Diktatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Erich Kästner aus dem Jahr 1932, das die allgemeine Unsicherheit und das Unwissen über die Zukunft in der Zeit vor der Machtergreifung Hitlers verdeutlicht. Sie führt das zentrale Thema der Arbeit ein: Kästners Entscheidung gegen die Emigration und die damit verbundenen Herausforderungen und Konflikte. Die Arbeit konzentriert sich auf die Motive für diese Entscheidung und die Auswirkungen auf sein Leben während und nach der Nazizeit. Sie beschreibt zudem das Ziel, aufzuzeigen, wie ein nicht-nationalsozialistischer Intellektueller in Deutschland überleben konnte und welche Kompromisse er eingehen musste.
2. Leben und Wirken bis 1933: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über Erich Kästners Leben und Werk bis zur Machtübernahme Hitlers. Es beschreibt seine Kindheit und Jugend in Dresden, seine Ausbildung und seinen beruflichen Werdegang als Journalist und Schriftsteller. Besondere Aufmerksamkeit wird seiner engen Beziehung zu seiner Mutter gewidmet, sowie seine Zeit im Lehrerseminar und seine Ablehnung des Militarismus. Der Kapitel beschreibt auch seinen Aufstieg als Schriftsteller mit Werken wie "Herz auf Taille" und "Emil und die Detektive" und seinen kritischen Blick auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der Weimarer Republik. Seine Unsicherheit über seine mögliche Abstammung von einem jüdischen Arzt wird ebenfalls erwähnt, eine Tatsache mit großer Bedeutung für das spätere Leben unter dem Naziregime.
3. Machtwechsel und Bücherverbrennung: Dieses Kapitel beschreibt Kästners Aufenthalt in der Schweiz während der entscheidenden Wochen der Machtergreifung durch die Nazis und seine anschließende Entscheidung, nach Berlin zurückzukehren, trotz der Drängen seiner emigrierten Freunde. Es beleuchtet die Kontroversen, die seine Entscheidung auslöste, und seine Versuche, andere Schriftsteller vom Verlassen Deutschlands abzuhalten. Der Kapitel thematisiert seine Anwesenheit bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933, welche ein entscheidender Wendepunkt in seinem Leben und seiner öffentlichen Haltung darstellt.
4. Leben im Regime: Dieses Kapitel beschreibt Kästners Leben unter dem NS-Regime. Es behandelt seine Herausforderungen, seine Strategien zum Überleben und die Kompromisse, die er eingehen musste. Ein besonderer Fokus liegt auf seiner Mitarbeit am Film "Münchhausen" und den Reaktionen der Emigranten darauf. Es beleuchtet die Spannungen zwischen dem Wunsch nach Selbstbehauptung und der Verurteilung des NS-Regimes.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Exilpublizistik, Nationalsozialismus, Emigration, Zensur, Kompromiss, Überleben, Widerstand, Literatur im Dritten Reich, Intellektuelle im NS-Staat.
Erich Kästner: Leben und Werk im Nationalsozialismus - FAQ
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Erich Kästners Entscheidung, während des Nationalsozialismus nicht zu emigrieren, und die daraus resultierenden Konflikte. Sie beleuchtet seine Überlebensstrategien, die ergriffenen Maßnahmen und eingegangenen Kompromisse als nicht-nationalsozialistischer Intellektueller in dieser Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Kästners Motive für seinen Verbleib in Deutschland, die Herausforderungen und Strategien seines Überlebens, die Kompromisse zwischen persönlichem Überleben und ideologischer Integrität, die Reaktion des Exils auf seine Entscheidung und seine Auseinandersetzung mit dem Aufstieg der Diktatur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Leben und Wirken bis 1933, Machtwechsel und Bücherverbrennung, Leben im Regime (inkl. Mitarbeit am Münchhausen), Leben nach Kriegsende und Schluss.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beginnt mit einem Zitat von Erich Kästner und führt das zentrale Thema – seine Entscheidung gegen die Emigration – ein. Sie beschreibt die damit verbundenen Herausforderungen und Konflikte und das Ziel der Arbeit: aufzuzeigen, wie ein nicht-nationalsozialistischer Intellektueller in Deutschland überleben konnte und welche Kompromisse er eingehen musste.
Was beinhaltet das Kapitel "Leben und Wirken bis 1933"?
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Kästners Leben und Werk vor 1933, einschließlich seiner Kindheit, Ausbildung, Karriere als Journalist und Schriftsteller, seiner Beziehung zu seiner Mutter, seiner Ablehnung des Militarismus und seines kritischen Blicks auf die Weimarer Republik. Seine Unsicherheit über seine mögliche jüdische Abstammung wird ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel "Machtwechsel und Bücherverbrennung" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Kästners Aufenthalt in der Schweiz während der Machtergreifung, seine Rückkehr nach Berlin, die Kontroversen um seine Entscheidung, seine Versuche, andere Schriftsteller vom Verlassen Deutschlands abzuhalten, und seine Anwesenheit bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933.
Worüber handelt das Kapitel "Leben im Regime"?
Dieses Kapitel beschreibt Kästners Leben unter dem NS-Regime, seine Überlebensstrategien, die eingegangenen Kompromisse und insbesondere seine Mitarbeit am Film "Münchhausen" und die Reaktionen der Emigranten darauf. Es beleuchtet den Konflikt zwischen Selbstbehauptung und Verurteilung des NS-Regimes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erich Kästner, Exilpublizistik, Nationalsozialismus, Emigration, Zensur, Kompromiss, Überleben, Widerstand, Literatur im Dritten Reich, Intellektuelle im NS-Staat.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen.
- Quote paper
- Wiebke Hugen (Author), 2009, Erich Kästner – ein „verbrannter Autor“ als Augenzeuge im „Dritten Reich“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205724