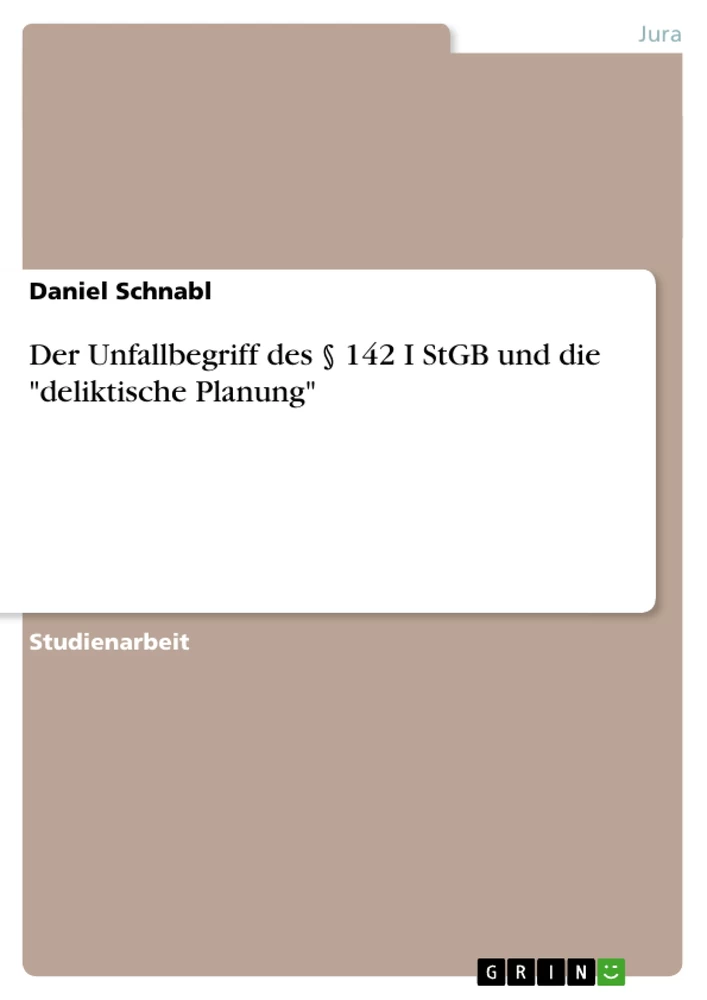Eine neuere Entscheidung des Bundesgerichtshofs1gibt Veranlassung, ein Problem erneut aufzugreifen, welches zwar einst heftig umstritten war, durch mehrere grundlegende Entscheidungen des BGH aber zumindest vorläufig für längere Zeit geklärt schien. Es geht um die Fragestellung, ob ein „Verkehrsunfall“ im Sinne von § 142 I StGB auch bei vorsätzlicher Herbeiführung des schädigenden Ereignisses angenommen werden kann.
Diese auf den ersten Blick leicht isolierbar wirkende Frage wirft eine ganze Reihe von Folgeproblemen auf, welche weit in das Feld traditioneller Auslegungsmethoden führen. Ziel der Darstellung ist es, die angesprochene Entscheidung des Bundesgerichtshofs anhand der bisherigen Rechtsprechung kritisch zu hinterfragen und unter Berücksichtigung verschiedener Lösungsansätze genau zu analysieren. Alleiniges Augenmerk liegt dabei auf der konkret aufgeworfenen Fragestellung, so dass die sonstigen Probleme im Rahmen des § 142 StGB – einer der am meisten verunglückten Bestimmungen des Strafgesetzbuches – die nicht zielführend sind, außerhalb der Erörterung bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Der Unfallbegriff des § 142 StGB
- Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
- Die Relevanz des Unfallbegriffs für die Strafbarkeit nach § 142 StGB
- Die deliktische Planung
- Der Begriff der deliktischen Planung im Strafrecht
- Die Anwendung des Planungskonzepts auf den Fall der Unfallflucht
- Die kritische Analyse des BGH-Urteils vom 15.11.2001
- Die Sachlage im konkreten Fall
- Die Argumentation des Bundesgerichtshofs
- Die Auslegung des § 142 StGB anhand traditioneller Methoden
- Die Bedeutung der Gesetzesauslegung im Strafrecht
- Die Anwendung hermeneutischer Methoden auf den § 142 StGB
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. November 2001 im Hinblick auf den Unfallbegriff des § 142 StGB und das Konzept der "deliktischen Planung". Ziel ist es, die Rechtsprechung des BGH kritisch zu beleuchten und die Anwendung traditioneller Auslegungsmethoden auf den Fall der Unfallflucht zu untersuchen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Frage, ob und inwieweit die im Urteil des BGH dargelegte Auslegung des § 142 StGB mit den Anforderungen der Rechtsanwendung und den Grundsätzen der Strafrechtsdogmatik vereinbar ist.
- Der Unfallbegriff des § 142 StGB
- Die deliktische Planung im Strafrecht
- Die Auslegung des § 142 StGB
- Die Anwendung traditioneller Auslegungsmethoden
- Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den Unfallbegriff des § 142 StGB und untersucht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu diesem Thema. Es geht insbesondere um die Frage, was unter einem Unfall im Sinne des § 142 StGB zu verstehen ist und welche Folgen dies für die Strafbarkeit hat.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der "deliktischen Planung" und betrachtet die Bedeutung dieses Konzepts im Strafrecht. Es geht um die Frage, ob und inwieweit das Konzept der Planung für die Beurteilung der Strafbarkeit im Zusammenhang mit § 142 StGB relevant ist.
- Das dritte Kapitel analysiert das BGH-Urteil vom 15. November 2001 und stellt die Sachlage im konkreten Fall dar. Es wird die Argumentation des Bundesgerichtshofs im Detail untersucht, um die zugrunde liegende Rechtsauffassung zu verstehen.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Auslegung des § 142 StGB anhand traditioneller Methoden. Es werden die Bedeutung der Gesetzesauslegung im Strafrecht und die Anwendung hermeneutischer Methoden auf den § 142 StGB beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte dieser Seminararbeit sind Unfallbegriff, Unfallflucht, § 142 StGB, deliktische Planung, Auslegung, Hermeneutik, Rechtsprechung, Bundesgerichtshof, Strafrecht, Strafrechtsdogmatik.
- Citar trabajo
- Daniel Schnabl (Autor), 2003, Der Unfallbegriff des § 142 I StGB und die "deliktische Planung", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20549