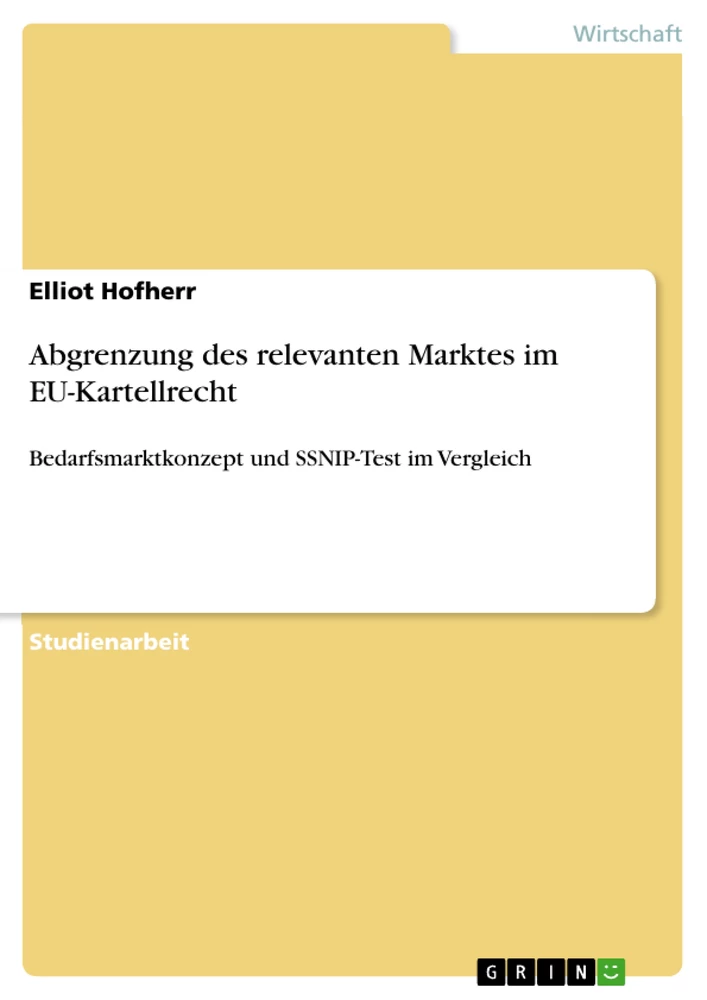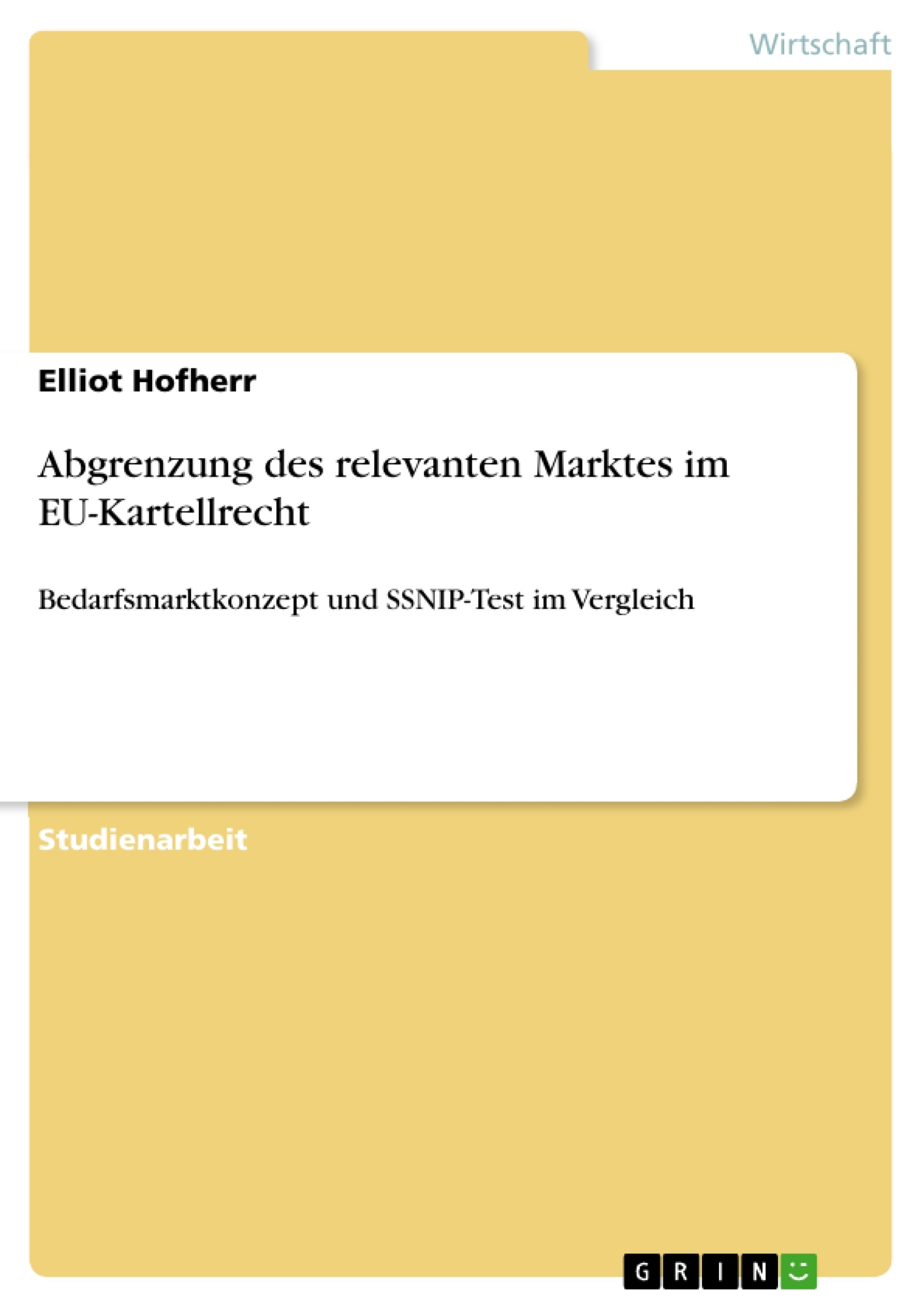Seit Ende der 1990er Jahre findet mit der Neufassung der Kartell- und Fusionskontrollverordnung eine Neuausrichtung des europäischen Kartellrechts statt (Bundeskartellamt 2007: 1). Die „Prioritätenmitteilung“ der EU-Kommission über die Handhabung des Missbrauchsverbotes für marktbeherrschende Unternehmen (Art. 102 AEUV) aus dem Jahr 2009 bildet dabei die neuste Entwicklungsstufe . Grundlegend für diese Neuausrichtung ist der von EU-Kommission präferierte „more economic approach“ (MEA). Der MEA steht dabei für eine stärker ökonomisch orientierte Kartellrechtsanwendung; die kartellrechtliche Entscheidungsfindung soll primär an ökonomischen Konzepten und empirisch-statistischen Befunden ausgerichtet sein (Schmidt / Voigt 2006: 3f.). Damit verbunden ist die stärkere Orientierung am ökonomischen Kriterium der Effizienz (Bundeskartellamt 2007: 2f.). Die Neuausrichtung der Kartellrechtsanwendung stößt jedoch - gerade im Bereich der Rechtswissenschaft - nicht auf ungeteilte Zustimmung. Besonders die damit verbundene Abwertung des „per-se rule Prinzips“ zu Gunsten des „rule of reason Prinzips“ wird mit der damit oftmals einhergehenden fehlenden Rechtssicherheit und Justiziabilität kritisiert (Schmidt 2007: 8ff.).
Vor dem Hintergrund der ökonomisch basierten Neuausrichtung des EU-Kartellrechts und damit verbundener Rechtseinwände, werden in dieser Arbeit die beiden im Bereich der Marktabgrenzung zentralen Konzepte, das „Bedarfsmarktkonzept“ und der durch die Neuausrichtung verstärkt verwendete quantitativ-ökonomisch orientierte „SSNIP-Test", vorgestellt und eingehend analysiert. Die Analyse des „SSNIP-Tests“ zielt dabei vor allem auf dessen mikroökonomische Funktionsweise, die zentral ist für das Verständnis und die Anwendung dieses Tests.
Bevor mit der eigentlichen Untersuchung der beiden Konzepte begonnen wird, ist es aus didaktischen Gründen sinnvoll, in Kapitel 2 zuerst in das mikroökonomische „Modell der vollkommenen Konkurrenz“ und davon abgeleiteter Denkweisen kurz einzuführen. Im Mittelpunkt von Kapitel 3 stehen dann das „Bedarfsmarktkonzept“ und der „SSNIP-Test“. Kapitel 4 schließt mit einer kurzen Bewertung beider Marktabgrenzungskonzepte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wettbewerbsrecht und Wirtschaftswissenschaft
- 2.1 Markt und Wettbewerb
- 2.2 Der relevante Markt und seine Funktion im Kartellrecht
- 3. Konzepte zur Abgrenzung des relevanten Marktes
- 3.1 Bedarfsmarktkonzept und Funktionsweise
- 3.1.1 Konzeptionelle Schwächen
- 3.1.2 Bewertung
- 3.2 SSNIP-Test und Funktionsweise
- 3.2.1 Konzeptionelle Schwächen und Bewertung
- 3.2.2 Rechtsprobleme ökonomischer Ansätze
- 3.1 Bedarfsmarktkonzept und Funktionsweise
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Konzepte zur Abgrenzung des relevanten Marktes im EU-Kartellrecht, insbesondere das Bedarfsmarktkonzept und den SSNIP-Test. Ziel ist es, die Funktionsweise beider Konzepte im Kontext des „more economic approach“ (MEA) zu verstehen und deren konzeptionelle Stärken und Schwächen zu bewerten. Die Arbeit berücksichtigt die Spannungen zwischen rechtswissenschaftlicher und ökonomischer Perspektive.
- Der „more economic approach“ im EU-Kartellrecht
- Die Funktionsweise des Bedarfsmarktkonzepts
- Die Funktionsweise des SSNIP-Tests
- Konzeptionelle Schwächen und Stärken beider Konzepte
- Der Spannungsfeld zwischen Rechtswissenschaft und Ökonomik im Kartellrecht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Neuausrichtung des europäischen Kartellrechts seit Ende der 1990er Jahre, geprägt durch den „more economic approach“ (MEA). Dieser stärkere Fokus auf ökonomische Konzepte und empirische Daten führt zu einer stärkeren Orientierung am ökonomischen Kriterium der Effizienz und einer Abwertung des „per-se rule Prinzips“ zugunsten des „rule of reason Prinzips“. Diese Neuausrichtung wird jedoch kritisch diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Rechtssicherheit und Justiziabilität. Die Arbeit kündigt die Analyse des Bedarfsmarktkonzepts und des SSNIP-Tests an, welche zentrale Konzepte der Marktabgrenzung im Kontext des MEA darstellen.
2. Wettbewerbsrecht und Wirtschaftswissenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet das schwierige Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Ökonomik, geprägt durch unterschiedliche Erkenntnisinteressen und Methoden. Es wird die kritische Auseinandersetzung mit der Anwendung ökonomischer Modelle im Recht dargelegt, wobei die Schwierigkeiten der Anwendung abstrakter ökonomischer Modelle auf die Komplexität der rechtlichen Realität herausgestellt werden. Trotz dieser Differenzen wird die zunehmende interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere im Wettbewerbsrecht, im Kontext des MEA und der „Chicago School“ beschrieben. Der Abschnitt führt in das mikroökonomische Modell der vollständigen Konkurrenz ein, welches als Grundlage für das Verständnis des MEA dient.
2.1 Markt und Wettbewerb: Dieser Abschnitt definiert die zentralen Begriffe „Markt“ und „Wettbewerb“ aus ökonomischer Perspektive. Der Markt wird als Tauschprozess zwischen Anbietern und Nachfragern beschrieben, während Wettbewerb als Rivalität um knappe Ressourcen verstanden wird. Es werden die Anreiz- und Kontrollfunktion des Wettbewerbs erläutert. Das Kapitel verwendet das „Modell der vollständigen Konkurrenz“ um das Marktgeschehen zu analysieren, wobei dessen zentrale Modellprämissen genannt werden.
2.2 Der relevante Markt und seine Funktion im Kartellrecht: (Es fehlt der Text zu diesem Unterkapitel im Originaldokument. Daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
3. Konzepte zur Abgrenzung des relevanten Marktes: (Es fehlt der Text zu diesem Kapitel im Originaldokument. Daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.)
4. Resümee: (Da die Zusammenfassung von Schlussfolgerungen und Abschlussabschnitten explizit ausgeschlossen ist, kann hier kein Text eingefügt werden.)
Schlüsselwörter
EU-Kartellrecht, Marktabgrenzung, Bedarfsmarktkonzept, SSNIP-Test, more economic approach (MEA), Wettbewerbsrecht, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, ökonomische Modelle, Rechtssicherheit, Justiziabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Marktabgrenzung im EU-Kartellrecht
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument analysiert die Konzepte zur Abgrenzung des relevanten Marktes im EU-Kartellrecht, insbesondere das Bedarfsmarktkonzept und den SSNIP-Test. Es untersucht deren Funktionsweise im Kontext des „more economic approach“ (MEA) und bewertet deren konzeptionelle Stärken und Schwächen, wobei die Spannungen zwischen rechtswissenschaftlicher und ökonomischer Perspektive berücksichtigt werden.
Welche Konzepte werden im Detail untersucht?
Im Fokus stehen das Bedarfsmarktkonzept und der SSNIP-Test als zentrale Konzepte der Marktabgrenzung im Kontext des MEA. Das Dokument analysiert deren Funktionsweise, konzeptionelle Schwächen und Stärken.
Was ist der „more economic approach“ (MEA)?
Der MEA beschreibt eine Neuausrichtung des europäischen Kartellrechts seit Ende der 1990er Jahre. Er zeichnet sich durch einen stärkeren Fokus auf ökonomische Konzepte und empirische Daten aus, was zu einer stärkeren Orientierung am ökonomischen Kriterium der Effizienz und einer Abwertung des „per-se rule Prinzips“ zugunsten des „rule of reason Prinzips“ führt. Diese Entwicklung wird im Dokument kritisch diskutiert, insbesondere hinsichtlich der Rechtssicherheit und Justiziabilität.
Wie wird das Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Ökonomik dargestellt?
Das Dokument beleuchtet das schwierige Verhältnis zwischen Rechtswissenschaft und Ökonomik im Kontext des Wettbewerbsrechts. Es werden die unterschiedlichen Erkenntnisinteressen und Methoden sowie die Schwierigkeiten der Anwendung abstrakter ökonomischer Modelle auf die Komplexität der rechtlichen Realität herausgestellt. Gleichzeitig wird die zunehmende interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere im Kontext des MEA und der „Chicago School“, beschrieben.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: EU-Kartellrecht, Marktabgrenzung, Bedarfsmarktkonzept, SSNIP-Test, more economic approach (MEA), Wettbewerbsrecht, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, ökonomische Modelle, Rechtssicherheit, Justiziabilität.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Wettbewerbsrecht und Wirtschaftswissenschaft (inkl. Unterkapiteln zu Markt und Wettbewerb sowie dem relevanten Markt im Kartellrecht), ein Kapitel zu Konzepten der Marktabgrenzung (inkl. Unterkapiteln zum Bedarfsmarktkonzept und dem SSNIP-Test) und ein Resümee. Leider sind im Originaldokument Teile der Kapitel 2 und 3 unvollständig.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments besteht darin, die Funktionsweise des Bedarfsmarktkonzepts und des SSNIP-Tests im Kontext des MEA zu verstehen und deren konzeptionelle Stärken und Schwächen zu bewerten. Es soll die Spannungen zwischen rechtswissenschaftlicher und ökonomischer Perspektive im Kartellrecht beleuchtet werden.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Sozialwirt Univ. Elliot Hofherr (Autor:in), 2012, Abgrenzung des relevanten Marktes im EU-Kartellrecht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204704