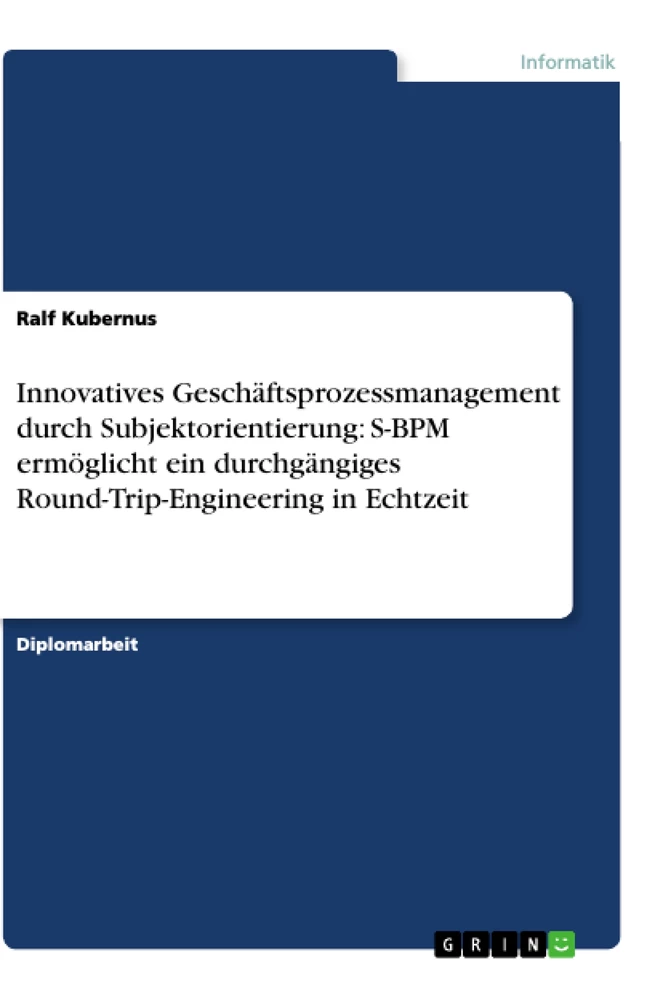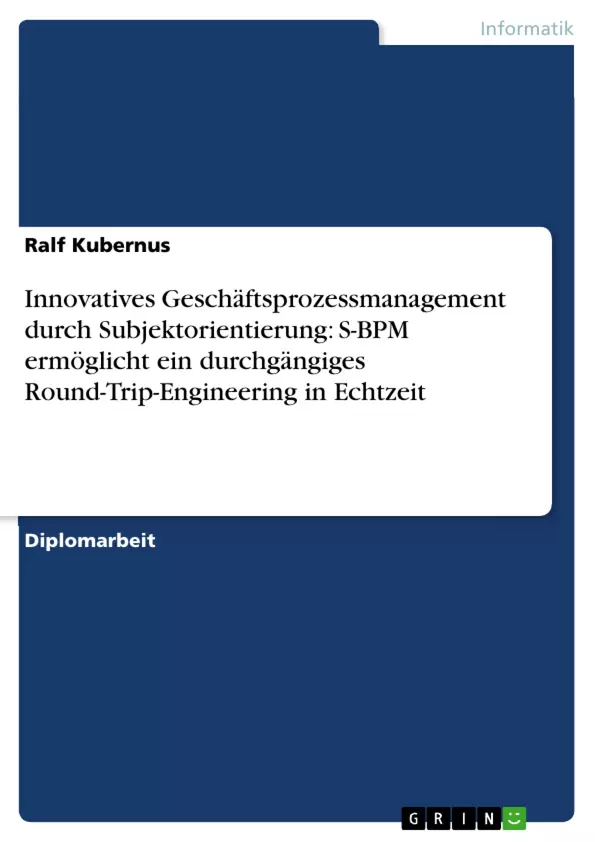Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es, langfristig zu überleben und erfolgreich zu sein. In einer sich ständig verändernden Umwelt ist es hierzu notwendig, Strukturen und Prozesse im Unternehmen an diese Veränderungen laufend anzupassen und nachhaltig effizienter zu gestalten, wobei Effizienz sowohl durch erhöhten Nutzen als auch durch verringerten Aufwand verbessert werden kann (vgl. Walter 2009: 7 ff.).
Gemäß der kürzlich veröffentlichten Studie „BPM-Report 2012“ der Software Initiative Deutschland e.V. und der Metasonic AG entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein finanzieller Schaden von fünf Milliarden Euro durch mangelhaft funktionierende Geschäftsprozesse (vgl. Software Initiative Deutschland, Metasonic 2012: 2).
Laut der Juni-Ausgabe 2011 des E-3-Magazins werden mit dem innovativen Subject-oriented Business Process Management (S-BPM) neue Maßstäbe im Bereich BPM bzw. Geschäftsprozessmanagement (GPM) gesetzt. Die Ziele von S-BPM bestehen darin, dynamische Business-Applikationen effizient zu erstellen und reibungslos in vorhandene IT einzubinden. Im Mittelpunkt der neuen Idee stehen die Subjekte, also die Handelnden im Prozess. So können Mitarbeiter ihre Prozesse selbst beschreiben, interaktiv testen und anschließend gleich als Workflow ausführen - und das ganz ohne spezielles IT-Wissen. Die erforderliche Software wird dann anschließend aus den erstellten Prozessmodellen automatisch erzeugt. Und das, obwohl für die Prozessmodelle selbst nur wenige Symbole benötigt werden. Diese subjektorientierte Prozessbeschreibungsform wurde von Albert Fleischmann entwickelt und ist weltweit einzigartig (vgl. Färbinger 2011: 3).
Aufgrund des großen Potenzials wurde diese Management-Methode S-BPM im „Hype Cycle for Business Process Management, 2011“ von Gartner Inc., ein weltweit agierendes Analystenhaus, als eine eigene Kategorie aufgenommen. In jenem Forschungsbericht werden neue Technologien, IT-Methoden und Management-Disziplinen aufgezeigt. S-BPM wird in diesem Kontext als Methode beschrieben, die sich stark von den herkömmlichen BPM-Ideen abhebt und als Ziel verfolgt, trotz höherer Leistungsfähigkeit der Prozessmodelle ihre Komplexität und den Aufwand für ihre Erstellung erheblich zu reduzieren (vgl. Dixon, Jones 2011: 15 f.). Gartner rechnet mit einem Durchbruch von S-BPM in etwa zehn Jahren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Gang der Arbeit
- 2 Wesentliche Begrifflichkeiten
- 2.1 Geschäftsprozess
- 2.2 Subjektorientierte Beschreibungsform
- 2.3 Informationstechnologie
- 3 Prozessrahmen
- 3.1 Grundsätzliche Vorgehensweise
- 3.2 Akteure
- 3.3 Ausgangsinformationen
- 3.4 Rahmenbedingungen
- 3.4.1 Intern
- 3.4.2 Extern
- 4 Prozessaufnahme
- 4.1 Ziel
- 4.2 Sammlung Informationen
- 4.2.1 Subjekte
- 4.2.2 Prädikate
- 4.2.3 Objekte
- 4.2.4 Zusammenfassung
- 4.3 Modellierung Ist-Prozess
- 4.3.1 Vorgehensweise
- 4.3.2 Modellierungskonstrukte
- 4.3.3 Fallbeispiel
- 4.4 Validierung Ist-Prozess
- 4.4.1 Prozess
- 4.4.2 Prozessmodell
- 5 Prozessoptimierung
- 5.1 Ermitteln Potenziale
- 5.1.1 Optimierungsziele
- 5.1.2 Basis von Optimierungen
- 5.1.3 Generelle Optimierungsmöglichkeiten
- 5.1.4 Subjektorientierte Optimierungsaspekte
- 5.2 Modellierung Soll-Prozess
- 5.3 Freigabe Soll-Prozess
- 6 Prozesseinführung
- 6.1 Organisationsspezifische Implementierung
- 6.1.1 Subjekte
- 6.1.2 Verhalten
- 6.2 Informationstechnische Implementierung
- 6.2.1 Referenzrahmen
- 6.2.2 Subjektträger
- 6.2.3 Subjektverhalten
- 6.2.4 Architektur
- 6.3 Verifikation und Abnahme
- 6.4 Lessons learned
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Aufnahme und Optimierung eines fiktiven Geschäftsprozesses mithilfe der subjektorientierten Beschreibungsform. Ziel ist die detaillierte Darstellung des Ist-Zustands, die Identifizierung von Optimierungspotenzialen und die Entwicklung eines Soll-Geschäftsprozesses unter Einbezug von Informationstechnologien. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis für die Anwendung subjektorientierter Modellierung in der Geschäftsprozessoptimierung vermitteln.
- Aufnahme eines fiktiven Ist-Geschäftsprozesses
- Anwendung der subjektorientierten Beschreibungsform
- Identifizierung von Optimierungspotenzialen
- Entwicklung eines Soll-Geschäftsprozesses
- Integration von Informationstechnologien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird der methodische Ansatz skizziert und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit effizienter Geschäftsprozesse und der Rolle von Informationstechnologie bei der Optimierung.
2 Wesentliche Begrifflichkeiten: Hier werden die zentralen Begriffe wie "Geschäftsprozess", "subjektorientierte Beschreibungsform" und "Informationstechnologie" präzise definiert und im Kontext der Arbeit eingeordnet. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel und gewährleisten eine einheitliche Terminologie. Die Erläuterungen der verschiedenen Konzepte sind detailliert und differenziert.
3 Prozessrahmen: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Rahmen der Prozessaufnahme und -optimierung. Es werden die grundsätzliche Vorgehensweise, die beteiligten Akteure, die Ausgangsinformationen und die relevanten Rahmenbedingungen (interne und externe Faktoren) detailliert dargelegt. Der Fokus liegt auf der strukturierten Herangehensweise an das Projekt.
4 Prozessaufnahme: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Ist-Prozessaufnahme, beginnend mit der Definition des Ziels, der Informationsbeschaffung (Subjekte, Prädikate, Objekte) und der anschließenden Modellierung des Ist-Prozesses. Ein Fallbeispiel veranschaulicht die praktische Anwendung der subjektorientierten Modellierung. Die Validierung des Ist-Prozessmodells wird ebenfalls detailliert erklärt.
5 Prozessoptimierung: In diesem Kapitel wird die Optimierung des Geschäftsprozesses behandelt. Es geht um das Ermitteln von Optimierungspotenzialen, die Definition von Optimierungszielen, die Betrachtung möglicher Optimierungen basierend auf der subjektorientierten Perspektive und die Modellierung des Soll-Prozesses. Der Prozess der Freigabe des Soll-Prozesses wird ebenfalls erklärt.
6 Prozesseinführung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Implementierung des optimierten Soll-Prozesses. Es beschreibt die organisationsspezifische und informationstechnische Implementierung, inklusive der Beschreibung der Architektur und der verwendeten Technologien. Die Verifikation und Abnahme des neuen Prozesses sowie die gewonnenen Erkenntnisse ("Lessons learned") werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Geschäftsprozessmanagement, Subjektorientierte Beschreibungsform, Informationstechnologie, Prozessoptimierung, Ist-Soll-Vergleich, Modellierung, Implementierung, Optimierungspotenziale, Fallbeispiel, Validierung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Aufnahme und Optimierung eines Geschäftsprozesses
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Aufnahme und Optimierung eines fiktiven Geschäftsprozesses unter Anwendung der subjektorientierten Beschreibungsform. Ziel ist die detaillierte Darstellung des Ist-Zustands, die Identifizierung von Optimierungspotenzialen und die Entwicklung eines Soll-Geschäftsprozesses, der Informationstechnologien integriert.
Welche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet die subjektorientierte Beschreibungsform zur Modellierung und Optimierung des Geschäftsprozesses. Diese Methode ermöglicht eine detaillierte Analyse der beteiligten Akteure (Subjekte), ihrer Handlungen (Prädikate) und der betroffenen Objekte.
Welche Phasen umfasst die Prozessaufnahme und -optimierung?
Die Arbeit gliedert sich in die Phasen der Einleitung, der Definition wesentlicher Begrifflichkeiten, der Beschreibung des Prozessrahmens, der Ist-Prozessaufnahme (inkl. Informationsbeschaffung und Modellierung), der Prozessoptimierung (inkl. Identifizierung von Potenzialen und Soll-Prozessmodellierung), und der Prozesseinführung (inkl. organisatorischer und informationstechnischer Implementierung sowie Verifikation und Abnahme).
Wie wird der Ist-Prozess aufgenommen?
Die Ist-Prozessaufnahme erfolgt durch die systematische Sammlung von Informationen zu Subjekten, Prädikaten und Objekten des Prozesses. Diese Informationen werden dann in einem Prozessmodell mittels der subjektorientierten Beschreibungsform visualisiert und dokumentiert. Ein Fallbeispiel veranschaulicht den praktischen Ablauf.
Wie wird der Soll-Prozess entwickelt?
Die Entwicklung des Soll-Prozesses basiert auf der Analyse des Ist-Prozesses und der Identifizierung von Optimierungspotenzialen. Dabei werden Optimierungsziele definiert und die subjektorientierte Perspektive berücksichtigt. Das Ergebnis ist ein optimiertes Prozessmodell, das die Integration von Informationstechnologien beinhaltet.
Welche Rolle spielt die Informationstechnologie?
Die Informationstechnologie spielt eine zentrale Rolle bei der Implementierung des Soll-Prozesses. Die Arbeit beschreibt die informationstechnische Implementierung, inklusive der Architektur und der verwendeten Technologien, um den optimierten Prozess effizient zu unterstützen.
Wie wird die Validierung des Ist- und Soll-Prozesses sichergestellt?
Die Validierung des Ist-Prozesses erfolgt durch den Vergleich des Prozessmodells mit der Realität. Die Validierung des Soll-Prozesses umfasst die Verifikation und Abnahme nach der Implementierung, um die korrekte Funktion und den angestrebten Nutzen sicherzustellen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für diese Arbeit?
Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören Geschäftsprozessmanagement, Subjektorientierte Beschreibungsform, Informationstechnologie, Prozessoptimierung, Ist-Soll-Vergleich, Modellierung, Implementierung, Optimierungspotenziale, Fallbeispiel und Validierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Wesentliche Begrifflichkeiten, Prozessrahmen, Prozessaufnahme, Prozessoptimierung und Prozesseinführung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Prozessaufnahme und -optimierung.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der vorliegenden Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Ralf Kubernus (Autor:in), 2012, Innovatives Geschäftsprozessmanagement durch Subjektorientierung: S-BPM ermöglicht ein durchgängiges Round-Trip-Engineering in Echtzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204558