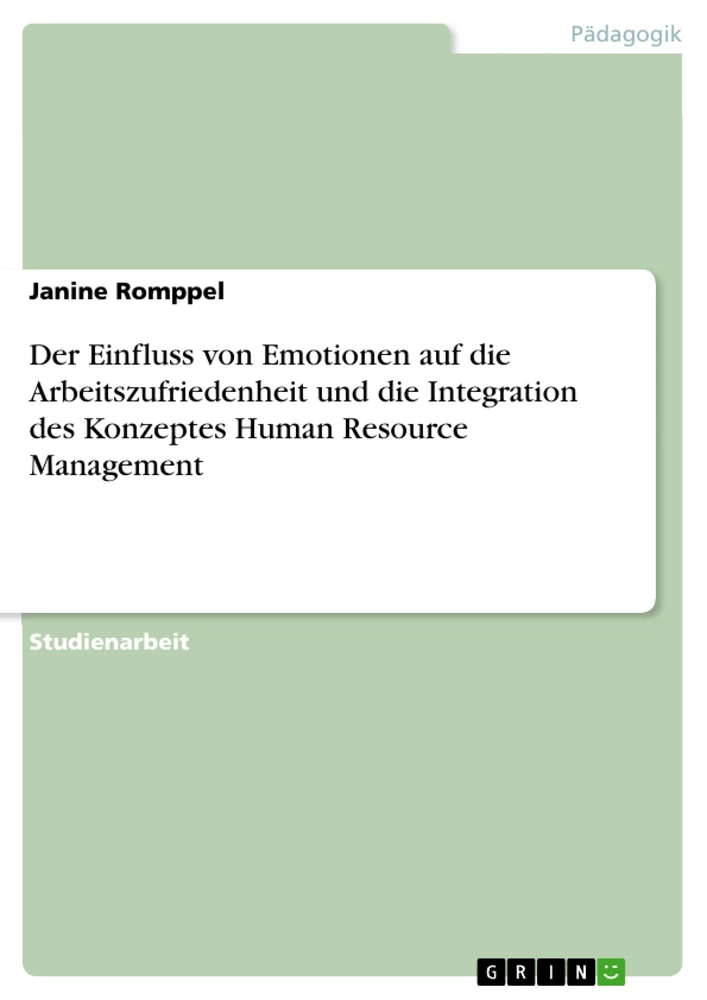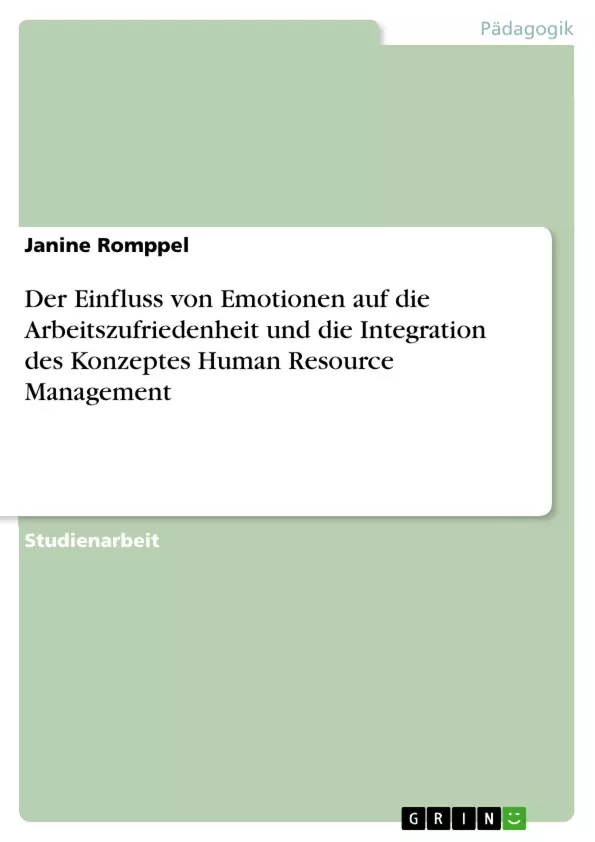Der alltägliche Gang zur Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Nicht nur der Aspekt Geld zu verdienen, um damit seinen Lebensunterhalt finanzieren zu können, zählt, sondern auch die Identifikation mit dem Beruf selbst. Idealerweise sollte ein Jeder hinter seinem Beruf stehen können, sich am Arbeitsplatz wohl fühlen und mit Begeisterung best möglichste Leistungen erbringen. Doch die Realität sieht oft ganz anders aus. Eine aktuelle Studie des Markt- und Sozialforschungsinstitutes IFAK zeigt, welch raues Arbeitsklima an deutschen Arbeitsplätzen herrscht. Demnach war bereits jeder achte Beschäftige am aktuellen Arbeitsplatz Opfer von Mobbing, was bei allen erwerbstätigen Menschen in Deutschland eine Opferzahl von 3,8 Millionen ergeben würde. Ebenso erschreckende Ergebnisse stellt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung dar: So muss jeder vierte Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union im Laufe seines beruflichen Lebens damit rechnen, psychisch zu erkranken (Süddeutsche 2007). Das Thema Arbeitszufriedenheit wurde in den USA in den 50er und 60er, in Deutschland in den 70er Jahren populär und interessant für Wissenschaft und Forschung (vgl. Hummel, 1995, S.11). Im Rahmen der Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens gewann das Konstrukt der Arbeitszufriedenheit als subjektiver Indikator für das Erleben von Arbeit enorm an Bedeutung (vgl. Temme & Tränkle 1996, S.275). Doch inwiefern stehen Aspekte der Unsicherheit, aber auch der Zufriedenheit, die Menschen im Hinblick auf ihre Arbeit empfinden, im unmittelbaren Zusammenhang mit Emotionen? Emotionen begegnen uns ständig im alltäglichen Leben. Sie sind demnach Begleiter des Menschen in jeglichen Situationen. Es dürfte wohl kein Tag geben, an dem nicht emotional gehandelt, gedacht oder sich verhalten wird. Wir freuen uns über Geschenke unserer Liebsten, reagieren mit Ärger, wenn es auf der Arbeit nicht wie gewollt voran geht, entwickeln Mitgefühl gegenüber Menschen in Notsituationen oder empfinden Angst, wenn die nächste Mathematikklausur ansteht. Darüber hinaus sind Emotionen in unserem Erfahrungsschatz eingeschlossen und stehen in Verbindung mit bestimmten Ereignissen, die für uns persönlich bedeutsam sind, wie zum Beispiel der Gedanke an den Tod einer nahe stehenden Person. Befinden wir uns in einer gefährlichen Lage und fürchten uns, folgt die Reaktion der Vermeidung durch Rückzug. Emotionen können aber auch ungewollte „Nebenwirkungen“ mit sich bringen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema
- Ziel und Fragestellung der Arbeit
- Kriterien der Befindlichkeit
- Arbeitszufriedenheit
- Definition und Abgrenzung
- Theorien zur Arbeitszufriedenheit
- Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitszufriedenheit
- Arbeitsemotionen
- Emotionsbegriff
- Die Emotionstheroie nach Plutchik
- Emotionen bei der Arbeit
- Arbeitszufriedenheit
- Arbeitszufriedenheitsforschung
- Explorative Studie von Temme
- Kritik
- Affective-events-theory“ von Weiss und Cropanzano
- Kritik
- Explorative Studie von Temme
- Personalentwicklung und Einflussnahme auf Arbeitsemotionen
- Was ist Personalentwicklung?
- Das Konzept Human Resource Management
- Motivationsförderung der Mitarbeiter durch Feedback u. Gespräch
- Resümee und Schlussworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Arbeitsplatzunsicherheit auf das Verhalten am Arbeitsplatz und untersucht insbesondere die Rolle von Emotionen in diesem Zusammenhang. Ziel ist es, die Beziehung zwischen Arbeitsplatzunsicherheit, Emotionen und Arbeitszufriedenheit zu beleuchten und Maßnahmen der Personalentwicklung zu diskutieren, die zur Verbesserung der Mitarbeiterintegration und -motivation beitragen können.
- Arbeitsplatzunsicherheit und ihre Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten
- Die Rolle von Emotionen bei der Entwicklung von Arbeitszufriedenheit oder -unzufriedenheit
- Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Arbeitsverhalten
- Strategien der Personalentwicklung zur Verbesserung der Mitarbeiterintegration und -motivation
- Einfluss des Human Resource Managements auf die Arbeitsemotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Arbeitszufriedenheit und Arbeitsplatzunsicherheit ein und skizziert den Forschungsstand. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Kriterien der Befindlichkeit, insbesondere Arbeitszufriedenheit und Arbeitsemotionen. Es werden verschiedene Definitionen von Arbeitszufriedenheit vorgestellt, sowie die Emotionstheroie nach Plutchik erläutert. Kapitel 3 beleuchtet die Arbeitszufriedenheitsforschung mit dem Fokus auf die explorative Studie von Temme und der „Affective-events-theory“ von Weiss und Cropanzano. Kapitel 4 befasst sich mit Personalentwicklung und deren Einfluss auf die Arbeitsemotionen, wobei die Konzepte des Human Resource Management und der Motivationsförderung durch Feedback und Gespräch im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitszufriedenheit, Arbeitsemotionen, Personalentwicklung, Human Resource Management, Motivationsförderung, Mitarbeiterintegration, Feedback, Gespräch, Affective-events-theory, explorative Studie, Emotionstheroie.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Emotionen die Arbeitszufriedenheit?
Emotionen sind ständige Begleiter am Arbeitsplatz. Positive Emotionen fördern die Motivation, während negative Emotionen wie Angst durch Arbeitsplatzunsicherheit die Zufriedenheit und Leistung senken können.
Was besagt die „Affective-events-theory“?
Diese Theorie von Weiss und Cropanzano erklärt, dass spezifische Ereignisse bei der Arbeit Emotionen auslösen, die wiederum das Verhalten und die langfristige Einstellung zur Arbeit prägen.
Welche Rolle spielt Personalentwicklung für Arbeitsemotionen?
Durch gezielte Personalentwicklung, Feedbackgespräche und wertschätzende Führung können Unternehmen das emotionale Klima verbessern und die Bindung der Mitarbeiter stärken.
Was ist das Konzept des Human Resource Management (HRM)?
HRM betrachtet Mitarbeiter als wichtigste Ressource. Ziel ist es, durch Integration und Motivationsförderung ein Umfeld zu schaffen, in dem sowohl Unternehmens- als auch Mitarbeiterziele erreicht werden.
Wie verbreitet ist Mobbing an deutschen Arbeitsplätzen?
Laut Studien war bereits jeder achte Beschäftigte in Deutschland Opfer von Mobbing, was die enorme Bedeutung eines gesunden Arbeitsklimas unterstreicht.
- Citation du texte
- M.A. Janine Romppel (Auteur), 2008, Der Einfluss von Emotionen auf die Arbeitszufriedenheit und die Integration des Konzeptes Human Resource Management , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204053