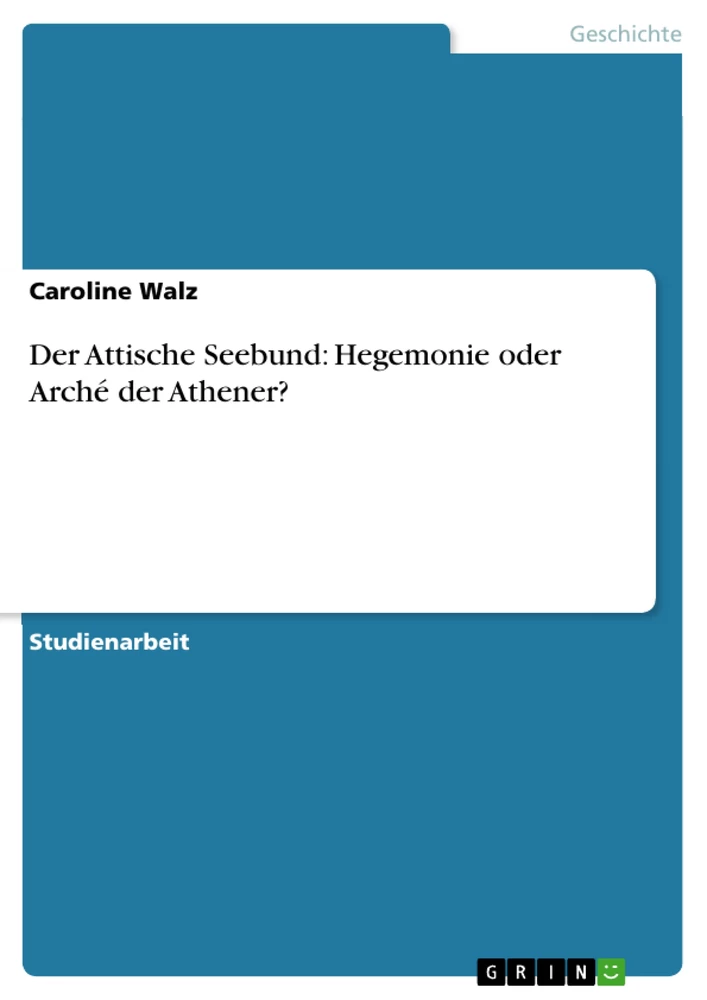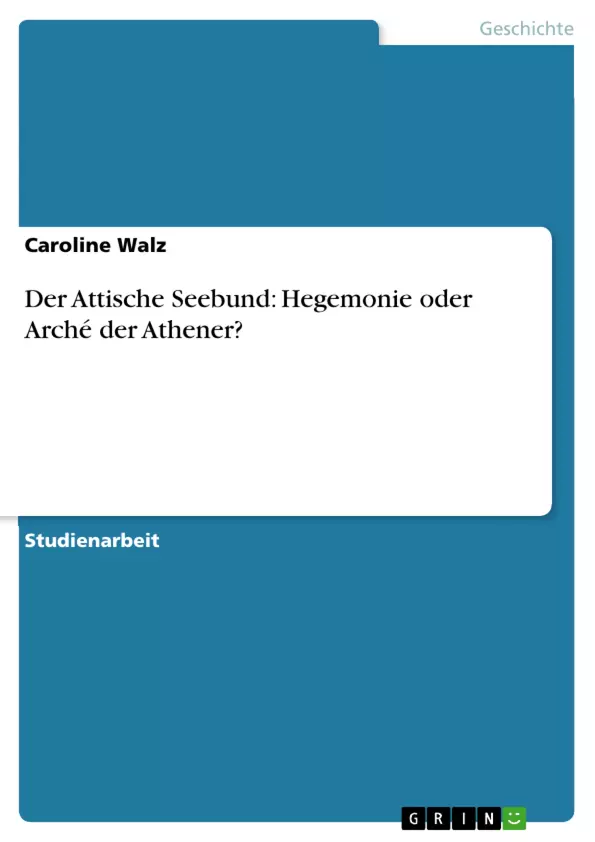Die Herrschaft der Athener im 5. Jahrhundert vor Christus ist ein Phänomen, das in der Forschung vielseitig thematisiert wird. Grundlage, auf der sich diese Macht entwickeln konnte, ist der 478/77 gegründete delisch-attische Seebund. Vielfach untersucht wird dieses Phänomen unter der Fragestellung, wann sich der Wandel von der Hegemonie zur Arché vollzogen hat, desweiteren auch, ob der Seebund Element einer imperialistischen Politik Athens war, oder nicht.
In dieser Arbeit soll die Entwicklung des Bundes unter der Fragestellung aufgezeigt werden, inwieweit der Begriff der Hegemonie angemessen erscheint und ob bereits bei der Gründung des Bundes von einer Arché gesprochen werden kann.
Zunächst werden die Ziele und die Struktur des Bundes vorgestellt, um anhand der Struktur die sich später entwickelnden Machtverhältnisse besser verstehen zu können und um zu sehen, inwieweit eine Arché bereits bei der Gründung des Bundes angelegt war.
Anschließend werden die ersten Unternehmungen des Bundes und seine weitere Entwicklung unter der Führung Kimons thematisiert und wie sich der Begriff der Hegemonie mit diesen Entwicklungen vereinbaren lässt.
Im dritten Kapitel wird zunächst die demokratische Herrschaftsform vorgestellt, da diese innenpolitische Entwicklung ebenfalls in Zusammenhang mit dem Seebund steht und daher nicht ausgelassen werden sollte. Daraufhin wird die Konsolidierungspolitik des Perikles behandelt, wobei auf die genaue Kriegsführung nicht eingegangen wird, da dies zu weit führen würde.
Abschließend wird auf die Machtideologie der Athener näher eingegangen: diese wird anhand der Rede der athenischen Gesandten in Sparta untersucht.
Die Arbeit endet mit der Politik des Perikles, auf die weitere Entwicklung bis zur Auflösung des Bundes kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden, da dies ebenfalls zu weit führen würde.
Wichtige Quellen, die für diese Arbeit herangezogen wurden, sind zum einen die Historien des Herodot, der peloponnesische Krieg des Thukydides und die Vitae Parallelae des Plutarch: aus diesen wurden die Biographien des Kimon und des Perikles verwendet, um die Entwicklungen des Bundes zu belegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Anfänge des Bundes
- Struktur und Ziele des Bundes
- Der Bund unter Kimon
- Der Bund als Arché
- Die Demokratie
- Konsolidierung des Bundes unter Perikles
- Die Machtideologie der Athener
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des delisch-attischen Seebundes vom Jahr 478/77 v. Chr. und analysiert, inwieweit der Begriff der Hegemonie zutreffend ist und ob bereits bei seiner Gründung von einer Arché gesprochen werden kann. Die Arbeit beleuchtet die Struktur und Ziele des Bundes, seine Entwicklung unter Kimon und Perikles, sowie die Rolle der athenischen Demokratie und Machtideologie.
- Struktur und Ziele des delisch-attischen Seebundes
- Entwicklung des Bundes unter Kimon
- Bedeutung der athenischen Demokratie für den Seebund
- Die athenische Machtideologie und ihre Auswirkung auf den Bund
- Die Frage der Hegemonie versus Arché im Kontext des Seebundes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Entwicklung des delisch-attischen Seebundes und die Frage, wann der Übergang von Hegemonie zu Arché stattfand. Sie analysiert die Ziele und die Struktur des Bundes, um zu verstehen, inwieweit eine Arché bereits bei der Gründung angelegt war. Die Arbeit untersucht die Entwicklung unter Kimon und Perikles und die athenische Machtideologie, um die Frage nach Hegemonie und Arché zu beantworten. Die verwendeten Quellen sind Herodot, Thukydides und Plutarch.
Die Anfänge des Bundes: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung des delisch-attischen Seebundes im Winter 478/77 v. Chr. durch Aristeides und Themistokles als Reaktion auf das autoritäre Verhalten des spartanischen Feldherrn Pausanias. Die unterschiedlichen Darstellungen der Hegemonieübernahme bei Thukydides, Herodot und Plutarch werden verglichen. Es wird analysiert, ob bereits zu diesem Zeitpunkt machtpolitisches Denken erkennbar war oder ob es sich um ein Bündnis mit bloßer Vormachtstellung Athens handelte. Die Struktur des Bundes wird im Detail untersucht, um diese Frage zu beantworten. Der Vergleich mit dem peloponnesischen Bund unter Spartanischer Führung wird gezogen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Machtverteilung aufzuzeigen. Die Ziele des attischen Seebundes werden als Fortsetzung der Perserkriege und Schutz der kleinasiatischen Hellenen beschrieben, zusätzlich wird Rache an den Persern als Motiv genannt. Die unbestimmte Formulierung der Symmachieverträge und die unbegrenzte Dauer des Bündnisses werden als Zeichen der Unterordnung der Bündner gegenüber Athen interpretiert. Die außenpolitische Entscheidungsfreiheit der Bundesgenossen wird als eingeschränkt, wenn nicht aufgehoben dargestellt, und die Verteilung der Beute sowie die Pflicht zur unbedingten Heeresfolge werden als Beleg für die Vormachtstellung Athens genannt.
Schlüsselwörter
Delisch-attischer Seebund, Hegemonie, Arché, Athen, Sparta, Kimon, Perikles, Demokratie, Machtideologie, Symmachie, Perserkriege, oi Athénaioi kai oi Symmachoi, phoroi.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum delisch-attischen Seebund
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des delisch-attischen Seebundes von 478/77 v. Chr. und analysiert die Frage, ob der Begriff der Hegemonie zutreffend ist und ob bereits bei Gründung von einer Arché gesprochen werden kann. Im Fokus stehen die Struktur und Ziele des Bundes, seine Entwicklung unter Kimon und Perikles sowie die Rolle der athenischen Demokratie und Machtideologie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Struktur und Ziele des delisch-attischen Seebundes, dessen Entwicklung unter Kimon, die Bedeutung der athenischen Demokratie für den Seebund, die athenische Machtideologie und deren Auswirkungen auf den Bund sowie die Frage nach Hegemonie versus Arché im Kontext des Seebundes.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Quellen Herodot, Thukydides und Plutarch.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Anfänge des Bundes (inkl. Struktur und Zielen, dem Bund unter Kimon), ein Kapitel über den Bund als Arché (inkl. der Demokratie, der Konsolidierung unter Perikles und der Machtideologie der Athener) und ein Fazit/Ausblick.
Was wird im Kapitel "Die Anfänge des Bundes" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung des Bundes im Winter 478/77 v. Chr. durch Aristeides und Themistokles als Reaktion auf Pausanias. Es werden verschiedene Darstellungen der Hegemonieübernahme verglichen (Thukydides, Herodot, Plutarch) und analysiert, ob bereits zu diesem Zeitpunkt machtpolitisches Denken erkennbar war. Die Struktur des Bundes wird detailliert untersucht und mit dem peloponnesischen Bund verglichen. Die Ziele des attischen Seebundes werden beschrieben (Fortsetzung der Perserkriege, Schutz kleinasiatischer Hellenen, Rache an den Persern). Die Symmachieverträge und die Machtverteilung werden im Hinblick auf die Vormachtstellung Athens interpretiert.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter?
Delisch-attischer Seebund, Hegemonie, Arché, Athen, Sparta, Kimon, Perikles, Demokratie, Machtideologie, Symmachie, Perserkriege, oi Athénaioi kai oi Symmachoi, phoroi.
Welche Frage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Frage ist der Zeitpunkt des Übergangs von Hegemonie zu Arché im delisch-attischen Seebund und die Analyse, inwieweit eine Arché bereits bei der Gründung angelegt war.
Welche Rolle spielt die athenische Demokratie im Kontext des Seebundes?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der athenischen Demokratie für die Entwicklung und den Charakter des Seebundes und wie diese die Machtstrukturen und Entscheidungsfindung beeinflusst hat.
Wie wird die athenische Machtideologie beschrieben?
Die Arbeit analysiert die athenische Machtideologie und deren Einfluss auf die Politik des Seebundes, insbesondere auf die Beziehungen zu den Bundesgenossen.
- Quote paper
- Caroline Walz (Author), 2008, Der Attische Seebund: Hegemonie oder Arché der Athener? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203788