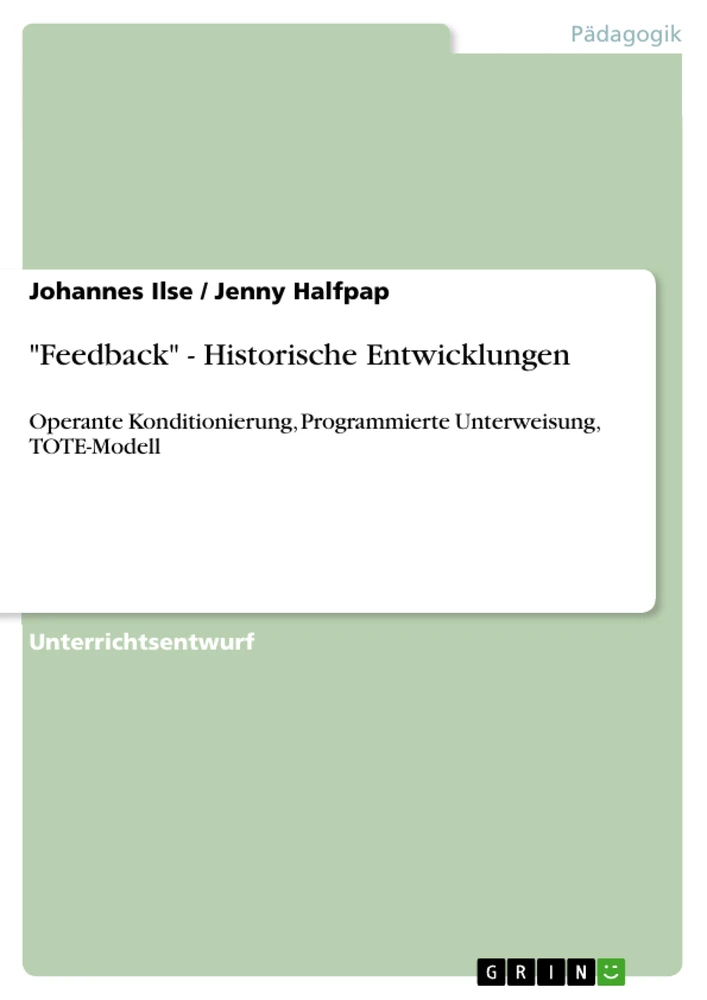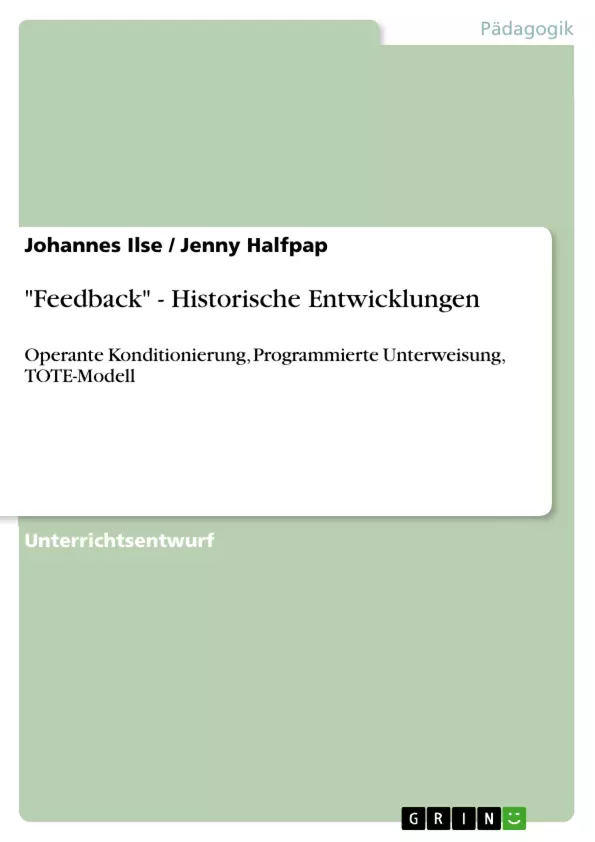Es wurden folgende Lernziele formuliert:
1. Grundprinzipien der operanten Konditionierung kennen.
2. Kenntnis von der Struktur einer programmierten Unterweisung haben.
3. Vor- und Nachteile der programmierten Unterweisung unter Beachtung der historischen Rahmenbedingungen einschätzen können.
4. Das Grundprinzip des TOTE-Modells verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriff „Feedback“
- 1.1 Brainstorming
- 1.2 Feedback im Alltag
- 1.3 Feedback in der programmierten Unterweisung
- 1.4 Feedback in der Kybernetik
- 1.5 Kybernetik vs. Behaviorismus
- 2. Operante Konditionierung
- 2.1 Grundlegende Merkmale
- 2.2 historische Vorläufer
- 2.3 Skinner-Box
- 2.4 Verstärkermechanismen
- 2.5 Kritik
- 2.6 klassische Konditionierung
- 2.7 Lernen am Modell
- 3. Programmierte Unterweisung
- 3.1 Definition
- 3.2 historischer Rahmen
- 3.3 Gestaltung einer PU
- 3.4 Verbindung zur operanten Konditionierung
- 3.5 Gruppenarbeit und Reflexion über die Durchführung
- 3.6 Diskussion der Vor- und Nachteile des Ansatzes
- 4. TOTE-Modell
- 4.1 historische Entwicklung
- 4.2 Aufbau des Modells
- 5. Fazit
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff „Feedback“ in verschiedenen Kontexten und beleuchtet dessen Bedeutung im Hinblick auf operante Konditionierung, programmierte Unterweisung und das TOTE-Modell. Ziel ist es, die historischen Entwicklungen und die jeweiligen Anwendungskonzepte von Feedback zu verstehen und zu vergleichen.
- Der Begriff „Feedback“ und seine unterschiedlichen Bedeutungen in Alltag, programmierter Unterweisung und Kybernetik.
- Die Prinzipien der operanten Konditionierung und ihre Relevanz für pädagogische Konzepte.
- Die programmierte Unterweisung als Anwendung der operanten Konditionierung und ihre Vor- und Nachteile.
- Das TOTE-Modell als kybernetisches Modell des Lernprozesses und seine Beziehung zu Feedback.
- Der Vergleich zwischen kybernetischem und behavioristischem Verständnis von Feedback und Lernen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriff „Feedback“: Dieses Kapitel beginnt mit einem Brainstorming zur Bedeutung von Feedback unter den Seminarteilnehmern, welches ein eher geringes Vorwissen aufzeigt. Anschließend werden drei Bereiche vorgestellt, in denen Feedback unterschiedliche Bedeutungen hat: Alltag (wo es die Wirkung auf andere reflektiert), programmierte Unterweisung (wo es als richtig/falsch-Indikator dient), und Kybernetik (wo es als Informationsquelle zum Vergleich von Ist- und Soll-Wert fungiert). Der Vergleich von Kybernetik und Behaviorismus verdeutlicht unterschiedliche Perspektiven auf den Lernprozess und die Rolle von Feedback.
2. Operante Konditionierung: Dieses Kapitel beschreibt die operante Konditionierung als Lernform, bei der Verhaltensweisen durch Verstärker oder Bestrafungen beeinflusst werden. Es werden die Merkmale, historische Vorläufer, die Skinner-Box als Beispiel und verschiedene Verstärkermechanismen erläutert. Kritikpunkte an der Theorie werden ebenso angesprochen wie der Vergleich zur klassischen Konditionierung und Lernen am Modell. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Verhalten, Konsequenzen und dem daraus resultierenden Lernprozess.
3. Programmierte Unterweisung: Dieses Kapitel befasst sich mit der programmierten Unterweisung als Anwendung der Prinzipien der operanten Konditionierung auf menschliches Lernen. Es werden die Definition, der historische Kontext, die Gestaltung solcher Unterweisungen und die Verbindung zur operanten Konditionierung detailliert beschrieben. Die Kapitel diskutieren Gruppenarbeit und Reflexionen zur Durchführung sowie Vor- und Nachteile dieses Ansatzes. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung und der Evaluierung dieser Lernmethode.
4. TOTE-Modell: Das Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung und dem Aufbau des TOTE-Modells. Es wird die Struktur des Modells erläutert und in den Kontext des Feedbacks gestellt, um den Lernprozess besser zu verstehen.
Schlüsselwörter
Feedback, Operante Konditionierung, Programmierte Unterweisung, TOTE-Modell, Kybernetik, Behaviorismus, Lernen, Verstärkung, Bestrafung, Rückmeldung, Lernprozess, Informationsquelle.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Feedback, Operante Konditionierung und Programmierte Unterweisung"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Begriff "Feedback" in verschiedenen Kontexten, insbesondere im Hinblick auf operante Konditionierung, programmierte Unterweisung und das TOTE-Modell. Es behandelt die historischen Entwicklungen, Anwendungskonzepte und einen Vergleich der verschiedenen Feedback-Arten. Zudem werden die Prinzipien der operanten Konditionierung, die programmierte Unterweisung als deren Anwendung und das TOTE-Modell als kybernetisches Lernmodell erläutert. Schließlich werden Kybernetik und Behaviorismus verglichen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Hauptthemen sind: der vielschichtige Begriff "Feedback" in Alltag, programmierter Unterweisung und Kybernetik; die Prinzipien der operanten Konditionierung und ihre Bedeutung für pädagogische Konzepte; die programmierte Unterweisung als Anwendung der operanten Konditionierung inklusive Vor- und Nachteile; das TOTE-Modell als kybernetisches Modell des Lernprozesses und seine Beziehung zu Feedback; sowie ein Vergleich des kybernetischen und behavioristischen Verständnisses von Feedback und Lernen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Hauptkapitel: 1. Begriff "Feedback", 2. Operante Konditionierung, 3. Programmierte Unterweisung, 4. TOTE-Modell und 5. Fazit. Zusätzlich gibt es ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Was wird im Kapitel "Begriff 'Feedback'" behandelt?
Dieses Kapitel beginnt mit einem Brainstorming zum Thema Feedback und zeigt ein anfänglich geringes Vorwissen der Seminarteilnehmer auf. Anschließend werden verschiedene Bedeutungen von Feedback in Alltag, programmierter Unterweisung und Kybernetik verglichen und die unterschiedlichen Perspektiven von Kybernetik und Behaviorismus auf den Lernprozess und die Rolle von Feedback beleuchtet.
Was wird im Kapitel "Operante Konditionierung" behandelt?
Dieses Kapitel erklärt die operante Konditionierung als Lernform, bei der Verhalten durch Verstärker oder Bestrafungen beeinflusst wird. Es werden Merkmale, historische Vorläufer, die Skinner-Box, verschiedene Verstärkermechanismen, Kritikpunkte, der Vergleich mit klassischer Konditionierung und Lernen am Modell erläutert. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Verhalten, Konsequenzen und dem daraus resultierenden Lernprozess.
Was wird im Kapitel "Programmierte Unterweisung" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die programmierte Unterweisung als Anwendung der operanten Konditionierung auf menschliches Lernen. Es beschreibt Definition, historischen Kontext, Gestaltung, Verbindung zur operanten Konditionierung, Gruppenarbeit, Reflexionen zur Durchführung sowie Vor- und Nachteile dieses Ansatzes. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung und Evaluation dieser Lernmethode.
Was wird im Kapitel "TOTE-Modell" behandelt?
Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung und den Aufbau des TOTE-Modells, erläutert dessen Struktur und stellt es in den Kontext von Feedback, um den Lernprozess besser zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Dokument?
Die Schlüsselwörter sind: Feedback, Operante Konditionierung, Programmierte Unterweisung, TOTE-Modell, Kybernetik, Behaviorismus, Lernen, Verstärkung, Bestrafung, Rückmeldung, Lernprozess, Informationsquelle.
Für wen ist dieses Dokument geeignet?
Dieses Dokument ist für alle geeignet, die sich mit den Themen Feedback, operante Konditionierung, programmierte Unterweisung und kybernetische Lernmodelle auseinandersetzen möchten, insbesondere im akademischen Kontext.
- Citar trabajo
- B.A. Johannes Ilse (Autor), Jenny Halfpap (Autor), 2010, "Feedback" - Historische Entwicklungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203333