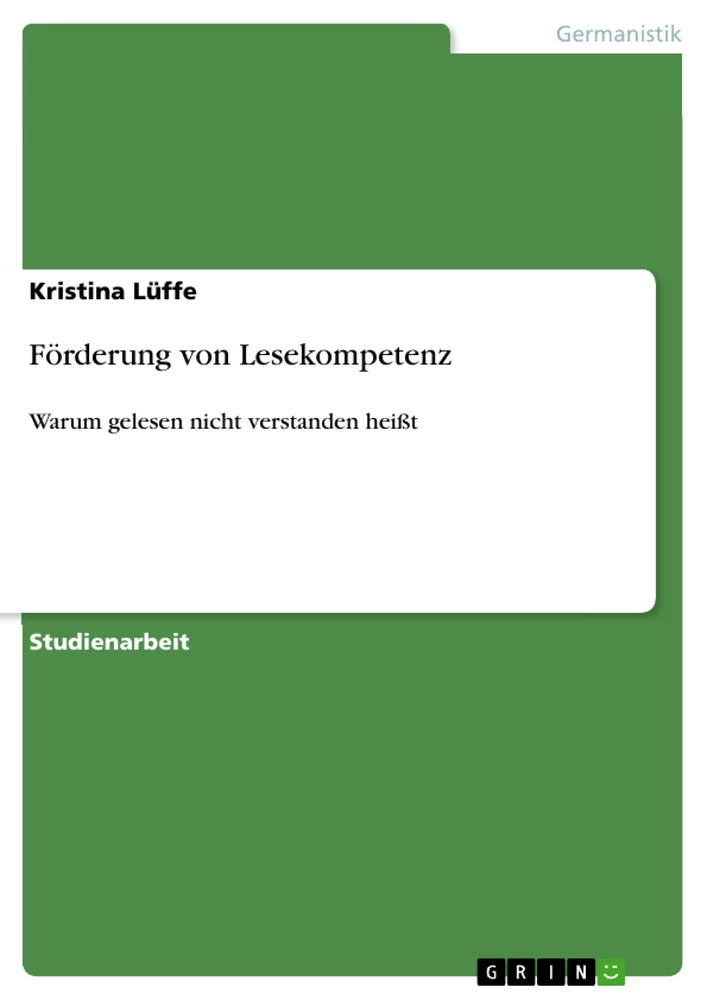Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ludwig Wittgenstein
Getreu dem Zitat von Ludwig Wittgenstein soll in dieser Arbeit das Problem der Defizite in der Lesekompetenz bei SchülerInnen (im Berufskolleg) behandelt werden. Es geht um die Leseförderung im Unterricht. Zu Beginn der Arbeit sollen geklärt werden was Lesekompetenz, beziehungsweise Lesen, beinhaltet. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie Lesen funktioniert. Was passiert aus neurobiologischer und psychologischer Sicht beim Lesen?
Nach dem theoretischen Einstieg soll im weiteren Verlauf der Arbeit die praktische Dimension der Leseförderung erörtert werden. Dafür wird zunächst geklärt, welche Stufen der Leseentwicklung unterschieden werden. Diese sollen mit dem nächsten Kapitel der Anforderung der Lesekompetenz im Berufskolleg verglichen werden. Wo stehen die SchülerInnen? Was wird von ihnen im Berufskolleg erwartet? Nur wenn die Lehrperson die Beobachtungen der Lesekompetenz der SchülerInnen richtig einordnen kann, ist sie in der Lage, das Lesen erfolgreich zu unterstützen. Denn sie muss aus der Vielzahl der Leseförderungsverfahren jenes für die SchülerInnen angemessen auswählen und anwenden können, damit eine Kompetenzförderung erfolgt. Dafür ist es unheimlich wichtig, den Lesevorgang genau zu beobachten und die Defizite differenziert wahrzunehmen, damit die Förderung genau greifen kann.
Dies soll die Basis für das letzte Kapitel sein; die Lesedidaktik im Berufskolleg. Was gibt es für Lesestrategien und –techniken? Was für Konzepte liegen vor und wie werden diese den SchülerInnen vermittelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lesekompetenz - eine Definition
- 3. Wie Lesen funktioniert
- 4. Lesekompetenz der SchülerInnen im Berufskolleg
- 4.1. Diagnose der Lesekompetenz
- 4.2. Methoden zur Leseförderung
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Defizite in der Lesekompetenz von Berufsschülern und konkrete Maßnahmen zur Leseförderung im Unterricht. Sie beleuchtet zunächst den Begriff der Lesekompetenz und den neurobiologischen und psychologischen Prozess des Lesens. Anschließend wird die praktische Anwendung von Leseförderungsmethoden im Berufsschulkontext erörtert, unter Berücksichtigung der jeweiligen Leseentwicklungsstufen der Schüler.
- Definition und Verständnis von Lesekompetenz
- Der Prozess des Lesens aus neurobiologischer und psychologischer Sicht
- Diagnose von Lesekompetenz bei Berufsschülern
- Methoden und Strategien der Leseförderung
- Lesedidaktik im Berufsschulkontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Lesekompetenzdefizite bei Berufsschülern ein und benennt das Ziel der Arbeit: die Erörterung von Leseförderung im Unterricht. Sie verweist auf das Zitat von Wittgenstein über die Grenzen der Sprache und stellt die Notwendigkeit der Leseförderung heraus, um die Grenzen der Welt der Schüler zu erweitern. Die Arbeit gliedert sich in theoretische Klärung des Lesens und der Lesekompetenz, sowie in die praktische Dimension der Leseförderung im Berufskolleg. Das Verständnis des Lesevorgangs und die differenzierte Wahrnehmung von Defiziten werden als Basis für effektive Leseförderung betont.
2. Lesekompetenz - eine Definition: Dieses Kapitel definiert Lesekompetenz als mehr als nur Dekodierfähigkeit. Es betont den interaktiven Prozess des Lesens, bei dem Textinhalte mit Vorwissen und Weltwissen des Lesers verknüpft werden. Die Lesbarkeit eines Textes hängt von der Art des Textes, dessen Inhalt und den Vorkenntnissen des Lesers ab. Das Kapitel bezieht sich auf das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix, das kognitive, motivationale, emotionale und soziale Aspekte des Lesens umfasst, um die Komplexität des Prozesses zu verdeutlichen und Defizite besser zu differenzieren.
3. Wie Lesen funktioniert: Dieses Kapitel beschreibt den Leseprozess detaillierter, indem es auf die Prozessebene des Mehrebenenmodells eingeht. Es erläutert die kognitiven Anforderungen des Lesens, von der Buchstaben- und Worterkennung bis hin zum Verständnis komplexer Satzstrukturen. Der "Wortüberlegenheitseffekt" und die Rolle des Vorwissens beim Aufbau mentaler Modelle werden diskutiert. Die Bedeutung von Top-down-Prozessen und der Einfluss von Vorwissen auf das Leseverständnis werden hervorgehoben.
4. Lesekompetenz der SchülerInnen im Berufskolleg: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die praktische Anwendung der Erkenntnisse im Berufsschulkontext. Es beleuchtet die Diagnose von Lesekompetenz bei Schülern und verschiedene Methoden der Leseförderung. Die Bedeutung der richtigen Einordnung von Beobachtungen der Lesekompetenz für die Lehrkraft wird betont, um eine angemessene und erfolgreiche Leseförderung zu gewährleisten. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Verfahren steht im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, Leseförderung, Berufsschule, Leseentwicklung, Lesedidaktik, Textverstehen, Mehrebenenmodell, Diagnose, Lesestrategien, Vorwissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lesekompetenz bei Berufsschülern
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Defizite in der Lesekompetenz von Berufsschülern und erörtert konkrete Maßnahmen zur Leseförderung im Unterricht. Sie beleuchtet den Begriff der Lesekompetenz, den Prozess des Lesens und die praktische Anwendung von Leseförderungsmethoden im Berufsschulkontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Verständnis von Lesekompetenz, den Prozess des Lesens aus neurobiologischer und psychologischer Sicht, Diagnose von Lesekompetenz bei Berufsschülern, Methoden und Strategien der Leseförderung und Lesedidaktik im Berufsschulkontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Lesekompetenz, zum Prozess des Lesens, zur Lesekompetenz bei Berufsschülern (inkl. Diagnose und Fördermethoden) und einen Schluss. Die Einleitung beinhaltet ein Zitat von Wittgenstein und die Notwendigkeit der Leseförderung. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Lesevorgangs und der differenzierten Wahrnehmung von Defiziten als Basis für effektive Leseförderung.
Wie wird Lesekompetenz definiert?
Lesekompetenz wird nicht nur als Dekodierfähigkeit definiert, sondern als interaktiver Prozess, bei dem Textinhalte mit Vorwissen und Weltwissen des Lesers verknüpft werden. Die Lesbarkeit eines Textes hängt von Textart, Inhalt und Vorkenntnissen des Lesers ab. Das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix (kognitive, motivationale, emotionale und soziale Aspekte) wird zur Veranschaulichung der Komplexität herangezogen.
Wie wird der Leseprozess beschrieben?
Der Leseprozess wird detailliert beschrieben, von der Buchstaben- und Worterkennung bis zum Verständnis komplexer Satzstrukturen. Der "Wortüberlegenheitseffekt", die Rolle des Vorwissens beim Aufbau mentaler Modelle, Top-down-Prozesse und der Einfluss von Vorwissen auf das Leseverständnis werden erläutert.
Wie wird die Lesekompetenz von Berufsschülern diagnostiziert und gefördert?
Das Kapitel zur Lesekompetenz von Berufsschülern konzentriert sich auf die Diagnose von Defiziten und die Anwendung verschiedener Fördermethoden im Berufsschulkontext. Die richtige Einordnung von Beobachtungen und die Auswahl geeigneter Verfahren stehen im Mittelpunkt, um eine angemessene und erfolgreiche Leseförderung zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Lesekompetenz, Leseförderung, Berufsschule, Leseentwicklung, Lesedidaktik, Textverstehen, Mehrebenenmodell, Diagnose, Lesestrategien, Vorwissen.
Welche konkreten Methoden der Leseförderung werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt zwar verschiedene Methoden der Leseförderung, geht aber nicht im Detail auf konkrete Methoden ein. Der Fokus liegt auf der Diagnose und der Auswahl geeigneter Verfahren im Berufsschulkontext, angepasst an die jeweiligen Leseentwicklungsstufen der Schüler.
- Arbeit zitieren
- Kristina Lüffe (Autor:in), 2011, Förderung von Lesekompetenz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200678