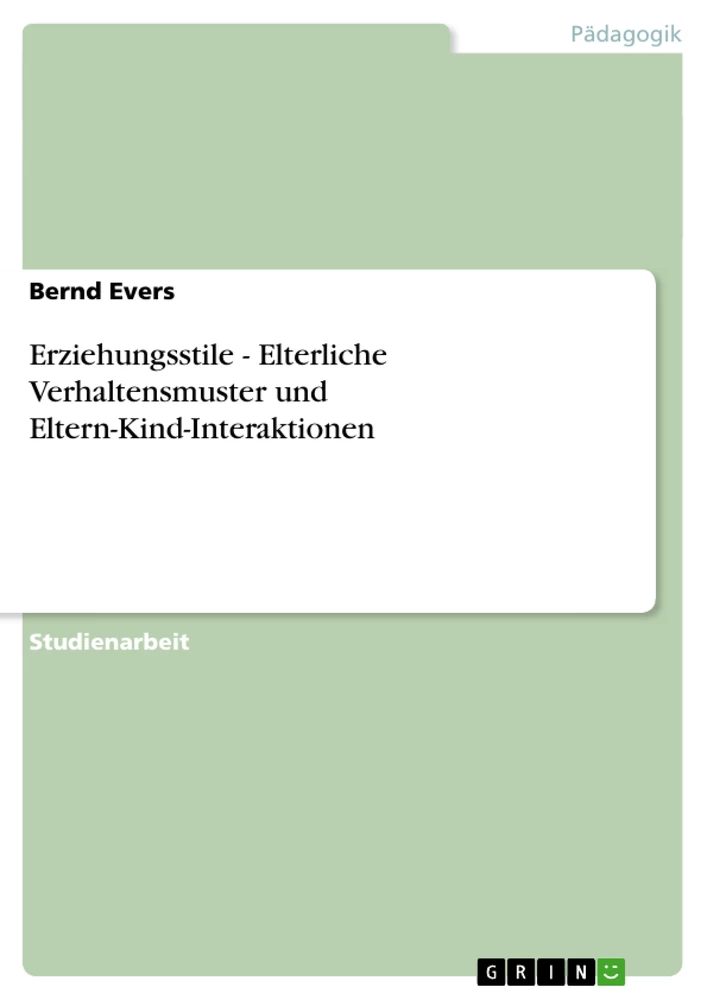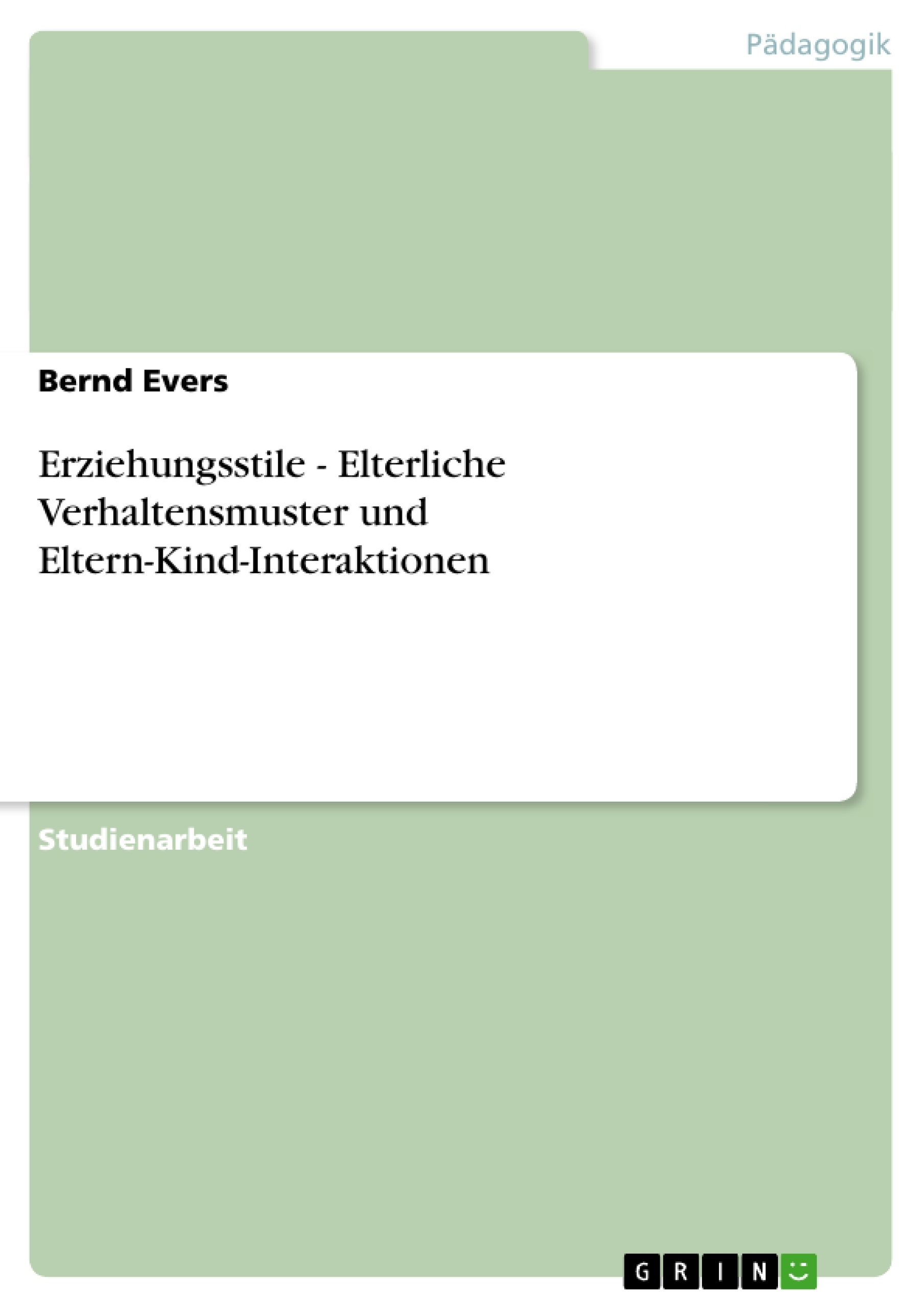Die Erziehungsstilforschung ist ein Teilgebiet der Sozialisationsforschung. Der Begriff des Erziehungsstils selb st stellt ein sehr globales Konzept dar und ist in der Forschung nicht unumstritten. Erziehungsstile können allgemein definiert werden als „ein Bündel verschiedener stabiler Merkmale, die sich aus den Verhaltenweisen und erziehungsbezogenen Einstellungen von Eltern gegenüber ihrer Kinder ergeben“. Die Erziehungsstilforschung untersucht Eigenarten elterlicher Erziehungspraktiken und -einstellungen und befasst sich dabei vor allem mit den Zusammenhängen zwischen den unterschiedlichen Erziehungsstilen und den Auswirkungen auf die kindliche Persönlichkeit. Dabei werden Merkmale wie Selbstkonzept, Moralentwicklung, Aggression, soziale Kompetenz, Attributionsmuster, Übernahme von Verantwortung etc. untersucht. Die Forschung geht von der Annahme aus, dass „Eltern in ihrem erziehungsbezogenen Erleben und Verhalten allgemein und stabil zu beschreiben sind“, dass sie sich darin systematisch unterscheiden, und dass mit diesen Variablen die kindliche Entwicklung vorhergesagt werden kann.Erziehungsstile seien, wie Damon betont, so „wechselhaft wie die Mode“. Was noch vor zehn Jahren als guter Erziehungsstil gesehen wurde, wird heute oftmals abgelehnt. Der Blick auf die unterschiedlichen Erziehungsstile in der Kinderrechtsbewegung der 70er Jahre und innerhalb der Gegenreaktion in den 80ern zeigt, dass das, was noch vor zehn Jahren als guter Erziehungsstil gesehen wurde, wenige Jahre später, oftmals abgelehnt würde. Heute, so Damon weiter, existieren in der westlichen Gesellschaft verschiedene Erziehungsstile nebeneinander. Die moderne Erziehungsstilforschung fußt auf Erkenntnissen, die relativ weit zurückliegen. Als Begründer der Erziehungsstilforschung werden die Untersuchungen von Lewin in den späten 1930er Jahren und von Baldwin in den 40er Jahren gesehen. Baldwins Untersuchungsmethoden, zusammen mit Kalhorn und Breese (1945) und Champney (1941) in den sog. Fels-Studien als „Fels Behavior Scales“ bekannt geworden, die Analyse von Eltern- Kind-Interaktionen mittels erziehungsbezogener Fragebögen und langfristiger Beobachtungen, ist bis in die Gegenwart die häufigste Herangehensweise an den Forschungsgegenstand geblieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erziehungsstile – Elterliche Verhaltensmuster und Eltern-Kind-Interaktionen
- Die traditionelle Erziehungsstilforschung
- Sears, Maccoby und Levin (1957): Aggression und kindliches Verhalten
- A. Baldwin (1943): Demokratie in Eltern-Kind-Beziehungen
- D. Baumrind (1967): Drei Hauptmuster elterlichen Erziehungsstils
- Alternative Forschungsansätze
- R.Q. Bell (1968): Eltern-Kind-Interaktion als wechselseitige Beziehung
- K.A. Schneewind (1994): Eltern-Kind-Interaktion als transaktionaler Prozess
- Belsky (1984): Das Prozessmodell elterlichen Erziehungsverhaltens
- H. Lukesch (1976): Die Gliederung von Erziehungsstilmerkmalen nach formalen Gesichtspunkten
- M. Lepper (1983): Das Prinzip des minimal erforderlichen Anreizes
- R. Tausch & A. M. Tausch (1965): Achtung-Wärme, einfühlendes Verstehen und Echtheit-Fassadenfreiheit als Determinanten für die Qualität von Erziehung
- Goodnow (1985); B. Pikowsky & M. Hofer (1992): Variabilität von Erziehungszielen
- Die traditionelle Erziehungsstilforschung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erziehungsstilforschung und deren Entwicklung im 20. Jahrhundert. Ziel ist es, die wichtigsten Arbeiten und deren Ergebnisse aufzuzeigen, insbesondere die Zusammenhänge, Übereinstimmungen und Widersprüche zwischen den Studien zu beleuchten. Darüber hinaus werden die zentralen Erkenntnisse der Erziehungsstilforschung bis in die Gegenwart dargestellt, ebenso wie die ungeklärten Fragen.
- Die Entwicklung der Erziehungsstilforschung im 20. Jahrhundert
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf Erziehungsstile und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung
- Die Relevanz von traditionellen und modernen Forschungsansätzen
- Die Bedeutung von Eltern-Kind-Interaktion für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Die Herausforderungen und offenen Fragen in der aktuellen Erziehungsstilforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Erziehungsstilforschung ein und definiert den Begriff des Erziehungsstils. Es werden die zentralen Fragestellungen der Forschung erläutert, wie die Auswirkungen unterschiedlicher Erziehungsstile auf die kindliche Persönlichkeit. Die Arbeit fokussiert auf die Forschungslandschaft des 20. Jahrhunderts und strebt ein vollständiges Bild der Erziehungsstilforschung an.
Kapitel 2.1 befasst sich mit der traditionellen Erziehungsstilforschung und beleuchtet verschiedene Ansätze und Studien. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Sears, Maccoby und Levin (1957), die den Einfluss permissiver und restriktiver Erziehungsstile auf Aggression und kindliches Verhalten untersuchten. Weiterhin werden die Arbeiten von Baldwin (1943) und Baumrind (1967) vorgestellt, die sich mit der Bedeutung von Demokratie in Eltern-Kind-Beziehungen und den drei Hauptmustern elterlichen Erziehungsstils auseinandersetzten.
Kapitel 2.2 stellt alternative Forschungsansätze zur traditionellen Erziehungsstilforschung vor. Es werden die Arbeiten von Bell (1968), Schneewind (1994), Belsky (1984), Lukesch (1976), Lepper (1983), Tausch & Tausch (1965) und Goodnow (1985) sowie Pikowsky & Hofer (1992) beleuchtet. Diese Ansätze untersuchen Eltern-Kind-Interaktion als wechselseitigen Prozess und thematisieren Faktoren wie Variabilität von Erziehungszielen und das Prinzip des minimal erforderlichen Anreizes.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Erziehungsstile, Eltern-Kind-Interaktion, Sozialisationsforschung, traditionelle Erziehungsstilforschung, alternative Forschungsansätze, Aggression, kindliches Verhalten, Demokratie, Eltern-Kind-Beziehungen, wechselseitige Beziehung, transaktionaler Prozess, Erziehungsverhalten, Erziehungsziele, Anreize, Wärme, Verständnis, Echtheit, Variabilität.
- Quote paper
- Bernd Evers (Author), 2003, Erziehungsstile - Elterliche Verhaltensmuster und Eltern-Kind-Interaktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19994