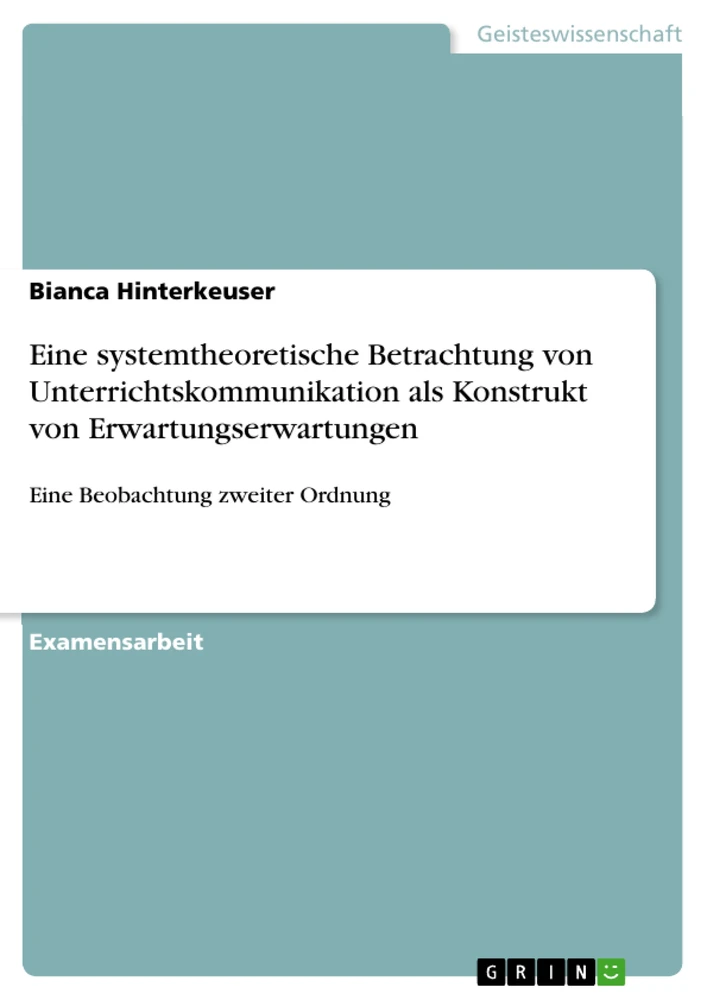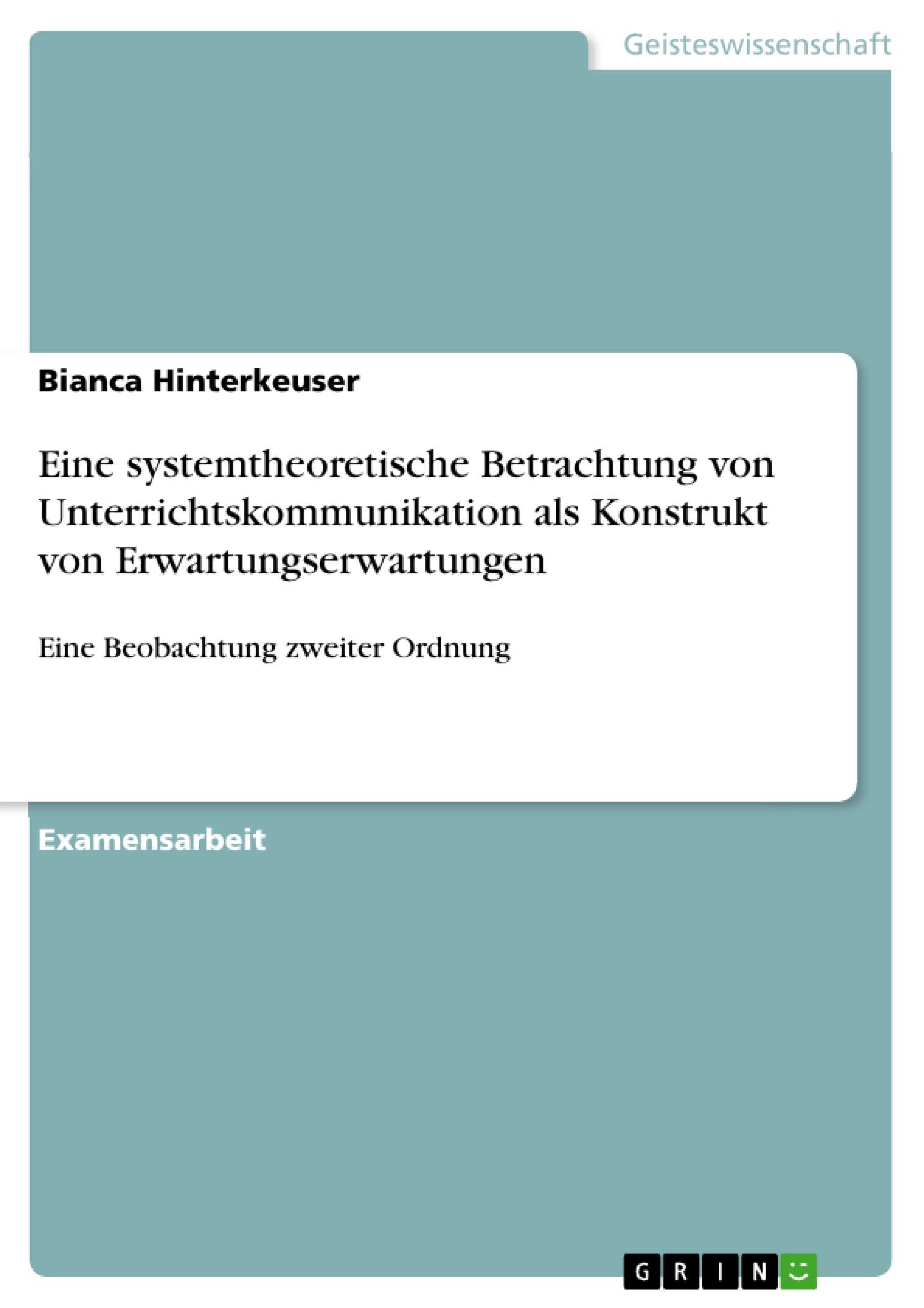Die im Grundgesetz verankerte staatliche Aufsicht über das gesamte Schulwesen weist der Schule als einer zentralen Institution unserer Gesellschaft die Funktion und Aufgabe zu, Schüler chancengleich zu unterrichten und damit den nachfolgenden Generationen die grundlegenden Bedingungen für ein produktives und integriertes Leben innerhalb der gesellschaftlichen Systeme zu verschaffen.
(...)
Die Qualität der Bildungsabschlüsse und des dadurch definierten Bildungserfolgs oder Bildungsmisserfolgs hat erheblichen Einfluss auf die spätere Integration der Schüler in unsere Gesellschaft und deren Struktur, was es erforderlich macht, die vielfältigen Umstände zu ergründen, die zu einer derartigen Schieflage im Bildungssystem führen können.
(...)
In der vorliegenden Examensarbeit soll diesen Bedingungen [unter denen Unterrichtskommunikation stattfindet] aus der Perspektive der Systemtheorie Niklas Luhmanns nachgegangen werden.
Die von Luhmann entwickelte Theorie der sozialen Systeme, im Rahmen derer je spezifische Kommunikationen als Grundeinheiten gesellschaftskonstituierender funktionaler Teilsysteme identifiziert und analysiert werden, erscheint vor diesem Hintergrund in besonderer Weise zu einer Analyse kommunikativer Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten geeignet, die zur beklagten Mangelhaftigkeit des Erziehungs- bzw. Schulsystems beitragen.
(...)
Die analytische Grundoperation Luhmanns, Kommunikationssysteme und Bewusstseinssysteme in ihren Operationen als strikt voneinander getrennt agierend zu beobachten, macht es dabei möglich, Kommunikation auf eine andere Weise zu behandeln, als es die eher informationstheoretisch begründeten Kommunikationstheorien auf der Basis von Sender-Empfänger-Modellen erlauben.
(...)
In diesem Sinne soll im Folgenden untersucht werden, wie das Unterrichtssystem heute welche Funktionen in der und für die Gesell-schaft erfüllt und welcher Dynamik es dabei folgt. Auf Grundlage dieser Untersuchung soll eine Antwort versucht werden, ob ein Bildungsmisserfolg – der ja auf Grundlage bestimmter Unterscheidungen als solcher erst definiert wird – im Zusammenhang mit den Bedingungen, unter denen sich Unterrichtskommunikation in unseren Schulen vollzieht, steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildung und Wissen
- Wissenserwerb
- Erkenntnislernen
- Nachahmungslernen
- Vertrauen
- Wissenserwerb
- Unterrichtskommunikation
- Verstehen
- Verstehen in der Unterrichtskommunikation
- Erwartungen und Erwartungserwartungen
- Erwartungserfüllungen
- Abweichendes Verhalten
- Der heimliche Lehrplan
- Didaktik als Regulativ von Erwartungserwartungen
- Montessoripädagogik
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Unterrichtskommunikation als Konstrukt von Erwartungserwartungen und analysiert die Rolle von Vertrauen und Verstehen im Bildungsprozess. Sie befasst sich mit den Auswirkungen von Erwartungserwartungen auf den Lernerfolg und die Bedeutung von didaktischen Konzepten für die Gestaltung einer effektiven Unterrichtskommunikation.
- Wissenserwerb und die Rolle von Erkenntnis- und Nachahmungslernen
- Vertrauen als Grundlage für effektive Unterrichtskommunikation
- Das Konzept der Erwartungserwartungen und deren Einfluss auf das Lernverhalten
- Der heimliche Lehrplan und seine Relevanz für die Bildungspraxis
- Die Rolle der Didaktik bei der Steuerung von Erwartungserwartungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Herausforderungen des deutschen Bildungssystems und die Bedeutung von Schulabschlüssen für die spätere Integration von Schülern in die Gesellschaft. Sie präsentiert unterschiedliche Perspektiven auf die Ursachen für Bildungsdefizite und die Notwendigkeit, Bildungserfolg zu fördern.
Das Kapitel "Bildung und Wissen" befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Wissenserwerbs, insbesondere dem Erkenntnislernen und dem Nachahmungslernen. Es wird die Rolle von Vertrauen im Bildungsprozess untersucht und dessen Einfluss auf die Unterrichtskommunikation analysiert.
Das Kapitel "Unterrichtskommunikation" fokussiert auf das Konzept des Verstehens im Kontext der Unterrichtskommunikation. Es beleuchtet die Bedeutung von Erwartungen und Erwartungserwartungen und untersucht deren Einfluss auf das Verhalten von Schülern und Lehrkräften.
Das Kapitel "Der heimliche Lehrplan" untersucht die impliziten Lerninhalte und -ziele, die im Unterricht vermittelt werden, unabhängig von expliziten Lehrplänen. Es beleuchtet den Einfluss von Erwartungen und Werten auf die Lernkultur.
Das Kapitel "Didaktik als Regulativ von Erwartungserwartungen" befasst sich mit der Rolle der Didaktik bei der Gestaltung und Steuerung von Erwartungserwartungen im Unterricht. Es beleuchtet verschiedene didaktische Konzepte, die zur Gestaltung effektiver Unterrichtskommunikation beitragen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Unterrichtskommunikation, Erwartungserwartungen, Bildung und Wissen, Verstehen, Vertrauen, heimlicher Lehrplan, Didaktik, und Montessoripädagogik. Es werden die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen im Kontext von Bildungsprozessen und Lernerfolg untersucht.
- Quote paper
- Bianca Hinterkeuser (Author), 2009, Eine systemtheoretische Betrachtung von Unterrichtskommunikation als Konstrukt von Erwartungserwartungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199579