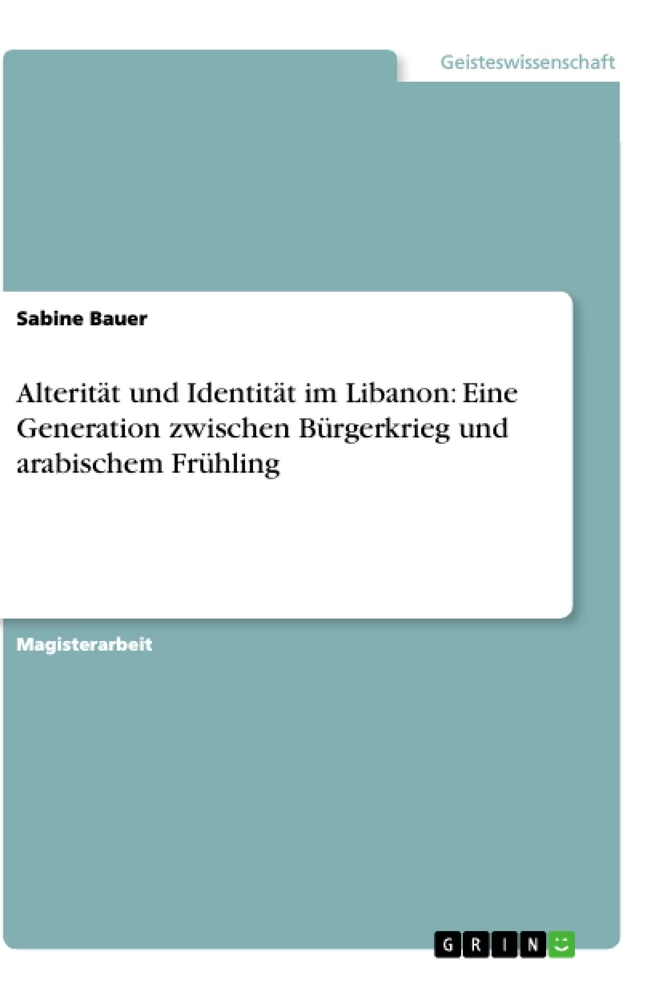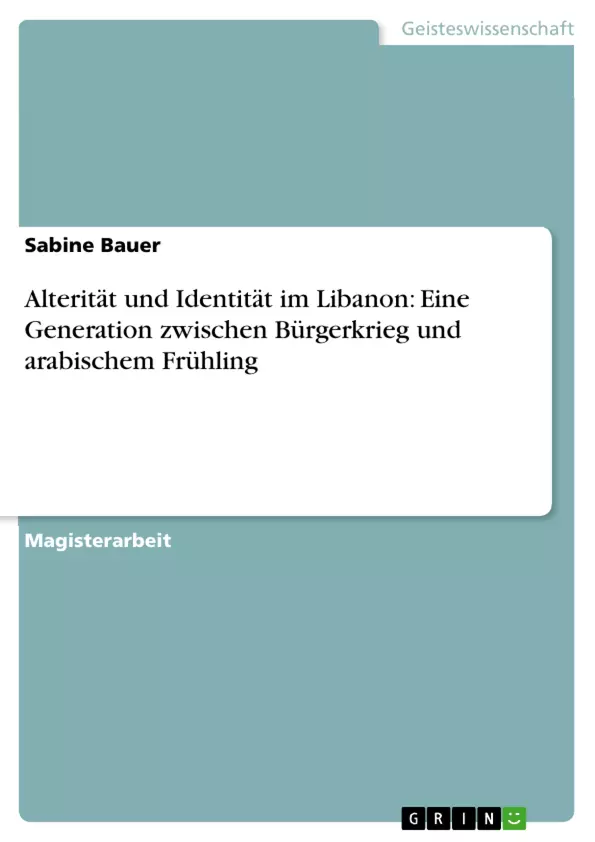Im Jahr 2011 veränderte sich für viele Millionen Menschen ihre Alltagswelt. Despoten
wurden gestürzt, Regime in Frage gestellt und dem angestauten Unmut Luft gemacht.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich eine Protestbewegung von Tunesien über Nordafrika
und den Nahen und Mittleren Osten, bis sie schließlich auch in Form von
Flüchtlingsströmen Europa erreichte.
Ein Land im Herzen des Nahen Ostens wird eher selten im Zusammenhang mit dem
arabischen Frühling erwähnt- der Libanon. Dennoch kam es auch in dem kleinen Staat
an der Levante zu Demonstrationen und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften.
Hier streiten sich seit Jahrhunderten und vermehrt seit Ausbruch des Bürgerkriegs
Historiker, Politiker und Kleriker über die Existenz einer nationalen Identität und wie
diese auszusehen habe. Die mehrdeutige Identität des Landes spaltete dessen
Bevölkerung entlang lokaler, nationaler und ideologischer Linien. Entlang dieser entstand
ein konfliktträchtiges Spannungsfeld kommunaler, staatlicher und nationaler Grenzen,
welche die Frage nach der Identität sehr problematisch gestalten. Besonders betroffen
sind Grenzregionen, die zudem noch dem Einfluss externer Identitäten und Mächte
unterstehen. Daher entstand im Libanon eine hohe Sensitivität gegenüber sozialer
Kohärenz und nationaler Einheit. Im weitgefächerten Spektrum der libanesischen
Gesellschaft, ist religiöser Kommunalismus die vorherrschende Identität. Daher herrscht
seit langem die Forderung nach einer Säkularisierung, um die trennende Kluft zu
überwinden.
Trotz dieser heiklen Problematik in einem Land mit mehr als 18 verschiedenen
Konfessionsgruppen, kommt es auch hier zu Protesten, vornehmlich von Studenten und
Intellektuellen. Nun stellt sich die Frage, ob diese vom arabischen Frühling beeinflusst
waren. Hatte dieser die Wahrnehmung von nationaler Identität und Alterität, von „wir“ und
„sie“, verändert? Oder sind die Ursachen dem Lande selbst immanent? Was macht die
protestierenden Studenten und ihre Lebenswelt so unterschiedlich von den Taxifahrern?
Welche Rolle spielt dabei das Lauffeuer der arabischen Proteste in nächster Umgebung
des Libanon?
Rund um den Libanon ruft man „Das Volk will den Fall des Systems!“7 Auch
Studenten im Libanon stimmen am 27. Januar unbemerkt vom Rest der Welt in den
Kanon ein. Ein Ergebnis der Protestwelle oder der innerlibanesischen Veränderungen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hintergrund der Arbeit
- 1.2 Konzeptionelle Vorüberlegungen
- 1.3 Zielsetzung
- 1.4 Aufbau und Vorgehensweise
- 1.5 Arbeitsmethoden
- 1.6 Fachgebundener Kontext zu „kollektiver Identität“
- 2 Theoretische Verortung
- 2.1 Identitätsdiskurs für den Libanon
- 2.2 Der „Nationalismusbegriff“ und „nationale Identität“ in der Ethnologie
- 2.3 Festlegung der Arbeitsdefinition
- 3 Methodik der Forschung
- 3.1 Entwicklung der Fragestellung
- 3.2 Auswahl und Bedeutung des Ortes
- 3.3 Bestimmung der Zielgruppe
- 3.4 Interviews
- 3.5 Entwicklung des Leitfadens
- 3.6 Selbstreflexion
- 3.7 Schwierigkeiten der Forschung
- 4 Zeitlicher und ethnographischer Kontext
- 4.1 Hintergründe
- 4.1.1 Der arabische Frühling
- 4.1.2 Ausgangssituation im Libanon
- 4.2 Ethnographie des Libanon
- 4.2.1 Bevölkerungszusammensetzung
- 4.2.2 Nationalpakt und Proporzsystem
- 4.2.3 Demographische Entwicklungen
- 4.3 Geschichte und Geschichtsschreibung im Libanon
- 4.3.1 Grundzüge der libanesischen Geschichte
- 4.3.2 Entstehung des libanesischen Feudalsystems und traditioneller Loyalitäten
- 4.3.3 Auseinandersetzungen und Koexistenz: das schwierige Verhältnis der Gruppen
- 4.3.4 Der libanesische Bürgerkrieg und sein Vermächtnis
- 4.3.5 Entwicklungen seit Taif
- 4.3.6 Synthese
- 5 Auswertung der Empirie: Wandel von Identität und Alterität
- 5.1 Entwicklungen im Libanon: Veränderungen des „Wir“ und „Sie“
- 5.2 Einflüsse und Erfahrungen der Postbürgerkriegsgeneration
- 5.3 Inkongruenz und Spannungsfelder
- 5.4 Aufkommen einer neuen nationalen Jugendbewegung
- 5.5 Synthese
- 6 Analyse der Veränderungen
- 6.1 Anvisierte „Grammatik der Segmentierung“ im Abkommen von Taif
- 6.2 Die konkurrierende „Grammatik der Vereinnahmung“ der libanesischen Taifiya
- 6.3 Erfahrungen der „Grammatik der Orientalisierung“ am Beispiel der Zedernrevolution
- 6.4 Synthese: Veränderungen in der Konstruktion von identity/alterity
- 7 Diskussion: Sind die Proteste im Libanon in den Arabischen Frühling einzuordnen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen in Identität und Alterität der Postbürgerkriegsgeneration im Libanon im Kontext des „Arabischen Frühlings“ von 2011. Ziel ist es, die Auswirkungen des libanesischen Bürgerkriegs und anderer historischer Ereignisse auf die Identitätsbildung junger Libanesen zu analysieren und die Frage zu beantworten, inwieweit die Proteste von 2011 als Teil des „Arabischen Frühlings“ verstanden werden können.
- Identitätsbildung im post-konfessionellen Libanon
- Der Einfluss des libanesischen Bürgerkriegs auf die Identität junger Menschen
- Die Rolle von globalen Einflüssen und der Diaspora
- Neue Formen der Kommunikation und Interaktion (Soziale Medien)
- Die Einordnung der Proteste von 2011 in den Kontext des „Arabischen Frühlings“
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es den Hintergrund, die konzeptionellen Überlegungen, die Zielsetzung, den Aufbau und die Methodik der Forschungsarbeit erläutert. Es wird der fachgebundene Kontext zur „kollektiven Identität“ definiert und die Bedeutung des Themas für die weitere Untersuchung skizziert. Die Einleitung liefert somit einen umfassenden Überblick über den Forschungsansatz und die Struktur der gesamten Arbeit.
2 Theoretische Verortung: Dieses Kapitel verortet die Arbeit theoretisch, indem es den Identitätsdiskurs im Libanon beleuchtet, den Nationalismusbegriff und die nationale Identität in der Ethnologie diskutiert und eine Arbeitsdefinition festlegt. Es schafft somit die theoretische Grundlage für die Analyse der empirischen Daten und bietet ein Verständnis der zentralen Konzepte, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
3 Methodik der Forschung: Das Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Forschung, einschließlich der Entwicklung der Fragestellung, der Auswahl des Forschungsortes, der Bestimmung der Zielgruppe, der Durchführung von Interviews, der Entwicklung des Leitfadens, der Selbstreflexion und der Schwierigkeiten, die während der Forschung auftraten. Es liefert somit eine transparente Darstellung des Forschungsprozesses und ermöglicht eine kritische Bewertung der Ergebnisse.
4 Zeitlicher und ethnographischer Kontext: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über den historischen und sozio-politischen Kontext des Libanon, einschließlich des arabischen Frühlings, der Ausgangssituation im Libanon, der Bevölkerungszusammensetzung, des Nationalpakts und des Proporzsystems, demografischer Entwicklungen und der libanesischen Geschichte. Es beleuchtet die komplexen historischen und sozialen Faktoren, die die Identitätsbildung im Libanon prägen.
5 Auswertung der Empirie: Wandel von Identität und Alterität: Dieses Kapitel präsentiert die Auswertung der empirischen Daten, die im Rahmen der Feldforschung erhoben wurden. Es analysiert die Veränderungen in Identität und Alterität der Postbürgerkriegsgeneration, beleuchtet den Wandel des „Wir“ und „Sie“, untersucht die Einflüsse und Erfahrungen dieser Generation, und erörtert die daraus resultierenden Inkongruenzen und Spannungsfelder. Die Ergebnisse bieten Einblicke in die komplexen Identitätsprozesse in der jungen Generation Libanons.
6 Analyse der Veränderungen: Dieses Kapitel analysiert die im vorherigen Kapitel dargestellten Veränderungen im Kontext bestehender theoretischer Modelle und diskutiert die "Grammatiken" der Segmentierung und Vereinnahmung, sowie die Erfahrung der "Grammatik der Orientalisierung". Es vertieft das Verständnis der Identitätsprozesse und ihrer Veränderungen. Es verbindet die empirischen Befunde mit den theoretischen Überlegungen, um ein umfassenderes Bild der komplexen Dynamiken zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Libanon, Identität, Alterität, Postbürgerkriegsgeneration, Arabischer Frühling, Nationalismus, Konfession, Identitätsdiskurs, Ethnologie, Taif-Abkommen, Zedernrevolution, Soziale Medien, Diaspora, Identitätswandel.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Wandel von Identität und Alterität in der Postbürgerkriegsgeneration des Libanon
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Identität und Alterität innerhalb der Postbürgerkriegsgeneration im Libanon, insbesondere im Kontext des Arabischen Frühlings 2011. Sie analysiert die Auswirkungen des libanesischen Bürgerkriegs und anderer historischer Ereignisse auf die Identitätsbildung junger Libanesen und untersucht, inwiefern die Proteste von 2011 als Teil des Arabischen Frühlings verstanden werden können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) bietet einen Überblick über die Arbeit, ihre Zielsetzung und Methodik. Kapitel 2 (Theoretische Verortung) legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Kapitel 3 (Methodik der Forschung) beschreibt detailliert den Forschungsprozess. Kapitel 4 (Zeitlicher und ethnographischer Kontext) liefert den historischen und sozio-politischen Hintergrund des Libanon. Kapitel 5 (Auswertung der Empirie) präsentiert die Auswertung der empirischen Daten und analysiert den Wandel von Identität und Alterität. Kapitel 6 (Analyse der Veränderungen) analysiert die Veränderungen im Kontext bestehender theoretischer Modelle. Kapitel 7 (Diskussion) diskutiert die Einordnung der libanesischen Proteste in den Arabischen Frühling.
Welche zentralen Themen werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Themen sind die Identitätsbildung im post-konfessionellen Libanon, der Einfluss des Bürgerkriegs auf die Identität junger Menschen, die Rolle globaler Einflüsse und der Diaspora, neue Formen der Kommunikation (Soziale Medien) und die Einordnung der Proteste von 2011 in den Kontext des Arabischen Frühlings.
Welche Methoden wurden in der Forschung angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, insbesondere Interviews mit einer definierten Zielgruppe im Libanon. Der Forschungsprozess wird transparent dargestellt, einschließlich der Entwicklung der Fragestellung, der Auswahl des Forschungsortes, der Entwicklung des Leitfadens und der Selbstreflexion der Autorin/des Autors.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselkonzepte sind Identität, Alterität, Postbürgerkriegsgeneration, Arabischer Frühling, Nationalismus, Konfession, Identitätsdiskurs, Ethnologie, Taif-Abkommen, Zedernrevolution, Soziale Medien und Diaspora.
Welche konkreten Forschungsfragen werden in der Arbeit bearbeitet?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Identität und Alterität der Postbürgerkriegsgeneration im Libanon verändert haben. Sie analysiert den Einfluss des libanesischen Bürgerkriegs und anderer historischer Ereignisse auf diese Veränderungen und fragt nach der Einordnung der Proteste von 2011 in den Kontext des Arabischen Frühlings.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer klassischen wissenschaftlichen Struktur mit Einleitung, theoretischer Verortung, Methodik, Kontextualisierung, empirischer Auswertung, Analyse und Diskussion. Jedes Kapitel schließt mit einer Synthese der Ergebnisse.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind aus der gegebenen Zusammenfassung nicht im Detail ersichtlich. Die Arbeit analysiert aber die Veränderungen in Identität und Alterität und diskutiert die Einordnung der libanesischen Proteste in den Arabischen Frühling im Kontext der beschriebenen "Grammatiken" der Segmentierung, Vereinnahmung und Orientalisierung.
- Citar trabajo
- Magister Artium Sabine Bauer (Autor), 2011, Alterität und Identität im Libanon: Eine Generation zwischen Bürgerkrieg und arabischem Frühling, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199235