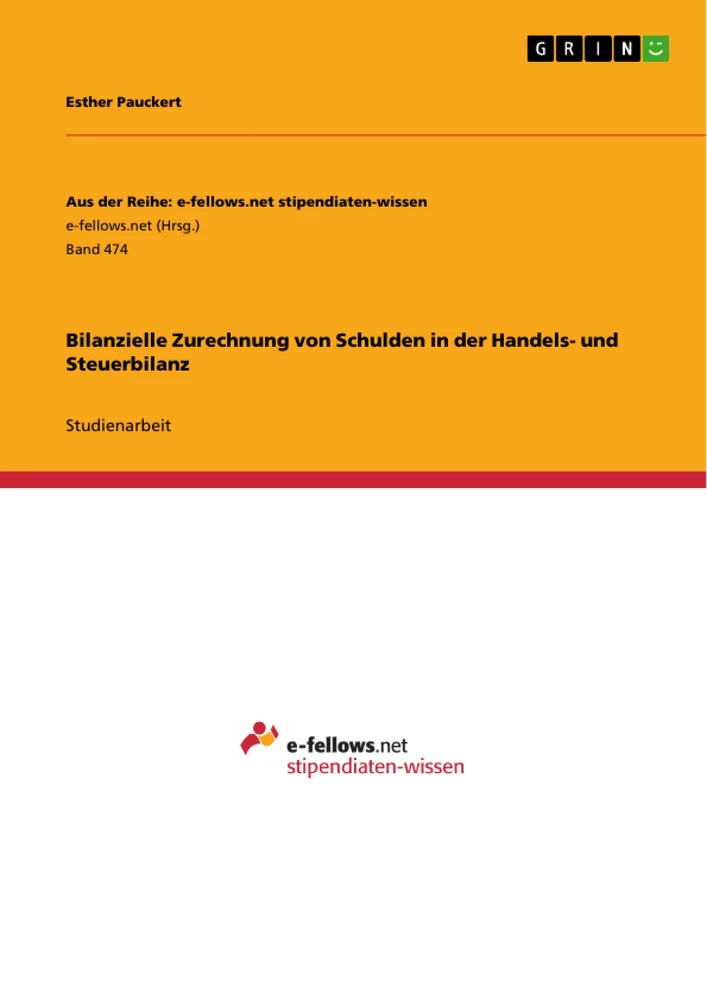I Einleitung
Die „Schuldenfrage“ scheint im Zuge der Staats- und Euroschuldenkrise in den letzten Jahren nicht mehr nur die Wirtschaft in der Hand zu haben, sondern auch außerhalb des ökonomisch interessierten Fachkreises eine breite Anhängerschaft gefunden zu habe. Zeitungen haben eigene Schuldenkrise-Seiten eingerichtet, Autoren widmen sich mit Verve dem Thema und auch innerhalb der Bevölkerung scheinen sich immer mehr Menschen mit dem so unangenehmen und negativ konnotierten Wort der „Schuld“ zu befassen.
Doch was genau ist unter „der“ Schuld zu verstehen? Im normalen Sprachgebraucht steht man in der Schuld eines anderen, wenn man sich etwas hat zu Schulden kommen lassen hat. Ökonomisch betrachtet stellen Schulden das Pendant zu dem positiven Vermögen dar. Innerhalb der Rechtsordnung wird der zivilrechtliche Schuldbegriff (z.B. §§ 366, 371 BGB) mit dem der Verbindlichkeiten (z.B. §§ 257, 762 BGB) gleichgesetzt. Das Handelsrecht verwendet den Begriff der bilanziellen Schuld als Oberbegriff für die (feststehenden) Ver-bindlichkeiten und die (noch ungewissen) Rückstellungen. Auf diese handels-rechtliche Definition stützt sich aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzip zunächst auch das Bilanzsteuerrecht, und grenzt erst später infolge gesetzlicher statuierter Spezialnormen den Ansatz und die Bewertung etwaiger Schuldposten ein. Doch selbst wenn man sich für eine Interpretation des Schuldbegriffs entschieden hat, stellt sich noch immer die Frage, ab wann sie bestehen kann. Wie hoch und wahrscheinlich muss die Verpflichtung sein um von einer Schuld sprechen zu können? Ab wann besteht ein Risiko der Inanspruchnahme? Schließlich ist für einen außen stehenden Dritten teilweise auch nicht immer sogleich ersichtlich, wer genau der eigentliche Schuldner ist. Denn so wie sich im großen Wirtschaftssystem der Banken und Staaten ein Schuldenberg wie eine „Schöpfung aus dem Nichts“ gebildet zu haben scheinen mag, der sich allein mit Hilfe einer einfachen Rechnungslegung zwischen Soll und Haben kein konkreter Schuldner zuordnen lässt, fragt sich auch manch kleiner Unternehmer, wen er zur Rechenschaft ziehen kann....
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II. Der Schuldbegriff
- 1. Verbindlichkeiten
- 2. Rückstellungen
- III. Besonderheiten bei der Bilanzierung von Schulden
- 1. Handelsbilanz
- 2. Steuerbilanz
- 3. Wesentliche Prinzipien der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im Fall der Passivierung
- a) Vollständigkeitsgebot
- b) Vorsichtsprinzip
- aa) Imparitätsprinzip
- bb) Realisationsprinzip
- c) Periodisierungsprinzip
- IV. Abstrakte Passivierungsfähigkeit
- 1. Passivierungsvoraussetzungen
- a) Die Verpflichtung gegenüber einem Dritten
- aa) Aufwandsrückstellungen
- bb) Neue Regelung durch BilMoG
- cc) Fazit
- b) Die wirtschaftliche Belastung
- aa) Erfolgsorientiertes Verursachungskonzept
- aaa) Unmittelbare Zugehörigkeit zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr
- bbb) Mittelbare Zugehörigkeit zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr
- bb) Vermögensorientiertes Verursachungskonzept
- cc) Ausprägung der Konzepte in der Rechtsprechung mit neuer Tendenz
- dd) Anwendung der Konzepte in der Praxis
- ee) Bewertung
- ff) Wirtschaftliche Verursachung vor der rechtlichen Entstehung
- c) Quantifizierbarkeit der Schuld
- 2. „Entschuldung“ der passiv latenten Steuerny durch BilMoG
- 3. Thesenartiges Fazit
- a) Neuinterpretation des handelsrechtlichen Schuldbegriffs
- b) Problematik der ermessensbehafteten Quantifizierbarkeit
- c) Wirtschaftliche Zugehörigkeit von Schulden im Zuge der abstrakten Passivierungsfähigkeit
- 4. Der endgültige handelsrechtliche Schuldbegriff
- 5. „Automatische“ Abhandlung der Passivierung durch Aktivierung
- aa) Treuhandschulden
- bb) Leasingverhältnisse
- V. Konkrete Passivierungsfähigkeit
- 1. Steuerbilanz
- a) Die Handelsbilanz als maßgeblicher Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung
- b) Steuerrechtliche Besonderheiten bei der konkreten Bestimmung abstrakt passivischer Wirtschaftsgüter
- c) Zusammenfassung
- 2. Persönliche Zurechnung
- a) Grundsatz der wirtschaftlichen Zurechnung nach § 39 II Nr. 1 AO im Fall der Verpflichtung
- b) Auseinanderfallen zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Verbindlichkeiten
- aa) Gesamtschuldner
- bb) Treuhänderisch übernommene Verbindlichkeit
- cc) Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung
- dd) Betriebsführungsvertrag
- ee) Schuldmitübernahme
- ff) Erfüllungsübernahme
- gg) Der besondere Fall des „In- substance defeasance“
- 3. Sachliche Zurechnung
- a) Zuordnung in der Handelsbilanz
- aa) Einzelkaufmann
- bb) Personengesellschaft
- cc) Kapitalgesellschaft
- b) Zuordnung in der steuerlichen Gewinnermittlung
- aa) Einzelunternehmer
- aaa) Umwidmung, Umschuldung, Umwandlung und das Zwei-Konten-Modell
- bbb) Finanzierte Entnahmen
- ccc) Schenkweise begründete Darlehensschulden
- ddd) Passivisches gewillkürtes Betriebsvermögen des Einzelkaufmanns (R 4.2 EStR I S.2)
- eee) Fazit
- bb) Personenhandelsgesellschaft
- aaa) Die Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft
- (1) Notwendiges Betriebsvermögen der Gesellschaft
- (2) Sonderbetriebsvermögen, § 15 I S.1 Nr. 2 EStG
- (3) Notwendiges Sonderbetriebsvermögen
- (a) Sonderbetriebsvermögen I (SBV I)
- (b) Sonderbetriebsvermögen II (SBV II)
- (4) (Passivisch) gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen (R 4.2 II S.3 EStR)
- (5) Zurechnungskollision - Bilanzierungskonkurrenz
- (6) Auswirkungen der Zurechnungskollision
- bb) Kapitalgesellschaft
- VI. Schlussfazit
- Der Schuldbegriff im Handels- und Steuerrecht
- Besonderheiten der Bilanzierung von Schulden in Handels- und Steuerbilanzen
- Prinzipien der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bei der Passivierung
- Abstrakte und konkrete Passivierungsfähigkeit von Schulden
- Persönliche und sachliche Zurechnung von Schulden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der bilanziellen Zurechnung von Schulden in der Handels- und Steuerbilanz. Ziel ist es, die komplexen Regelungen und Prinzipien der Passivierung von Schulden zu analysieren und deren Anwendung in verschiedenen Bilanzierungsformen zu verdeutlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der bilanziellen Zurechnung von Schulden ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie erläutert die Bedeutung der korrekten Bilanzierung von Schulden für die Darstellung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens.
II. Der Schuldbegriff: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Schuld im Kontext der Bilanzierung und unterscheidet zwischen Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die verschiedenen Arten von Schulden und deren bilanzielle Behandlung erläutert. Die Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten wird hierbei ebenfalls thematisiert.
III. Besonderheiten bei der Bilanzierung von Schulden: Dieses Kapitel beleuchtet die Unterschiede in der Bilanzierung von Schulden zwischen Handels- und Steuerbilanz. Es analysiert die wesentlichen Prinzipien der GoB, insbesondere das Vollständigkeitsgebot, das Vorsichtsprinzip (mit Imparitäts- und Realisationsprinzip) und das Periodisierungsprinzip, in Bezug auf die korrekte Darstellung der Schulden. Die Bedeutung dieser Prinzipien für die Transparenz und Aussagekraft der Bilanz wird hervorgehoben.
IV. Abstrakte Passivierungsfähigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Voraussetzungen für die abstrakte Passivierungsfähigkeit von Schulden. Es analysiert die Verpflichtung gegenüber Dritten, die wirtschaftliche Belastung (mit den erfolgs- und vermögensorientierten Verursachungskonzepten) und die Quantifizierbarkeit der Schuld. Es untersucht die Rechtsprechung und die praktische Anwendung dieser Kriterien und diskutiert die Auswirkungen des BilMoG auf die abstrakte Passivierungsfähigkeit. Die Bedeutung der zeitlichen Zuordnung der Schulden wird ebenfalls beleuchtet.
V. Konkrete Passivierungsfähigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Zuordnung von Schulden in der Handels- und Steuerbilanz, unterscheidet zwischen persönlicher und sachlicher Zurechnung und behandelt verschiedene Konstellationen wie Gesamtschuldner, Treuhandverhältnisse und Betriebsführungsverträge. Es analysiert die steuerrechtlichen Besonderheiten bei der Bestimmung abstrakt passivischer Wirtschaftsgüter und zeigt anhand von Fallbeispielen die Komplexität der Zurechnung von Schulden im Kontext verschiedener Unternehmensformen (Einzelkaufmann, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft). Die Problematik der Zurechnungskollisionen im Sonderbetriebsvermögen wird im Detail beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bilanzierung, Schulden, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Passivierung, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, wirtschaftliche Belastung, Zurechnung, BilMoG, Sonderbetriebsvermögen.
Häufig gestellte Fragen zur bilanziellen Zurechnung von Schulden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die bilanziellen Zurechnung von Schulden in der Handels- und Steuerbilanz. Sie untersucht die komplexen Regelungen und Prinzipien der Passivierung von Schulden und deren Anwendung in verschiedenen Bilanzierungsformen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Schuldbegriff im Handels- und Steuerrecht, Besonderheiten der Bilanzierung von Schulden in Handels- und Steuerbilanzen, die Prinzipien der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) bei der Passivierung, die abstrakte und konkrete Passivierungsfähigkeit von Schulden sowie die persönliche und sachliche Zurechnung von Schulden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Schuldbegriff, Besonderheiten bei der Bilanzierung von Schulden, Abstrakte Passivierungsfähigkeit, Konkrete Passivierungsfähigkeit und Schlussfazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der bilanziellen Zurechnung von Schulden.
Was versteht man unter dem Schuldbegriff im Kontext der Bilanzierung?
Das Kapitel "Der Schuldbegriff" definiert den Begriff der Schuld im Kontext der Bilanzierung und unterscheidet zwischen Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die verschiedenen Arten von Schulden und deren bilanzielle Behandlung erläutert. Die Unterscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Prinzipien der GoB sind bei der Passivierung von Schulden relevant?
Die relevanten Prinzipien der GoB sind das Vollständigkeitsgebot, das Vorsichtsprinzip (mit Imparitäts- und Realisationsprinzip) und das Periodisierungsprinzip. Diese Prinzipien sind entscheidend für die Transparenz und Aussagekraft der Bilanz.
Was ist der Unterschied zwischen abstrakter und konkreter Passivierungsfähigkeit?
Die abstrakte Passivierungsfähigkeit befasst sich mit den Voraussetzungen für die bilanzielle Erfassung einer Schuld (Verpflichtung gegenüber Dritten, wirtschaftliche Belastung, Quantifizierbarkeit). Die konkrete Passivierungsfähigkeit behandelt die Zuordnung der Schuld in der Handels- und Steuerbilanz, unterscheidet zwischen persönlicher und sachlicher Zurechnung und betrachtet verschiedene Konstellationen wie Gesamtschuldner, Treuhandverhältnisse und Betriebsführungsverträge.
Wie werden Schulden in der Handels- und Steuerbilanz unterschiedlich behandelt?
Das Kapitel "Besonderheiten bei der Bilanzierung von Schulden" beleuchtet die Unterschiede in der Bilanzierung von Schulden zwischen Handels- und Steuerbilanz und analysiert die Anwendung der GoB-Prinzipien in beiden Bilanzierungsformen.
Welche Rolle spielt das BilMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)?
Das BilMoG hat Auswirkungen auf die abstrakte Passivierungsfähigkeit von Schulden, insbesondere bezüglich der "Entschuldung" passiv latenter Steuerny.
Wie wird die persönliche und sachliche Zurechnung von Schulden behandelt?
Die persönliche Zurechnung befasst sich mit der Frage, wer zivilrechtlich und wirtschaftlich für eine Schuld verantwortlich ist (z.B. Gesamtschuldner, Treuhänder). Die sachliche Zurechnung betrifft die Zuordnung der Schuld zum richtigen Bereich in der Bilanz (z.B. Einzelkaufmann, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft) und die Berücksichtigung von Sonderbetriebsvermögen.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis der Thematik wichtig?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bilanzierung, Schulden, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), Passivierung, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, wirtschaftliche Belastung, Zurechnung, BilMoG, Sonderbetriebsvermögen.
- Quote paper
- Esther Pauckert (Author), 2012, Bilanzielle Zurechnung von Schulden in der Handels- und Steuerbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198085