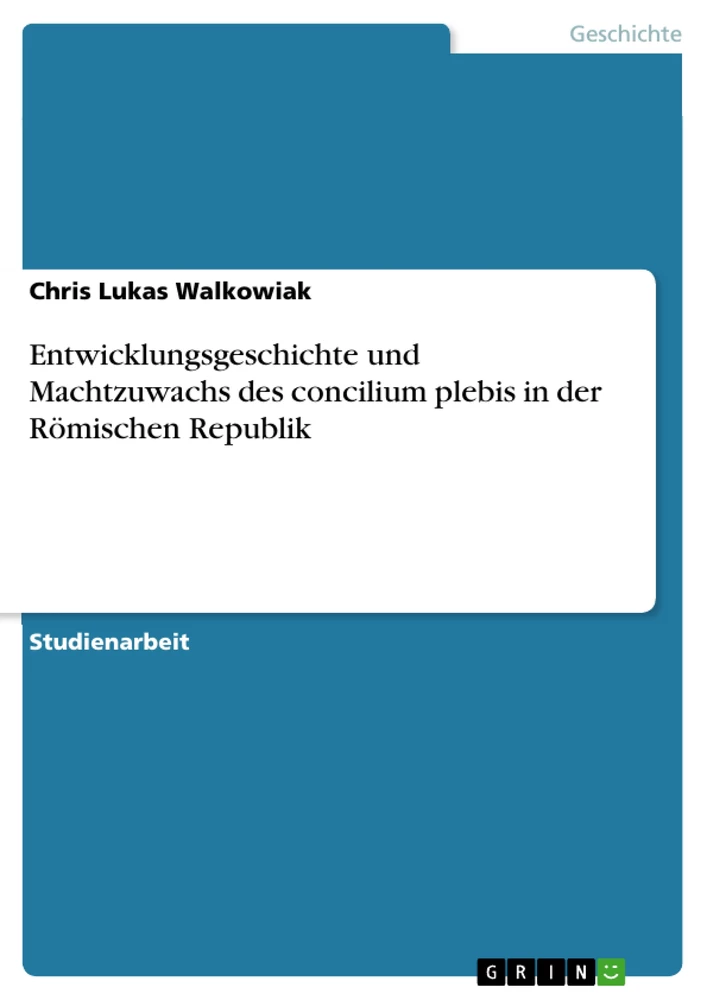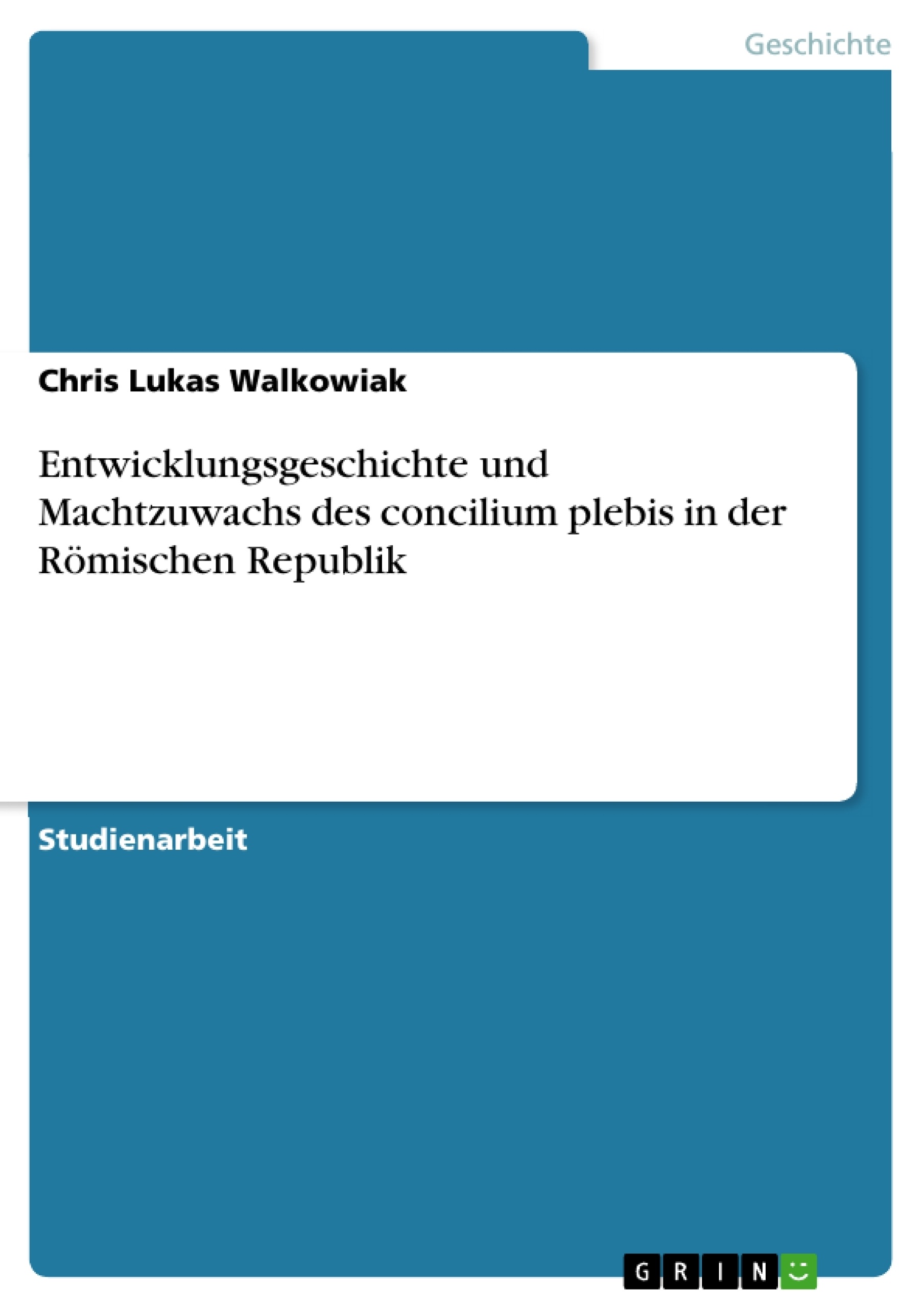Betrachtet man die politische Historie der römischen Republik, so erkennt man schnell, dass diese Geschichte stark geprägt war von dem Kampf um politische Mitbestimmung. Insbesondere die Plebejer, die nichtadelige Bevölkerung der Republik, forderten immer deutlicher ein Recht auf signifikante Partizipation in politischen Fragen ein. Da die Entscheidung über politische Sachverhalte jedoch traditionell den adeligen Patriziern oblag, kam es zu einem Gegensatz zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, der in den jahrhundertelang immer wieder aufflammenden Ständekämpfen seine deutlichste Ausprägung fand. Im Verlaufe dieser wurde den Plebejern tatsächlich eine beachtliche Fülle an Mitbestimmungsrechten übertragen. So erhielt die Plebs eine eigenständige Volksvertretung, das concilium plebis. Dieser Volksvertretung gelang es, sich in etwa zwei Jahrhunderten in der Politik der Republik zu etablieren und darüber hinaus alle weiteren Volksvertretungen an Bedeutung zu übertreffen. Aufgrunddessen wird das concilium plebis als das “most effective medium of legislation“ (A. Lintott, 1999) im republikanischen Rom bezeichnet. Das Zitat weist auch darauf hin, dass mit dem Aufstieg des concilium plebis die Machtverhältnisse in Rom „umgekehrt“ wurden, was bedeuten soll, dass der Großteil der politischen Macht von den Patriziern auf die Plebejer übertragen wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Forschungsdiskussion
- 2. Hauptteil
- 2.1. Entstehungsgeschichte des concilium plebis
- 2.2. Die Rolle des concilium plebis im Gesamtgefüge der römischen Volksversammlungen
- 2.3. Das Verhältnis der Patrizier zum etablierten concilium plebis
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklungsgeschichte des concilium plebis in der Römischen Republik und seinen Machtzuwachs. Ziel ist es, die Entstehung und Etablierung dieser plebejischen Volksvertretung im Kontext der Ständekämpfe zu beleuchten und ihre Bedeutung für die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Patriziern und Plebejern zu analysieren.
- Entstehung und Entwicklung des concilium plebis
- Rolle des concilium plebis im römischen politischen System
- Das Verhältnis zwischen Patriziern und Plebejern im Kontext des concilium plebis
- Der Einfluss des concilium plebis auf die Gesetzgebung
- Die Machtverschiebung zwischen Patriziern und Plebejern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Forschungsdiskussion: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der römischen Republik, geprägt vom Kampf um politische Mitbestimmung zwischen Patriziern und Plebejern. Sie erläutert die Bedeutung des concilium plebis als entscheidendes Instrument zur Erlangung plebejischer Mitsprache und dessen Aufstieg zur dominierenden legislativen Institution. Die Forschungsdiskussion beleuchtet die Herausforderungen der Quellenlage und die unterschiedlichen Interpretationen in der Forschung, wobei der Beitrag von Kaj Sandberg als besonders relevant hervorgehoben wird.
2. Hauptteil: Dieser Abschnitt untersucht eingehend die Entwicklung des concilium plebis. Er beginnt mit der Gründungsgeschichte, die im Kontext der Ständekämpfe und der secessio plebis von 494 v. Chr. betrachtet wird. Es wird die Bedeutung des concilium plebis für die Artikulation plebejischer Forderungen und die Entwicklung von plebiscita analysiert, wobei deren anfänglicher nicht-gesetzgebender Charakter betont wird. Die Arbeit vergleicht das concilium plebis mit anderen römischen Volksversammlungen und beleuchtet den Prozess seiner Etablierung als wichtigste gesetzgebende Institution. Abschließend wird das Bemühen der Patrizier, das concilium plebis zu beeinflussen, dargestellt, um die allmähliche Machtverschiebung zu verdeutlichen.
2.1. Entstehungsgeschichte des concilium plebis: Dieser Unterabschnitt fokussiert auf die Gründung des concilium plebis im Jahr 471 v. Chr., im Kontext der anhaltenden Ständekämpfe und des Drucks der Plebejer auf die Patrizier. Er analysiert die Rolle von L. Publilius Volero und die Akzeptanz des Vorschlags zur Einrichtung einer rein plebejischen Volksversammlung. Der Abschnitt beschreibt die spärlichen Aktivitäten des concilium plebis vor 287 v. Chr. und den Charakter der plebiscita als Ausdruck plebejischer Forderungen, jedoch ohne Gesetzeskraft.
Schlüsselwörter
concilium plebis, Römische Republik, Ständekämpfe, Patrizier, Plebejer, plebiscita, politische Partizipation, Gesetzgebung, Machtverhältnisse, mos maiorum, secessio plebis, Volksversammlungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Entwicklung des Concilium Plebis in der Römischen Republik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklungsgeschichte des concilium plebis in der Römischen Republik und seinen Machtzuwachs. Sie beleuchtet die Entstehung und Etablierung dieser plebejischen Volksvertretung im Kontext der Ständekämpfe und analysiert ihre Bedeutung für die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen Patriziern und Plebejern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Entstehung und Entwicklung des concilium plebis, seine Rolle im römischen politischen System, das Verhältnis zwischen Patriziern und Plebejern im Kontext des concilium plebis, den Einfluss des concilium plebis auf die Gesetzgebung und die Machtverschiebung zwischen Patriziern und Plebejern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Forschungsdiskussion, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil ist weiter unterteilt in Unterkapitel zur Entstehungsgeschichte des concilium plebis, seiner Rolle im Gesamtgefüge der römischen Volksversammlungen und dem Verhältnis der Patrizier zu diesem.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der römischen Republik, den Kampf um politische Mitbestimmung zwischen Patriziern und Plebejern und die Bedeutung des concilium plebis als Instrument zur Erlangung plebejischer Mitsprache. Sie erläutert die Herausforderungen der Quellenlage und verschiedene Interpretationen in der Forschung.
Worum geht es im Hauptteil?
Der Hauptteil untersucht eingehend die Entwicklung des concilium plebis. Er behandelt die Gründungsgeschichte im Kontext der Ständekämpfe und der secessio plebis, die Bedeutung des concilium plebis für die Artikulation plebejischer Forderungen und die Entwicklung von plebiscita. Er vergleicht das concilium plebis mit anderen römischen Volksversammlungen und beleuchtet den Prozess seiner Etablierung als wichtigste gesetzgebende Institution sowie die Bemühungen der Patrizier, es zu beeinflussen.
Was ist der Fokus des Unterkapitels zur Entstehungsgeschichte des concilium plebis?
Dieser Unterabschnitt konzentriert sich auf die Gründung des concilium plebis im Jahr 471 v. Chr. im Kontext der anhaltenden Ständekämpfe. Er analysiert die Rolle von L. Publilius Volero und die Akzeptanz des Vorschlags zur Einrichtung einer rein plebejischen Volksversammlung sowie die frühen Aktivitäten des concilium plebis und den Charakter der plebiscita.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: concilium plebis, Römische Republik, Ständekämpfe, Patrizier, Plebejer, plebiscita, politische Partizipation, Gesetzgebung, Machtverhältnisse, mos maiorum, secessio plebis, Volksversammlungen.
Welche Quellen werden verwendet (implizit)?
Die Arbeit bezieht sich implizit auf historische Quellen zur Römischen Republik und die Forschung zu den Ständekämpfen und dem concilium plebis. Der Beitrag von Kaj Sandberg wird explizit als besonders relevant erwähnt.
- Quote paper
- Chris Lukas Walkowiak (Author), 2011, Entwicklungsgeschichte und Machtzuwachs des concilium plebis in der Römischen Republik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197567