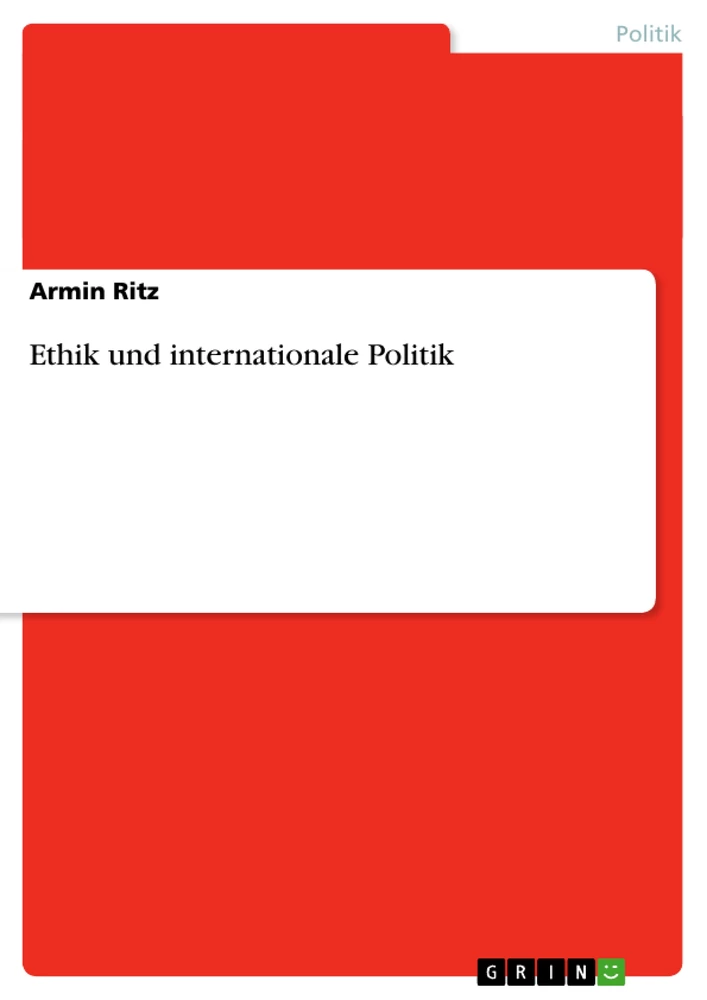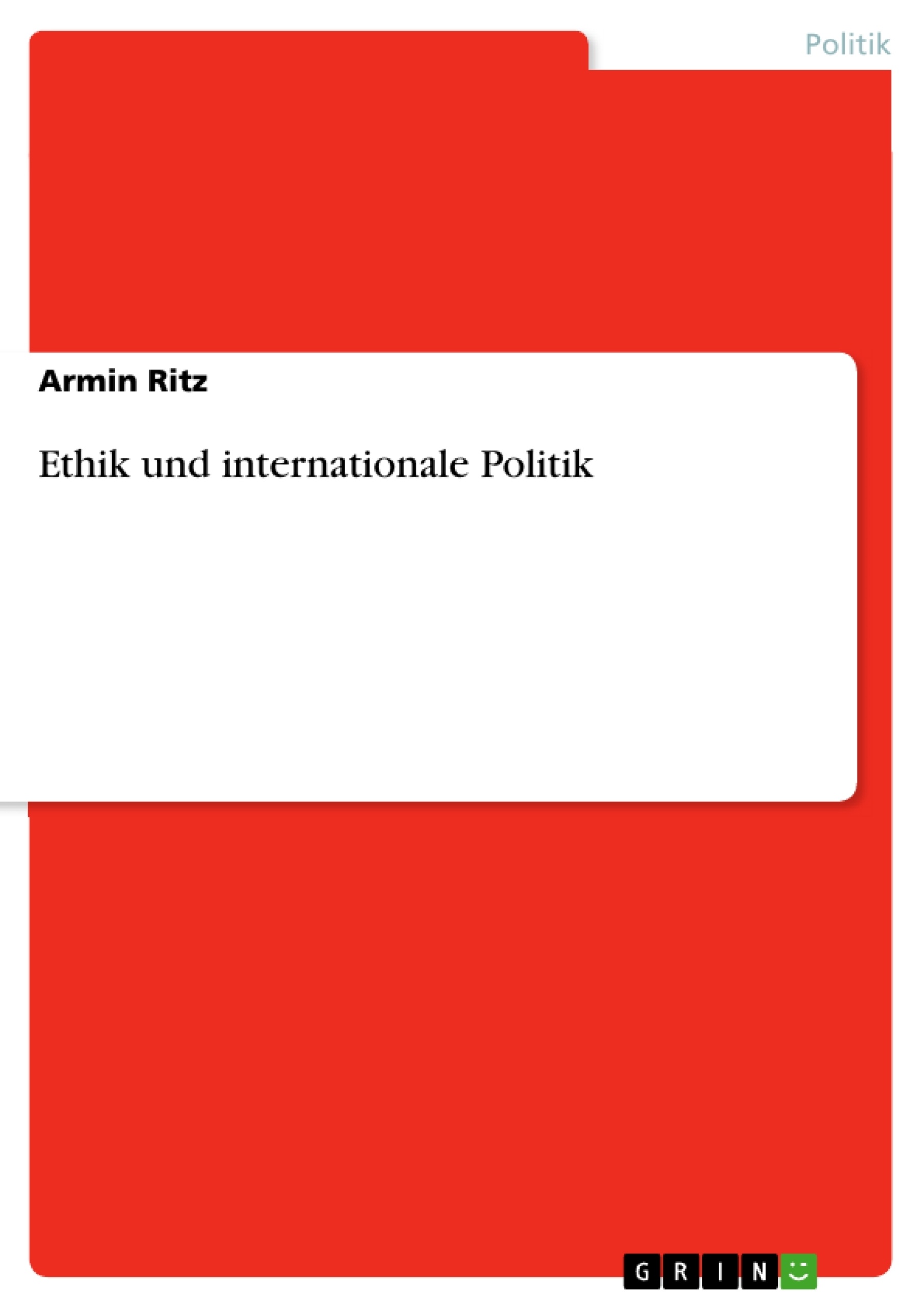Ob Ethik in der internationalen Politik einen Platz hat, ist umstritten. Zwar sprechen Politiker ständig von Werten, halten sich aber nicht immer daran. In Demokratien ist man sich wenigstens bewusst, dass bei Wahlen mit Moral einiges zu gewinnen oder zu verlieren ist.
Einige Experten vertreten seit langem die Meinung, Ethik hätte auf dem
internationalen Parkett nichts zu suchen. Internationale Politik sei von nationaler Politik völlig verschieden, im Dschungel der Weltpolitik sei Idealismus kein guter Ratgeber.
Dieses Buch gibt einen Überblick über die Historie und Gegenwart der Rolle der Ethik in der Politik.
Inhaltsverzeichnis
1. Unterschiedliche Meinungen
1.1. Skeptiker
1.2. Befuerworter
1.3. Praktiker
2. Krieg und Frieden
2.1. Tradition des gerechten Krieges
2.2. Heutige Situation
2.3. Nukleare Abschreckung
2.4. Selbstbestimmung der Voelker
2.5. Humanitaere Interventionen
2.6. Terrorismus
3. Menschenrechte
3.1. Historische Wurzeln
3.2. Praktische Verwirklichung
3.3. Schwierige Umsetzung
4. Soziale Gerechtigkeit
4.1. Arme und Reiche
4.2. Theorien und Strategien
4.3. Entwicklungshilfe und Armutsbekaempfung
4.4. Vorschlaege fuer alternative Finanzierungsmechanismen
4.5. Postulate fuer eine neue Weltwirtschaftsordnung
5. Globales Regieren
5.1. Veraenderungen der letzten Jahrzehnte
5.2. Wenig einstimmige Antworten
5.3. Ethische Herausforderungen
1. Unterschiedliche Meinungen
1.1. Skeptiker
Ob Ethik in der internationalen Politik einen Platz hat, ist umstritten. Zwar sprechen Politiker ständig von Werten, halten sich aber nicht immer daran. In Demokratien ist man sich wenigstens bewusst, dass bei Wahlen mit Moral einiges zu gewinnen oder zu verlieren ist.
Einige Experten vertreten seit langem die Meinung, Ethik hätte auf dem internationalen Parkett nichts zu suchen. Internationale Politik sei von nationaler Politik völlig verschieden, im Dschungel der Weltpolitik sei Idealismus kein guter Ratgeber.
Nach den Greueln des ersten Weltkrieges suchten finanzkräftige Mäzene die wissenschaftliche Forschung der internationalen Politik voranzutreiben. Dank ihrer Unterstützung konnten an mehreren Universitäten spezielle Lehr- und Forschungsprogramme eingerichtet werden.
- Einer der ersten Lehrstühle war 1919 der “David Davies Chair” an der Universität Aberytswyth in England.
- Bereits vorher hatte sich in New York die Carnegie Stiftung mit erheblichen Mitteln in die Friedensforschung engagiert.
- Mit mehrheitlich öffentlichen Mitteln wurde 1927 am Sitz des Völkerbundes in Genf das “Haut Institut des Relations Internationales” gegründet.
Die Hoffnung der Initianten war, dass eine moderne Wissenschaft dazu beitragen könnte, Kriege zu verhindern. Begeistert stellten sich Forscher der Herausforderung, vermochten aber den Erwartungen nicht zu entsprechen.
Denn Friedensidealisten wurden bald wieder von den Ereignissen überholt und mussten Realisten Platz machen, die dem alten Rezept treu blieben: wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor (“se vis pacem, para bellum“). Der englische Geschichtsphilosoph Henry Carr, der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr und der aus Deutschland ausgewanderte Jude Hans Morgenthau wurden zu den Pionieren der neuen Wissenschaft.
Ihr Verdienst ist es, das Studium der internationalen Politik von zerstreuten Ansätzen unter ein kräftiges Konzept zu stellen. Ihre Schule hat Forschung und Lehre der internationalen Politik fast ein Jahrhundert lang geprägt.
Die grundlegenden Praemissen der Realisten waren:
- Menschen sind selbstsüchtig und stets bereit, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
- Innerhalb des Staates konnte der individuelle Egoismus gezügelt werden, in den Beziehungen unter den Staaten bleibt er aber bestehen.
- Zwischen den Staaten herrscht Anarchie, so dass sich jeder selber behaupten muss.
- Anarchie bedeutet nicht, dass ständig Krieg herrscht, dieser kann aber jederzeit ausbrechen, weil es keine oberste Gewalt gibt, um Auseinandersetzungen zu schlichten.
Die zentrale Aufgabe des Staates besteht für Realisten darin, den eigenen Bürgern Sicherheit zu gewährleisten. Indessen kann sich nach aussen kein Staat sicher fühlen. Je mehr der eine für die Sicherheit aufrüstet, um so mehr geraten andere unter Zugszwang, womit das Risiko des Krieges weiter verschärft wird. Verantwortlich dafür sind die natürliche Konfliktbereitschaft des Menschen und die Anarchie unter den Staaten.
Mehr als die konfliktfreudige Natur des Menschen haben jüngere Exponenten der realistischen Schule die anarchistische Struktur des internationalen Systems in den Vordergrund gestellt.[1] Das eröffnet zumindest die Hoffnung, dass Veränderungen eher möglich sind als bei der pessimistisch eingeschätzten Natur des Menschen.
Ideen sind stets in einem geschichtlichen Umfeld entstanden, das sie auch beeinflussen. Der Realismus wurde zum Protagonisten, nachdem der Völkerbund gescheitert war und der Nationalsozialismus sowie der Marxismus-Leninismus liberale Demokratien bedrohten. Weil totalitäre Ideologen zu allem bereit waren, kamen demokratisch gesinnte Forscher zur Überzeugung, mit wohlgesinnter Ethik sei in den internationalen Beziehungen nur wenig zu erreichen.
Sie stützten sich dabei auf Meinungen, die seit langem bestanden haben. In der Tat gehoert der Realismus zu den ältesten Theorien der internationalen Politik .
Als erster Vorfahre wird meistens der griechische Geschichtsphilosoph Thukydides genannt. In seiner Geschichte über den Peloponnesischen Krieg (431-404 v.Chr.) schilderte er nicht nur die Chronologie des Krieges, sondern suchte jede Etappe mit allgemein gültigen Ursachen zu erklären:
- Die Frage, warum es zum Kriege kam, begründete Thukydides mit der Tatsache, dass die Welt der griechischen Stadtstaaten von einer ständigen Rivalität zwischen den beiden grössten, Sparta und Athen, geprägt war. Als Athen seinen Einfluss auszudehnen vermochte, wurde das bisherige Gleichgewicht gestört, weshalb der Krieg nicht mehr zu vermeiden war.
- Dass Sparta den Krieg begann, obwohl es an einen Waffenstillstandsvertrag gebunden war, verurteilte Thukydides nicht. Vielmehr warf er Sparta vor, aus falschen Schuldgefühlen schlecht gekämpft zu haben. Denn Verträge verlieren ihren Wert, wenn sie nicht mehr gemeinsamen Interessen entsprechen.
- Ebenso wenig kritisierte Thukydides die imperialistischen Absichten von Athen. Für ihn lag es in der Natur der Dinge, dass der Stärkere nach Höherem strebt, um seine Interessen zu verfolgen und seinen Ruhm zu vergrössern.
- Was das für den Schwächeren bedeutet, brachte Thukydides im berühmten Dialog von Melos zum Ausdruck. Als die selbstherrlichen Generäle Athens von den viel kleineren Meliern eine widerstandslose Kapitulation forderten, appellierten die Melier an Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Thukydides betrachtete es als völlig normal, dass die Athener darauf antworteten, Gerechtigkeit sei das, was dem Stärkeren diene. Der Schwächere habe es hinzunehmen, wenn er unnötiges Leid vermeiden wolle.
- Völlig frei von moralischen Bedenken war Thukydides trotzdem nicht, weil er meinte, die Athener hätten mit dem gnadenlosen Hinmetzeln eines schwachen Gegners den Niedergang ihrer eigenen Macht eingeleitet.
Noch weniger von Skrupeln geplagt war der Florentiner Niccolò Machiavelli (1469 - 1527), der im späten Mittelalter zum Urgestein des Realismus wurde. Hartnäckig verfolgte der von den Medicis entlassene Diplomat den Traum, die zerstrittenen Kleinstaaten Italiens nach dem Vorbild Frankreichs, Englands und Spaniens in eine grosse Nation zu vereinigen. Für die Aufgabe suchte er einen starken Führer, dem er im “Principe” seine Wegleitung gab:
- Machiavellis erste Empfehlung lautete, sich an das Beispiel der Römer zu halten, die niemals darauf warteten, angegriffen zu werden, sondern immer vorher handelten, um Angriffen zuvorzukommen. Der präventive Krieg war für ihn auch gegenüber Nachbarn erlaubt, die keine feindlichen Absichten hegten, aber zu schwach sein könnten, sich gegenüber anderen Staaten zu verteidigen.
- In Sachen des Krieges gab es für den Florentiner keine moralischen Bedenken. Mit Verachtung schaute er auf Politiker herab, die wegen ihres christlichen Glaubens ständig zögerten und damit nur Niederlagen und Schmach ernteten.
- Machiavelli war überzeugt, dass ein Führer zum richtigen Zeitpunkt auch grausame Gewalttätigkeiten auf sich zu nehmen habe. Diese seien jedoch möglichst rasch durchzuführen, damit sie nicht wiederholt werden müssen, um die Verbitterung unter den Opfern in Grenzen zu halten
- Letztlich anerkannte aber auch der florentinische Sekretär, dass sich ein politischer Führer nicht konstant über Moral hinwegsetzen kann. Da er republikanische Regierungsformen bevorzugte, war er sich bewusst, dass der Zusammenhalt unter den Bürgern Werte erfordert. Für ihn hatte aber selbst ein gewählter Staatsführer die Pflicht, seine Wähler zu betrügen, wenn es darum geht, höhere Interessen zu verteidigen.
Als dritter Vordenker des Realismus gilt der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679). Aus dem Exil heraus musste er erleben, wie ein Bürgerkrieg sein Vaterland zerstörte. Deshalb quälte er sich mit der Frage, was die Grundlage eines Staates sei. Dass ein solcher über Eroberung entstehen kann, betrachte er zwar als bedauerlich, aber dennoch als eine Tatsache. Viel wichtiger war für ihn der freiwillige Zusammenschlusses unter Menschen, um dem Naturzustand des “homo homine lupus” zu entrinnen. Darin sah er den Grund, warum Menschen zur Einsicht kommen, einige ihrer Freiheiten an eine höhere Autorität abzutreten, um mehr Sicherheit für Leib und Leben zu erlangen. Damit begründete Hobbes die Theorie des Gesellschaftvertrages, aus der er aber für die Beziehungen unter den Staaten zu Konsequenzen kam, die ihn ebenfalls zu einem Exponenten des Realismus machten.
- Der vertragliche Zusammenschluss von Menschen in einen Staat lässt den Naturzustand unter den Staaten bestehen. Jeder Staat muss seine Sicherheit mit eigenen Mitteln verteidigen, wozu auch das Recht gehört, feindliche Völker zu erobern und zu unterjochen.
- Zwar anerkannte Hobbes ein allgemein gültiges Naturrecht, beschränkte es aber für die Staaten auf das Erfordernis der Selbsterhaltung. Wie der Einzelne ist jeder Staat an Frieden interessiert, darf sich jedoch keinen Illusionen hingeben. Weil unter Staaten eine oberste Autorität fehlt, um Gewalt in Schranken zu halten, geht das auf Frieden ausgerichtete Naturrecht zwischen den Staaten nicht über das Ziel der Selbstbehauptung hinaus.
- Die Aussicht, dass es ebenfalls unter den Staaten zu einem Vertrag kommt, um eine übergeordnete Autorität zu schaffen, hielt Hobbes als wenig wahrscheinlich. Im ursprünglichen Naturzustand wurden Menschen ständig von Gewalt bedroht, in den zwischenstaatlichen Beziehungen bekommt der Einzelne diese Gefahr weniger unmittelbar zu spüren. Deshalb erweist sich das Interesse an einer übergeordneten Autorität nicht so zwingend, obwohl es unter Staaten immer wieder zu Kriegen kommt.
Um auf die Begründer des modernen Realismus zurueckzukommen, haben diese nicht nur die Meinungen ihrer geistigen Väter wiederholt, sondern daneben mit grosser Schärfe an neuen Konzepten gearbeitet. Was sie indessen stark mit ihren Vorfahren verbindet, ist die Überzeugung, dass für nationale und internationale Politik nicht die gleichen Massstäbe gelten. Wie sehr moralische Werte auf staatlicher Ebene zu befürworten sind, koennen solche ihrer Meinung nach auf internationaler Ebene nur zu Fehlurteilen und Misserfolgen führen.
- Hans J. Morgenthau hatte als verfolgter Jude für universelle Werte einiges übrig, warnte aber dennoch, dass mit diesen auf aussenpolitischer Ebene vorsichtig umzugehen sei, weil man nie sicher sein könne, ob sich auch die gegnerische Seite daran halten würden.[2]
- Der Theologe Reinhold Niebuhr, der von Sünde und Schwäche ausging, hielt es als unmoeglich, die für den Einzelnen gültige Moral auf Gemeinschaftswesen zu übertragen.[3]
- Zynisch meinte Edward H. Carr, allgemein gültig angepriesene Prinzipien seien meistens nichts anderes als verdeckte Formulierungen von nationalen Interessen.[4]
Alle Realisten kommen zu Schluss, oberste Pflicht eines Staatsmannes sei es, sich für die Sicherheit seiner Bürger einzusetzen. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe habe er bloss darauf zu achten, kluge Vorsicht (“prudentia”) walten zu lassen.
Der moderne Realismus wurde hauptsächlich von europäischen Denkern entwickelt, von denen manche unter schwierigen Umständen nach Amerika auswandern mussten. Ihre Ratschläge, die in den Ohren alt gedienter Politiker Europas eher vertraut klingen mochten, waren für die Führer des jungen Amerikas gedacht, das seit der Unabhängigkeit ständig zwischen Isolationismus und missionarischem Eifer geschwankt hatte. Weil Amerika nach dem ersten Weltkrieg zu einer Weltmacht geworden war, sollte ihm aus der Perspektive der Erfahrung geholfen werden, sich in der neuen Rolle zu Recht zu finden.
In der Tat war die ehemalige Kolonie innert eines Jahrhunderts nicht nur militärisch und wirtschaftlich, sondern auch beim wissenschaftlichen Fortschritt zur führenden Kraft geworden. Sowohl in den Naturwissenschaften als auch den Sozialwissenschaften zog der neue Kontinent scharenweise europäische Forscher an, die sich dort geistig und materiell besser entfalten konnten.
Der rasante Fortschritt der Naturwissenschaften verbreitete den Glauben, selbst für menschliches Verhalten koenne man zu überprüfbaren Gesetzmässigkeiten kommen. Deshalb begannen sich die Humanwissenschaften in Amerika frühzeitig und mit phantasievollem Eifer der empirischen Forschung zuzuwenden.
Daraus entstand der Szientismus , von dem auch die junge Fachdisziplin der internationalen Politik erfasst wurde. Hatten die Begründer des modernen Realismus noch mit der logischen Deduktion und mit dem geschichtsphilosophischen Verstehen operiert, verlangte eine neue Generation von Forschern, es sei an der Zeit, zu einer wissenschaftlich höheren Stufe zu kommen.
Leitbild waren die Naturwissenschaften, aber auch jene Sozialwissenschaften, die mit empirischen Methoden bereits weiter vorangekommen zu sein schienen. So wurden von der Nationalökonomie, der Ethnographie und der Psychologie Methoden der Statistik, der Inhaltsanalyse und der Analyse von Entscheidungsprozessen übernommen. Ferner griff man auf die Spieltheorie der Mathematik und die Systemanalyse der Biologie zurück, um Prozesse der internationalen Politik zu erklären.
Häufig wurden dabei Thesen des Realismus getestet, die sich auf Bereiche beschränken mussten, für die quantifizierbares Material vorhanden war. Weil das nicht immer der Fall war, widmete man sich Theorien mittlerer Reichweite, um auf diesem Wege schrittweise zu einer Gesamttheorie zu kommen. Mit grossem Aufwand wurden die neuen Computer-Technologien genutzt, mit denen man immer mehr soziale Fakten zu erfassen suchte.
Das Vorhaben der Szientisten und Behavioristen, empirisch gesicherte Forschung zu betreiben, ist nicht zu kritisieren, auch wenn dabei keine normativen Absichten verfolgt werden. Viele Szientisten und Behavioristen berücksichtigen übrigens in ihren Untersuchungen Werte als Fakten, während Realisten a priori behaupten, Werte könnten sich in der Aussenpolitik als gefährlich erweisen.
Sind nach dem zweiten Weltkrieg zahlreiche amerikanische Forscher in den Behavorimus geflüchtet, hatte das nicht zuletzt damit zu tun, dass nach dem Ausbruch des Kalten Krieges mehr als einer dem Mac Carthysmus zu entgehen suchte, weil er zu befürchten hatte, als verdeckter Kommunist verfolgt zu werden.
Karl Marx, der Begründer des Kommunismus, predigte seinen historischen Materialismus lange vor den modernen Realisten und Szienstisten als totale Wissenschaft der gesellschaftlichen Realität. Ethische Postulate standen für ihn ebenfalls nicht im Vordergrund, obwohl er mit prophetischem Zorn die miserablen Zustände der Arbeiterklasse anprangerte. Er soll jeweils gelacht haben, als seine Genossen von Moral zu sprechen begannen.
Wie die Realisten betrachtete Marx die Macht als zentralen Faktor. Bei ihm ging es aber nicht um die Macht des Staates, sondern um die der Klassen. Denn der mit dem Privateigentum entstandene Klassenkampf ist der Motor der Geschichte. Der Gegensatz zwischen jenen, die ausbeuten, und jenen, die ausgebeutet werden, war für ihn nicht mit statistischen Korrelationen, sondern nur mit dem Gesetz der Entwicklung der Produktionskräfte zu erklären.
Marx bekämpfte den Kapitalismus nicht aus moralischen Gründen. Er betrachtete ihn sogar als notwendige Etappe des Fortschrittes. Weil aber die kapitalistische Logik den Reichtum immer mehr konzentriert, kommt es unweigerlich zur proletarischen Revolution. Nur die verarmte Arbeiterklasse, die nichts zu verlieren hat, kann wieder eine klassenlose Gesellschaft herstellen, in der es weder Armut noch Krieg gibt.
Erst danach erhalten alle Menschen die Möglichkeit, sich gegenüber anderen richtig zu verhalten. Vorher spiegelt das, was als Moral betrachtet wird, nur die Interessen der herrschenden Klasse wieder. Die Revolution braucht keine Ethik, sie folgt auf das letzte Stadium des Klassenkampfes, wie der Fluss in das Meer fliesst. Der Einzelne kann dazu nur beitragen, indem er möglichst früh die Zeichen der Zeit erkennt.
Mit seiner alles umfassenden Theorie hatte Marx wenig Anlass, sich speziell der internationalen Politik zu widmen. Für ihn gehörten sowohl der Staat als auch die internationale Politik zum Überbau des Kapitalismus und waren somit dem Untergang geweiht. Trotzdem verfolgte er genau das damalige Kriegsgeschehen und stellte sich jeweils auf die Seite jener, die in seinen Augen das revolutionäre Potential der Arbeiterklasse zu stärken vermochten.
Später kamen aber seine Schüler nicht um die Tatsache herum, dass sich Arbeiter enthusiastisch für die nationale Sache einsetzten, anstatt sich brüderlich zu vereinigen. Als sich der Kapitalismus immer mehr grenzüberschreitend entwickelte, mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass Arbeiter mit Kreisen des nationalen Bürgertums zusammenspannten, um höhere Löhne zu verteidigen. Daraus wurden unterschiedliche Schlüsse gezogen, deren kleinster gemeinschaftlicher Nenner war, dass es Situationen gibt, in denen die Bewusstseinsbildung der Arbeiter mehr Zeit braucht.
Lenin, der auf diesem Hintergrund seine Imperialismustheorie entwickelte, vermochte im feudalen Russland den ersten sozialistischen Staat zu errichten. Vor dem modernen Realismus war der Marxismus-Leninismus auf die Kommandobrücke einer Weltmacht vorgestossen. Über Jahrzehnte benahm sich die sowjetische Führungsspitze wie eine erleuchtete Priesterschaft, die ewige Gesetzte predigte, gleichzeitig aber opportunistischen Realismus praktizierte. Moralische Unterstützung erhielt sie von einer Reihe westlicher Theoretiker, die auf gut bezahlten Lehrstühlen immer wieder neue Erklärungen für die ausgebliebene Arbeiterrevolution lieferten.
Seit dem Zusammenbruch des morsch gewordenen Sowjetreiches hat der Marxismus an Einfluss verloren. Nur noch in wenigen Drittweltländern erlaubt er Populisten, für alle Missstände äussere Kräfte verantwortlich zu machen. Trotzdem überleben in bekannten Universitäten der kapitalistischen Welt Intellektuelle, die - zum Teil mit unorthodoxen Methoden - an der marxistischen Prognose festhalten, der Kapitalismus sei dem Untergang geweiht und werde nächstens durch eine sozialistisch organisierte Weltwirtschaft abgelöst.
1.2. Befürworter
Idealisten haben massgeblich dazu beigetragen, dass die internationale Politik nach dem ersten Weltkrieg zu einer universitären Forschungsdisziplin geworden ist. Wenn unter den neuen Professoren bald die schärfsten Gegner des Idealismus zu finden waren, hat das weniger mit dem Vatermord des Oedipus als mit der Tatsache zu tun, dass die damaligen Exponenten des Realismus die Herausforderungen der Zwischenkriegszeit rascher begriffen hatten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die wirtschaftliche Zusammenarbeit unter den westlichen Industriestaaten zu blühen begann, geriet jedoch der Realismus immer mehr unter Kritik. Von vielen wurde seine konstante Fixierung auf die “unveränderlichen” Gesetze der Machtpolitik als zu kurz empfunden. Weil sich zudem die Behavioristen an ihren Rechenschiebern wegen mangelnder Daten häufig mit exotischen Themen herumschlagen mussten, verstärkte sich der Vorwurf, die von den beiden Richtungen geprägte Forschung arbeite an der Realität vorbei.
Neue Ansätze der Forschung gingen vom gleichen Ort aus, wo der einflussreiche Realismus entstanden war. Zumindest wird damit der akademischen Lehrfreiheit in den USA ein gutes Zeugnis ausgestellt. Während von marxistischer Seite immer die gleichen Diatriben zu hören waren, begannen sich Forscher im Westen - nicht nur in den USA - zu fragen, wie sich die wachsende wirtschaftlichen Verflechtung auf die internationale Politik auswirken werde.
Darunter befand sich auch eine kleine Gruppe, die explizit die Ethik zu ihrem Forschungsgegenstand machte. War Moral Jahrzehnte lang als wissenschaftlich irrelevant angesehen worden, begannen sich gerade Forscher im angelsächsischen Raum mit ethischen Aspekten auseinanderzusetzen. Dass davon bald auch andere Kreise ergriffen wurden, ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:
- Der Vietnam-Krieg löste in den USA und in Westeuropa eine riesige Debatte aus, die mit moralischen Argumenten geführt wurde. Das galt für Gegner wie für Befürworter, auch wenn sich prominente Realisten von Anfang an gegen die Intervention ausgesprochen hatten, weil sie diese nicht im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten betrachteten.
- In Europa, der Wiege der Nationalstaaten, war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur die Versöhnung unter ehemaligen Feinden gelungen, sondern es kam zur freiwilligen Abtretung nationaler Souveränitätsrechte an supranationale Organisationen (EGKS, EWG), was mit dem Billard-Modell der Realisten nicht zu erklären war und deshalb von ihnen skeptisch verfolgt wurde.
- Der Erdölschock von 1970 verunsicherte die bisher unbegrenzten Hoffnungen, mit grenzüberschreitendem Handel und Investitionen immer mehr Wohlfahrt zu erreichen. Plötzlich wurde man sich bewusst, dass natürliche Ressourcen begrenzt sind und dass die vom Wachstum verursachte Umweltbelastung die Zukunft des gesamten Erdballs in Frage stellen könnte.
Ob Zufall oder nicht, fand zur gleichen Zeit die Ethik wieder in die Philosophie zurück. Sie war seit dem Vormarsch der Naturwissenschaften weitgehend aufgegeben worden, weil sich die Philosophie über Jahrzehnte auf die Logik, die Erkenntnislehre und die Sprachwissenschaft zurückgezogen hatte, um im Geiste der Zeit wenigstens einige Nischen zu behaupten.
1971 wurde vom amerikanischen Philosophen John Rawls das Buch “A Theory of Justice” veröffentlicht.[5] In dem monumentalen Werk ging Rawls der klassischen Frage nach, unter welchen Bedingungen eine gesellschaftliche Ordnung als gerecht betrachtet werden koenne. Stark vereinfacht lautete seine Antwort, dass der Gewinn, der aus der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft hervorgeht, proportional mehr den Schwächeren als den Stärkeren zukommen sollte.
Das nicht leicht lesbare Buch löste ein grosses Echo aus, doch meinte Rawls, sein Differenzprinzip lasse sich nicht auf die weltweiten Beziehungen übertragen, weil die internationale Zusammenarbeit noch nicht die gleiche Dichte erreicht habe. Trotz dieser Einschränkung, die er später nuancierte, beflügelte Rawls mit seinem Buch den Eifer jener, die sich mit der Ethik in der internationalen Politik zu beschäftigen begannen.
Abschätzig hatte Edward H. Carr die Ansicht vertreten, wer Ethik und Politik vermische, müsse als Utopist betrachtet werden. Inzwischen weiss man, dass die Friedensutopien, die über die Jahrhunderte entwickelt worden waren, manches richtig gedeutet haben. Zwar ist das tägliche Handeln der Politik von ihnen kaum beeinflusst worden, im Rückblick stellt sich aber heraus, dass sie mehr als ein Körnchen der Wahrheit enthielten.
Auf alle Fälle haben Moral und Ethik in der Geschichte des politischen Denkens ebenfalls seit eh und je eine Rolle gespielt. Fast gleichzeitig mit den ersten Realisten der Antike ist eine auf Werte ausgerichtete Tradition entstanden, die jedoch im Unterschied zum Realismus von Anfang an viel weniger monolithisch war.
Als nach dem Peloponnesischem Krieg die demokratischen Kleinststaaten Griechenlands von den mazedonischen Königen erobert worden waren, suchten Zeno und Chrysipp ihre verwirrten Mitbürger Athens mit der Lehre zu trösten, dass über den örtlichen Gesetzen ein universales Recht stehe, das jedem Menschen zukomme und auch von den Herrschern geachtet werden müsse.
Diese Ideen der Stoa gelangten über Polybius und Panaetius nach Rom, wo sie von einigen Rechtsgelehrten des neuen Imperiums mit Interesse aufgenommen wurden. Als einer ihrer überzeugten Anhänger schrieb der beredte Cicero in seinem Werk “De Legibus”:
“Es gibt in der Tat ein wahres Gesetz, nämlich die richtige Vernunft, die der Natur entspricht, für alle Menschen gilt, unabänderlich und ewig ist. Dieses Gesetz durch menschliche Gesetzgebung ausser Kraft zu setzen, kann niemals richtig sein.”
Er war bei weitem nicht allein, denn Mark Aurel, der Philosoph auf dem Kaiserthron, hatte den berühmt gewordenen Satz geprägt: “Als Antonius bin ich Bürger von Rom, als Mensch bin ich Bürger der Welt“.
Willig nahm die Minderheit der ersten Christen das Gedankengut der Stoa auf, weil es dem entsprach, was der Völkerapostel Paulus gesagt hatte: “ Es gibt nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allem”.
Trotz Verfolgungen blieb die junge Kirche der Lehre ihres Meisters treu: “Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott was Gottes ist”. Lange predigten die Kirchenväter den Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit, auch wenn diese als ungerecht erschien. Nur in Glaubensfragen nahmen die Christen den Märtyrer-Tod auf sich, um ihre Gewissensfreiheit zu bewahren.
Als sich das Christentum verbreitete, unterschied Augustinus zwischen der “civitas dei” (jene, die nach überirdischer Verwirklichung streben) und der “civitas terrena” (jene, die sich nur für das Diesseits interessieren). Ausdrücklich sagte er, beide Elemente seien sowohl im Staat als auch in der Kirche vorhanden. Unabhängig von den viel höheren Erfordernissen der “civitatis dei” verlangte er von der staatlichen “civitas terrena”, sich für die „tranquilitas ordinis“ und die gerechte Verteilung der Güter einzusetzen.
Thomas von Aquin, der seinen Glauben mit den Ideen der Stoa und des wieder entdeckten Aristoteles verband, ist im Mittelalter zum eigentlichen Begründer der christlichen Naturrechtslehre geworden. Für ihn gab es zwischen Glauben und Vernunft keinen Widerspruch. Der ursprüngliche Schöpfungsplan Gottes (lex aeterna) ist trotz des Sündenfalls erhalten geblieben. Er spiegelt sich im Naturrecht (lex naturalis) wieder, das der Mensch kraft seiner Vernunft erkennen kann. Die Einsicht in das Naturrecht wird zwar von den göttlichen Offenbarungen (lex divina) erleichtert, bleibt aber unabhängig davon allen Menschen zugänglich.
Da sich Menschen nur in der Gemeinschaft entfalten können, braucht es unter ihnen eine Ordnung, die sowohl innerhalb des Staates (ius civile) als auch in den Beziehungen unter den Vökern (ius gentium) das Naturrecht respektiert. Gerecht ist nur eine Ordnung, die den Wohlstand aller Bürger fördert und sich für die Erhaltung des Friedens einsetzt.
Francisco de Vitoria, der im Spanien der kolonialen Eroberungen lebte, suchte die Gedanken seines Ordenbruders den neuen Verhältnissen anzupassen. Er war überzeugt, dass die soziale Natur des Menschen nicht an den Grenzen von Königsreichen aufhört. Die gesamte Menschheit bilde eine Gemeinschaft, weshalb einem Indianerfürst die gleichen Rechte zukämen wie einem christlichen König.
Sowohl dem Papst als auch dem Kaiser sprach Vitoria das Recht ab, zur Verbreitung des christlichen Glaubens Eroberungskriege zu führen. Aus der Idee einer weltweiten “communitas” folgerte er, jeder sollte überall freien Zugang haben. Wenn Kaufleute oder christlichen Missionare daran behindert würden, sei es erlaubt, Gewalt zu gebrauchen. Trotzdem hielt er den Krieg nur als gerecht, wenn er nicht bloss Unrecht bestraft, sondern die Förderung des weltweiten Gemeinwohls zum Ziele hat.
Mit der spanischen Spätscholastik hat die christliche Naturrechtslehre ihren Höhepunkt erreicht. Seit der Reformation und der Aufklärung ist der Einfluss der römischen Kirche zurückgegangen. Erst als Papst Leo XIII. gegen Ende des 19. Jahrhunderts die katholische Soziallehre zu erneuern vermochte (“Rerum novarum”), konnte sie wieder grössere Beachtung erlangen.
Ungeachtet ihrer religiösen Überzeugungen haben seit dem Mittelalter eine Reihe von Autoren Vorschläge für die Verwirklichung eines dauerhaften Friedens gemacht. Ideen, wie sie Pierre Dubois, Marsilius von Padua, Georg Podiebrad, Tommassio Campanella und Emeric Crucé vorgetragen hatten, liefen alle auf das Postulat hinaus, dass sich Prinzen und Könige in einen Bund vereinigen sollten, der über die notwendige Autorität verfügen muesste, um Streitigkeiten friedlich zu regeln.
Nur wenige Jahrzehnte, nachdem sich die europäischen Königsreiche im Westfälischen Frieden auf eine souveräne, aber kriegsfreudige Gleichberechtigung geeinigt hatten, wurden diese Gedanken vom Quäker William Penn und vom Abbé de Saint Pierre weiter praezisiert.
Zur Überwindung von Meinungsunterschieden forderten sie, die Streitparteien sollten in einem ersten Schritt auf direkte Gespräche verpflichtet werden. Für den Fall, dass diese ohne Erfolg blieben, hätte ein aus allen Staaten zusammengesetzter Senat mit qualifizierter Mehrheit einen Schiedsspruch zu fällen. Würde der Schiedsspruch nicht beachtet, wäre mit gemeinsamen Streitkräften für dessen Durchsetzung zu sorgen.
Solche Ideen waren damals verpönt, haben aber drei Jahrhunderte später im Völkerbund und in der Charta der Vereinten Nationen Anklang gefunden.
Immanuel Kant, der wichtigste Vertreter der deutschen Aufklärung, gab 1795 ebenfalls eine Schrift zum ewigen Frieden heraus. Mit philosophischer Tiefe appellierte Kant an jeden, seine Vernunft zu gebrauchen, um sich von Unwissenheit zu befreien (“sapere aude”). Freiheit bedeutete für ihn nicht Willkür, sondern der Wille zu richtigem Verhalten. Das hielt er auch für politische Autoritäten als unabdinglich, denn gerade diese sollte keinen Schritt tun, ohne “der Moral zu huldigen“.
- Den Staat betrachtete Kant als notwendig, doch hat dieser so zu sein, dass ihn jeder Bürger wollen kann. Moralisch vertretbar ist nur ein Staat, in dem die Bürger berechtigt sind, die Regeln ihres Zusammenlebens selber zu bestimmen. Jeder soll sich in Freiheit verwirklichen können, solange er anderen keinen Schaden zufügt. Kant kämpfte gegen den Absolutismus seiner preussischen Heimat und begrüsste zunächst die französische Revolution, deren gewalttätiges Vorgehen ihn jedoch enttäuschte, so dass er sich für eine konstitutionelle Monarchie auszusprechen begann.
- Im Zentrum seiner Ethik stand der kategorische Imperativ, der besagt: a) handle so, dass dein Verhalten zum allgemeinen Gesetz werden kann und b) betrachte den Mitmenschen nicht als Mittel sondern als Ziel. Der kategorische Imperativ galt für ihn sowohl auf staatlicher wie auf weltweiter Ebene. Deshalb forderte er, dass weder Individuen noch Staaten ein Verhalten einnehmen dürfen, das den Frieden gefährdet, denn der Friede ist ein Erfordernis der Vernunft, das allen zu Nutzen gereicht.
- Etwas Ähnliches hatte schon Dante Alighieri gesagt, der zur Wahrung des Friedens keine andere Möglichkeit sah, als einen Weltstaat unter Führung des Kaisers zu errichten. Kant lehnte den Weltstaat ab, weil ihm dieser nicht als realisierbar erschien. An seiner Stelle schlug er eine Föderation freier Staaten vor, um den Naturzustand unter den Staaten in einen Rechtszustand zu überführen.
- Kant war sich bewusst, dass der Friede nicht von heute auf morgen zu realisieren ist. Er meinte aber, der vernünftige Mensch werde immer mehr zur Einsicht kommen, dass der Krieg der schlimmste Gegner seines Fortschrittes sei. Deshalb würden Kriege zunächst humaner, dann weniger häufig und schliesslich überhaupt nicht mehr geführt.
- Deshalb legte Kant seinem Friedensplan einen graduellen Ansatz zu Grunde, der aus sechs Präliminarartikeln und drei Definitvartikeln bestand.
Die sechs Präliminarartikel, die noch nicht den Frieden aber seine Vorbedingung bedeuten, lauteten: 1) keine geheimen Vorbehalte in Friedensverträgen, 2) kein Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung, 3) Abschaffung stehender Heere, 4) keine Verschuldung für aussenpolitische Handlungen, 5) keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, 6) keine Abscheulichkeiten im Krieg, die gegenseitiges Vertrauen für einen künftigen Frieden verunmöglichen.
In den drei Definitivartiklen forderte Kant: 1) die bürgerliche Verfassung soll in jedem Staat republikanisch sein, 2) das klassische, aber kraftlose Völkerrecht der leidigen Tröster (Grotius, Puffendorf, Vattel) ist durch einen “foedus pacificum” zu ersetzen, der das Recht auf Krieg unter den Staaten aufhebt, 3) für die Beziehungen unter den Völkern hat ein Weltbürgerrecht zu garantieren, dass jeder, der sich friedlich in einen anderen Staat begibt, als willkommener Gast behandelt wird.
Kant ging von der Annahme aus, dass zunächst nur einige Staaten bereit sein könnten, auf den Krieg zu verzichten. Doch für den Erfolg seines Friedensplanes hielt er es als notwendig, dass sich umgehend “mächtige und aufgeklärte” Republiken darauf verpflichten, um kraft ihres Beispiels vorauszugehen. Für den reisenden Weltbürger beanspruchte er nicht sofort ein freies Niederlassungsrecht, wohl aber ein Besuchsrecht, denn er war überzeugt, dass sich der Handelsgeist, “der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann”, früher oder später jedes Volkes bemächtigen werde.
Kant ist kein leicht zugänglicher Autor. Seinen Kosmopolitismus begründete er nicht mit Interessen, sondern mit moralischen Postulaten. Für seine Republik forderte er die Gewaltentrennung und eine aktive Mitwirkung der Bürger bei der Gestaltung der staatlichen Institutionen.
Das war für ihn die Voraussetzung, dass der Krieg bald verschwinden würde. Können nämlich die Bürger selber über den Krieg entscheiden, werden sie kaum “ein so schlimmes Spiel anfangen”, da sie den Krieg nicht nur selber zu fechten, sondern auch für seine Kosten aufzukommen haben.
Über die Relevanz demokratisch begründeter Friedenstheorien gibt es noch heute unterschiedliche Auffassungen. Für viele Politiker auf der ganzen Welt ist sie aber zu einem Glaubensartikel geworden, der nicht nur ihre Rhetorik, sondern auch ihr Handeln beeinflusst.
Pragmatischer als Kant gingen die englischen Utilitaristen vor. Diese meinten zum Entsetzten von Kant, Menschen würden nur nach Lust und Wohlbefinden streben. Doch waren auch sie überzeugt, ein altruistisches Postulat zu vertreten. Ihr Ziel war es, das grösstmöglichste Glück für die grösstmögliche Zahl zu erreichen. Jeremy Bentham , einer der Begründer des Utilitarismus, feilte unermüdlich an Regeln, um menschliches Wohlbefinden mit Indikatoren wie Intensität, Dauer und Ausdehnung zu quantifizieren.
Für die Utilitaristen waren weniger die Motive des Handelns als deren Konsequenzen von Bedeutung. Zur Frage, ob das Ausmass des Glückes nur von der Gesamtsumme oder auch von deren Verteilung abhängt, blieben sie häufig unbestimmt. Dennoch kamen einige von ihnen schon früh zum Schluss, dass Gerechtigkeit ebenfalls zu den Faktoren menschlichen Wohlbefindens gehört.
Weil das Glück der Individuen den Vorrang hat, sahen die Utilitaristen im Staat nur ein Instrument, um dessen möglichst weite Verbreitung zu fördern. Keine Regierungsform konnte das besser tun als die Demokratie, da periodische Wahlen die Regierenden dazu zwingen, sich um das Wohlbefinden der Wähler zu kümmern.
Wie Kant waren die Utilitaristen Kosmopoliten, weil auch sie für ihr Nützlichkeitsprinzip eine weltweite Gültigkeit beanspruchten. Weniger Probleme als Kant hatten sie mit der Idee einer Weltregierung, denn sie waren durchaus bereit, eine solche zu akzeptieren, sofern diese sich als besser geeignet erweisen sollte, um das allgemeine Glück zu erhöhen.
Kategorisch lehnten die Utilitaristen den Krieg ab, weshalb sie die Militärausgaben reduzieren wollten und für den Rückzug aus den Kolonien eintraten. Bentham kämpfte unermüdlich für die Kodifizierung des Völkerrechtes und plädierte für verbindliche Streitschlichtungsverfahren unter den Nationen.
Viele der englischen Liberalen teilten das Gedankengut der Utilitaristen. Oberstes Credo der Liberalen war jedoch die Freiheit des Einzelnen. Wenn jeder selber entscheiden kann, was er als erstrebenswert erachtet, wird das Gemeinwohl am besten gefördert. Menschen sind grundsätzlich gut, weshalb sie fähig sind, ihre Interessen harmonisch auszugleichen. Die Hauptaufgabe des Staates besteht darin, die Initiative der Bürger nicht zu behindern.
Die Liberalen setzten sich vor allem für den freien Handel ein, den sie als wirksamstes Mittel zur Überwindung des Kriegs betrachteten. Freiheit ist der Motor des Fortschrittes, was bedeutet, dass alle Völker friedlich zusammen geführt werden koennen. Richard Cobden - herausragender Vertreter liberaler Ideen - war überzeugt, der Handel werde mehr zum Frieden beitragen als alle Diplomaten und Regierungskabinette.
Cobden hielt das Machtstreben der Staaten als pathologisch, weil es den Weg zu einer fortschrittlichen Gemeinschaft der Völker versperre. Sein Wunsch war, dass Staaten ihre Souveränität - sowohl regional als auch weltweit - miteinander teilen, um nicht nur das eigene Wohl, sondern auch das der anderen zu verbessern.
Die englischen Liberalen gehörten zu den Wegbereitern internationaler Organisationen. Auf ihr Betreiben entstanden Wirtschaftsorganisationen, weil England als erste Industriemacht grenzüberschreitende Märkte benötigte. Schon früh kamen jedoch die Liberalen zur Einsicht, dass das internationale System nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch anders organisiert werden müsse.
Das Projekt des Völkerbundes wurde von ihnen aktiv vorangetrieben. Als dieses versagte, gaben sie die Hoffnung nicht auf, sondern standen nach dem zweiten Weltkrieg erneut hinter der Schaffung der Vereinten Nationen. Mit dem Aufkommen der Globalisierung sind ihre Anhänger mehr denn je überzeugt, dass sich eine universale Gemeinschaft herausbildet, die eine “global governance” erfordert.
In dem kurzen Rückblick auf ethische Traditionen ist noch der deutsche Philosoph Wilhelm Friedrich Hegel zu erwähnen. Dessen Werk ist nicht leichter zu lesen als das seines Landsmannes Immanuel Kant. Für Hegel, der mit seiner dialektischen Methode berühmt geworden ist, kann Wahrheit nie vollständig erfasst werden, doch ist es möglich, sich ihr in wiederholten Schritten über These, Antithese und Synthese zu nähern.
Hegel hatte vom Staat eine ganz andere Auffassung als Kant und die englischen Liberalen. Während die Liberalen den Einfluss des Staates möglichst beschränken wollten, kam Hegel zum Schluss, dass das Individuum seine Freiheit nur im und durch den Staat verwirklichen kann.
Für diese These ging Hegel von den Funktionen der Familie, der Zivilgesellschaft und des Staates aus.
- In die Familie wird der Einzelne hineingeboren, wo er liebevolle Zuneigung erfährt und zu erstem Bewusstsein gelangt. Doch ist die Familie zeitlich begrenzt, so dass sich jeder eines Tages von dieser affektiven Umgebung trennen muss.
- Es folgt der Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft, in der sich der Einzelne aus eigenen Kräften weiter entwickelt. Der Tausch mit anderen erlaubt ihm, selber für seine Bedürfnisse zu sorgen. In diesem unpersönlichen Verhältnis verliert er aber die altruistische Wärme, die er in der Familie erlebte.
- Es ist der Staat, der ihm die höhere Synthese ermöglicht, um Unzulänglichkeiten von Familie und bürgerlicher Gesellschaft zu überwinden. In ihm findet der Einzelne zum Gefühl der Zugehörigkeit zurück und erhält gleichzeitig die Möglichkeit, seine Vernunft vollumfänglich zu verwirklichen. Der Staat ist der Höhepunkt menschlichen Fortschrittes, er ist allen anderen Gesellschaftsformen überlegen. Der Mensch ist seinem Wesen nach auf den Staat ausgerichtet, um ein ethisches Leben in voller Freiheit zu führen.
Über dem Staat gibt es keine höhere Autorität, denn wie das Individuum auf andere Individuen angewiesen ist, braucht auch der Staat andere Staaten. Zu den Aufgaben des Staates gehört es, die Interessen seiner Bürger über die eigenen Grenzen hinaus zu schützen. Daraus können Kriege entstehen, was Hegel nicht besonders beunruhigte, weil Kriege zur Stählung eines Volkes beitragen können. Das Verhalten eines Staates kann nicht von einer über ihm stehenden Macht, sondern nur von der Weltgeschichte beurteilt werden.
Damit steht Hegel in der Nähe der Realisten, die ohne Berufung auf ihn ihre Thesen entwickelt haben. Kaum zu bezweifeln ist, dass Hegel mit seiner Lehre einen überbordenden Nationalismus gefördert hat, obwohl ihm nicht vorzuwerfen ist, nur den Krieg verherrlicht zu haben. Kernpunkt seiner Aussage war, dass ein System unabhängiger Staaten erhalten werden muss, weil sich das Individuum nur innerhalb einer staatlichen Gemeinschaft voll entfalten kann.
Doch setzte das für Hegel einen ethisch verantwortlichen Staat voraus. Wie die Familie des alten Roms unethisch war, weil sie dem “pater familias” erlaubte, seine eigenen Kinder auszusetzen, gibt es unethische Staaten, in denen Despoten willkürlich über das Leben ihrer Untertanen verfügen. In Übereinstimmung mit Kant war Hegel der Ansicht, dass ein Staat nur ethisch ist, wenn er seinen Bürgern effektive Mitspracherechte einräumt. Den Kosmopolitismus von Kant lehnte er jedoch entschieden ab.
1.3. Praktiker
Unter historischen Gesichtspunkten hat das Bestehen von Staaten, das für Hegel von zentraler Bedeutung war, keine lange Tradition. Mit Ausnahme der griechischen Stadtstaaten der Antike und der italienischen Kleinrepubliken des Mittelalters war die Geschichte mehr von Imperien geprägt, die alles zu beherrschen suchten, was ihnen bekannt und zugänglich war.
In Europa ist ein System unabhängiger Staaten erst nach dem westfälischen Frieden (1648) entstanden. Nach der Glaubensspaltung war das christliche Imperium, an dessen Spitze der Papst und der Kaiser standen, auseinander gebrochen. Auf den Ruinen blutiger Religionskriege bildete sich eine neue Ordnung heraus, in der:
- die Souveränität und Gleichheit aller Staaten anerkannt wurde (“rex est imperator in regno suo“),
- der Herrscher über die Religion seiner Untertanen zu entscheiden hatte (“cujus regio, ejus religio“),
- das Prinzip des Gleichgewichtes das Aufkommen hegemonialer Mächte verhindern sollte.
Der bedeutendste Theoretiker der staatlichen Souveränität war Jean Bodin, der - obwohl er sich als Katholik bekannte - schon nicht mehr viel vom Grundsatz des “cujus regio, ejus religio “ hielt. Mit der Vorsicht, die seine Zeit gebot, plädierte er für einen säkularen Staat, der seinen Bürgern unabhängig von ihrem Glauben Sicherheit gewährt, in dem aber niemand mehr berechtigt ist, persönliche Anliegen mit Gewalt durchzusetzen.
Der italienische Protestant Alberico Gentili, der Bodins Konzept der Souveränität auf die zwischenstaatlichen Beziehungen übertrug, distanzierte sich vom “bellum iustum” der mittelalterlichen Theologen. In seinen Augen hatten die Religionskriege gezeigt, dass beide Seiten für eine gerechte Sache zu kämpfen glaubten. Kriege - wie immer sie begründet werden - waren für Gentili unvermeidbar. Können die Bürger eines Staates ihre Rechte vor Gerichten verteidigen, gibt es für souveräne Staaten keine andere Möglichkeit, als den Schiedsspruch auf dem Schlachtfeld herbeizuführen.
Das so verstandene “ius ad bellum” ist von den europäischen Herrschern bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts praktiziert worden. Zwar konsultierten Könige noch lange unterwürfige Hoftheologen, die stets ein Zitat in der Bibel fanden, um ihre Kriege zu rechtfertigen. Doch spielte die Moral nur mehr eine untergeordnete Rolle, denn von Kriegen wurde entschieden, was richtig war.
Weder der Messianismus der französischen Revolution noch das hegemoniale Abenteuer von Napoleon haben daran etwas geändert. Die Heilige Allianz, die mit ihrem Interventionsrecht die alten Verhältnisse wieder herzustellen suchte, ist nur eine kurze Klammer geblieben. Demokratische Regierungen, die immer häufiger wurden, haben mehr denn je an der traditionellen Souveränität festgehalten, weshalb sie sich kaum für die Selbstbestimmung anderer Völker einzusetzen wagten.
So ist das von Gentili begründete Völkerrecht trotz der Umwälzungen des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben. Nur in der Methode hat es eine Veränderung erfahren, indem man bis zur französischen Revolution noch häufig mit dem Naturrecht argumentierte, danach aber nur mehr dem positiven, von dem Willen der Staaten festgelegten Recht eine Bedeutung einräumte.
Der Rechtspositivismus, der sich auf die Analyse völkerrechtlicher Verträge und Gewohnheiten beschränkte, wollte die tägliche Arbeit von Politikern und Diplomaten erleichtern. Überheblich kam er trotzdem zum Schluss, die Beherrschung unterentwickelter Völker sei gerechtfertigt, weil es nur unter fortgeschrittenen Staaten ein “zivilisiertes“ Völkerrecht gebe.
Seit dem westfälischen Frieden haben die Spezialisten des Völkerrechtes - Kants leidige Tröster - kaum mehr getan, als die Praxis der Staatslenker “a posteriori” zu rechtfertigen. Es ueberrascht nicht, dass das von den kriegsfreudigen Herrschern nur zur Kenntnis genommen, wenn sie sich in ihren Interessen bestätigt sahen.
Nach den Greueln des ersten Weltkrieges setzte jedoch eine Wende ein. Politiker und Diplomaten begannen selber darüber nachzudenken, wie man die Beziehungen unter den Staaten stabiler gestalten könnte. Bewusst oder unbewusst griff man auf lange verschmähte Friedensutopien zurück.
- Im Völkerbund kamen die Staatsführer auf die Lehre des “bellum iustum” zurück, indem nur mehr Kriege als gerecht betrachtet werden sollten, nachdem alle vorgesehenen Schlichtungsverfahren gescheitert waren und eine zusätzliche Frist von drei Monaten eingehalten worden war.
- Noch weiter ging wenige Jahre später der Briand-Kellogg Vertrag (1928), der jeden Krieg zur Durchsetzung nationaler Politik - also auch den Krieg zum Schutz eigener Rechte - verbot und bloss den Verteidigungskrieg gegen einen militärischen Angriff als gerechtfertigt übrig liess.
- Trotz des Scheiterns des Völkerbundes wurde nach dem zweiten Weltkrieg die Idee der kollektiven Sicherheit wieder aufgenommen. Die Charta der Vereinten Nationen verlieh dem Sicherheitsrat das Recht, mit der Zustimmung der Vetomächte gemeinsame Aktionen gegen einen Friedensbruch zu beschliessen. Von ihm erlassene Wirtschaftssanktionen sollten für alle gültig sein, dagegen sah man davon ab, Staaten zur Teilnahme an militärischen Zwangsmassnahmen zu verpflichten.
Neben der UNO-Charta ist es seither zu unzähligen Resolutionen und Erklärungen gekommen, in denen die Staaten ihre friedlichen Absichten bekräftigt haben. Wie Dorothy V. Jones bemerkte, ist von Politikern und Diplomaten ein umfangreiches Kompendium moralischer Grundsätze entwickelt worden, die - zumindest auf dem Papier - mit dem Paradigma der Realisten nicht mehr viel zu tun haben.[6]
Zu den Anfängen dieser Tradition feierlicher Erklärungen (“declaratory tradition”) zählt Jones die Initiative des amerikanischen Staatssekretärs Cordell Hull, der 1937 seine Kollegen befragte, mit welchen Prinzipien sie sich für ein korrektes Verhalten unter den Staaten einverstanden erklären könnten. In den Antworten von 60 Staaten fanden fünf seiner Vorschläge allgemeine Zustimmung: a) Gleichheit aller Staaten, b) Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, c) friedliche Beilegung von Streitigkeiten, d) keine Anwendung militärischer Gewalt, e) Erfüllung von internationalen Verträgen.
Diese Prinzipien sind 1945 in die Charta der Charta der Vereinten Nationen eingeflossen, die noch mehrheitlich von Vertretern des “zivilisierten “ Norden ausgearbeitet worden war. Als das Ende der Kolonialreiche einsetzte, gründeten afrikanische und asiatische Staaten 1955 in Bandung die Bewegung der Blockfreien, deren Absicht es war, sich mit Werten ihrer eigenen Tradition für eine friedliche Koexistenz einzusetzen. Die Staatschefs der jungen Nationen verabschiedeten die vom indischen Premierminister Nehru beeinflussten Prinzipien des “Panch Sheel”, unter denen sich mehrere Grundsätze befanden, die bereits in der Umfrage von Cordell Hull allgemein unterstuetztworden waren.
Der Kalte Krieg war von einem ideologisch unerbittlichen Kampf zwischen Ost und West geprägt. Dennoch gelang es 1970 der UNO-Generalversammlung, sich unter allen Blöcken auf eine Erklärung über die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit unter den Staaten zu einigen. Kurz vor dem Sturz der Berliner Mauer konnte diese Resolution 1987 weiter verstärkt werden, indem sich die Staaten dazu bekannten, dass es im nuklearen Zeitalter keine andere Option gebe, als sich mit allen Mitteln für den Frieden zu verwenden.
Aus diesen und vielen anderen Erklärungen staatlicher Vertreter hat Mervyn Frost achtzehn Normen abgeleitet, die heute aufgrund übereinstimmender Erklärungen unter den Staaten als allgemein akzeptiert betrachtet werden können (“settled norms“)[7]:
- das System einer Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist zu erhalten;
- die souveräne Selbstständigkeit und Gleichheit der Staaten liegt im Interesse aller;
- kein Staat hat das Recht, seinen Einfluss mit gewalttätigen Mitteln über andere auszudehnen;
- unter den Staaten soll ein Zustand herrschen, der das Aufkommen hegemonialer Mächte verhindert;
- Loyalität der Bürger zu ihrem Staat ist notwendig, darf aber nicht in einen überheblichen Nationalismus ausarten;
- Regierungen haben das Recht und die Pflicht, sich in erster Linie für die Wohlfahrt ihrer Bürger einzusetzen;
- kein Staat soll sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen;
- bei Fremdherrschaft ist die Selbstbestimmung der Völker zu fördern;
- die immer dichteren Beziehungen unter den Staaten sollten durch Verträge geregelt werden;
- oberstes Ziel ist der Friede, Kriege sind nur zur individuellen oder kollektiven Verteidigung gegenüber einem Aggressor erlaubt;
- in Kriegen sind stets die grundlegenden Prinzipien eines menschenwürdigen Verhaltens zu achten;
- das System kollektiver Sicherheit soll den Vorrang haben;
- es ist erlaubt und notwendig, gegenüber Friedensbrechern wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen;
- die Diplomatie hat alle Mittel auszuschöpfen, um zu friedlichen Vereinbarungen zu kommen;
- der soziale Fortschritt in und unter den Staaten ist wie der Friede als ein gemeinsames Ziel zu betrachten;
- wirtschaftliche Zusammenarbeit kann die Wohlfahrt aller Staaten fördern;
- demokratische Regierungsformen werden überwiegend als besser anerkannt;
- die Menschenrechte sind sowohl innerhalb der Staaten als auch auf internationaler Ebene zu schützen.
Auffallend an diesen Prinzipien ist, wie viele von ihnen an der Erhaltung des Staatensystems festhalten. Das überrascht nicht, stammen sie doch von Politkern und Diplomaten. Trotzdem ist bemerkenswert, dass sich die Staatsführer immer wieder zu Verhaltensregeln bekennen, mit denen Kriege verhindert und die friedliche Zusammenarbeit gestärkt werden sollen.
Somit scheinen sich Politiker und Diplomaten dem zu nähern, was Kant in seinem Ewigen Frieden gefordert hat. Ob sie sich am deutschen Philosophen inspirierten, bleibe dahin gestellt. Dennoch kann man sich fragen, warum die traditionell verstandene Souveränität unter den heutigen Umständen weiterhin als derart zentrale Norm betrachtet wird.
Die Begriffe Ethik und Moral werden heute oft unterschiedslos gebraucht. Ursprünglich verstand man unter Moral das Bestehen gewisser Regeln, während der Ethik die Aufgabe zukam, diese philosophisch zu begründen. In der säkularisierten Welt wird meistens von der Moral des gesunden Menschenverstandes ausgegangen. Sind die Praktiker der internationalen Politik in letzter Zeit zu einer ansehnlichen Zahl normativer Prinzipien gekommen, haben dabei unterschiedliche Faktoren mitgewirkt:
- nicht sehr tiefgründig - wenn auch kaum anfechtbar - ist die Feststellung, es handle sich um den kleinsten gemeinschaftlichen Nenner, der unter verschiedenen Traditionen möglich ist (Konsens-Theorie);
- weit verbreitet unter Praktikern ist die Auffassung, ein System unabhängiger Staaten sei das beste Mittel, um Ordnung in den internationalen Beziehungen zu gewährleisten ( ein Gedanke, der auf der Linie des Realismus liegt);
- hervorzuheben ist die Ansicht, moderne Technologien würden Kriege derart verheerend machen, dass niemand mehr ein Interesse daran haben könne (was Utilitaristen und Liberale lange vor der Erfindung der Atombombe gesagt haben).
Dass es unter Werten zu Konflikten kommt, ist der ethischen Theorie seit jeher bekannt. Die feierlichen Erklärungen der Staatsführer enthalten jedoch einen Widerspruch, der schwierig zu ueberwinden ist, nämlich, dass a) Menschenrechte international zu schützen sind, sich aber b) kein Staat in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen darf.
Die Spannungen zwischen den beiden Prinzipien sind umso schärfer, als einige Staaten vor allem die individuellen Freiheitsrechte, andere mehr die sozialen Rechte betonen. Auch bei Ethikern sind nur spärliche Angaben zu finden, wie der Konflikt zwischen Nichteinmischung und Achtung der Menschenrechte zu lösen ist. Nur Kosmopoliten vertreten klar die Meinung, den Menschenrechten sei in jedem Fall den Vorzug zu geben, da die absolut verstandene Souveränität nicht mehr als zeitgerecht betrachtet werden könne.
Unterschiedlich wird ebenfalls das Prinzip interpretiert, den wirtschaftlichen Fortschritt über Zusammenarbeit zu fördern. Die alten Industriestaaten verstehen darunter ein freies Handels- und Finanzsystem, erklären sich aber bereit, Hilfe an ärmere Länder zu leisten, obwohl sie mit ihren Versprechen ständig im Verzug sind.
Von den zurückgebliebenen Ländern wird der Agrarprotektionismus der reichen Länder kritisiert, der in der Tat allen liberalen Grundsätzen widerspricht. Sie fordern aber nicht nur den freien Marktzugang für ihre Landwirtschaftsprodukte, sondern wollen darüber hinaus das gesamte Weltwirtschaftssystem nach dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit gestalten. Der an und für sich richtige Ansatz ist jedoch nicht zu verwirklichen, solange weiterhin auf die absolute Achtung der Souveränität gepocht wird.
Die Liste allgemein akzeptierter Normen kann inzwischen auf die Bereitschaft der Staaten ausgedehnt werden, gemeinsam gegen die Umweltverschmutzung vorzugehen. Aber auch hier kommt man über die Art und Weise, wie das zu erreichen ist, nicht über einen dürftigen Konsens hinaus. Nach wie vor bleibt die Anwendung des Verursacherprinzips, gemäss dem neben vergangenen auch heutige Sünden einzuschliessen wären, sehr umstritten.
Für die drohende Perspektive, dass sich die Reserven von Erdöl und Gas bald erschöpfen könnten, vertrauen viele auf den technischen Fortschritt. Ob die gleiche Hoffnung für den zunehmenden Mangel eines so unersetzbaren Gutes wie Trinkwasser zu rechtfertigen ist, wirft noch schwierigere Fragen auf. Trotzdem wird in verschiedenen Erklärungen von Staaten ein Recht auf Wasser postuliert, ohne dass man weiss, wie dem nachzukommen ist.
Skeptisch meint deshalb manch einer, die feierlichen Erklärungen der Politiker seien blosse Worthülsen, die nach dem Ritual diplomatischer Konferenzen bald wieder vergessen würden. Das mag einiges für sich haben, ist aber trotzdem zu pessimistisch. Denn das “Kompendium” allgemein akzeptierter Normen ist gegenüber der Vergangenheit doch als Fortschritt zu werten.
Zumindest geraten Staaten, die sich nicht daran halten, unter Rechtfertigungsdruck. Jene, die ihr Fehlverhalten mit Lügen verheimlichen, verlieren an Ansehen, während jene, die den Normen glaubwürdig nachkommen, zu besserem Ruf und mehr Einfluss gelangen.
Heute streben viele Politiker nach dem Friedensnobelpreis, auch wenn einige behaupten, sie würden sich um diese Eitelkeit nicht kümmern. Alle, die aber insgeheim nach Oslo gehen möchten, wissen, dass sie sich selbst in Bereichen, die früher als reine Innenpolitik galten, Verdienste für die internationale Zusammenarbeit erwerben müssen.
Zunehmend diskutieren die Bürger demokratischer Staaten darüber, was für die internationale Politik als richtig zu betrachten sei. Auch wenn Wahlen immer noch vorwiegend von nationalen Fragen dominiert werden, müssen Kandidaten darauf achten, welche Meinungen im Volk zu Themen wie Migration, Umweltschutz und Armut herrschen. Denn Meinungen progressiver Kräfte sind durchaus geeignet, das Zünglein an der Waage zu sein.
Das hat damit zu tun, dass heute viele nicht-gouvernementale Organisationen über staatliche Grenzen hinweg die öffentliche Meinung zu mobilisieren vermögen. Deren demokratische Legitimierung mag zweifelhaft bleiben, doch gelingt es ihnen, erhebliche Mittel zu sammeln, um sich im Kampf gegen die Missachtung der Menschenrechte, in den Debatten über den Umweltschutz und der humanitären Hilfe als wirksame Akteure ins Spiel zu bringen.
Somit kommt Werten in der internationalen Politik heute eine viel grössere Rolle zu, als das von den Realisten angenommen worden ist. Das heisst nicht, deswegen sei alles viel besser geworden. Noch weniger soll damit einem Moralismus das Wort geredet werden, der gestern wie heute nur zu häufig blutige Konfrontationen schürt.
Wer glaubt, Normen seien notwendig, um ein vernünftiges Zusammenleben unter den Staaten zu fördern, darf a) nicht den absoluten Vorrang seiner eigenen Überzeugungen beanspruchen, b) aber auch nicht einem nihilistischem Relativismus verfallen, und muss c) den Nutzen empirischer Forschung anerkennen, der zu einem besseren Verständnis von wünschbarem Verhalten beitragen kann.
Zu dieser Überzeugung ist ein so prominenter Verfechter moralischer Werte wie Papst Johannes Paul II. gekommen, der in der Enzyklika “Solicitudo rei socialis” schrieb, die katholische Kirche suche ebenfalls “mit Hilfe rationaler Reflexion und wissenschaftlicher Kenntnis“ die Menschen dahin zu führen, dass sie ihrer Berufung als verantwortliche Gestalter des gesellschaftlichen Lebens auf dieser Erde entsprechen.
Sich für Werte einsetzen, verlangt nicht nur Standfestigkeit, sondern auch Wissen und die Bereitschaft, mit anderen in einen konstruktiven Dialog zu treten. Das ist nur möglich, wenn jeder den Hintergrund seiner Werte offen legt und sich gleichzeitig nicht verschliesst, die eigenen Überzeugungen durch andere bereichern zu lassen.
2. Krieg und Frieden
2.1. Tradition des gerechten Krieges
Kein Zweifel, dass die Völker schon immer den Frieden wünschten und sich vor dem Kriege fürchteten. Über die Jahrhunderte haben sie das zum Ausdruck gebracht. Nur zu oft wurden sie von Herrschern missbraucht, deren Streben nach Macht, Reichtum und Ehre sie ins Elend stürzte.
In allen Zivilisationen ist das Bewusstsein vorhanden, dass der Krieg ein Übel ist:
- das gilt sowohl für die alten Babylonier und Ägypter als auch für die alten Griechen und Hebraeer;
- noch mehr trifft das auf die asiatischen Kulturen zu, die vom Konfuzianismus, Buddhismus und Hinduismus geprägt worden sind;
- ebenfalls der Islam betont Werte, die klar dem Frieden verpflichtet sind;
- ausgesprochen friedliche Traditionen sollen auch vorkoloniale Völker in Afrika und Südamerika gepflegt haben.
Dieses kulturelle Erbe in seiner Gesamtheit zu erfassen, wäre heute notwendiger denn je. Wenn hier nur auf die christliche Lehre des gerechten Krieges eingegangen wird, bedeutet das keineswegs, dass andere Zivilisationen zur Förderung des Friedens weniger beigetragen hätten.
Von der christlichen Lehre, die das spätere Abendland stark beeinflusst hat, ist das Verbot, andere Menschen zu töten, zunächst sehr ernst genommen worden. Es war für die ersten Christen derart zentral, dass sie sich von ihrem “sündigen” Umfeld abzukapseln suchten. Da sie das baldige Ende der Welt erwarteten, beschränkten sie sich darauf, dem Liebesgebot im engsten Kreise nachzukommen. Das konnten sie tun, weil sie vom römischen Reich als kleine Minderheit - wie die Juden - vom Militärdienst dispensiert worden waren.
Als sich immer mehr Soldaten taufen lassen wollten, hielten die älteren Kirchenväter an der Meinung fest, ein Soldat könne nach der Taufe nicht mehr seinen Beruf ausüben. Erst Hypolit von Rom lockerte die strikte Haltung auf, indem er sagte, ein Christ solle nicht ohne Zwang Soldat werden, ein getaufter Soldat müsse aber seinen Beruf nicht aufgeben, wenn er darauf verzichte, im Kriege zu töten. Das war nicht so naiv, wie es heute klingen mag, denn viele Soldaten hatten hinter den Frontlinien nur logistische Aufgaben zu erfüllen.
Nachdem das Christentum im vierten Jahrhundert zur römischen Staatsreligion geworden war, kam es nicht darum herum, sich näher mit politischen Institutionen auseinandersetzen. Zwar suchte man dem Grundsatz “gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist” (Mk 12,13) treu zu bleiben. Immer mehr griff man aber auf den Völkerapostel Paulus zurück, der seinen römischen Glaubensbrüdern geschrieben hatte, die staatliche Macht trage nicht ohne Grund das Schwert, denn sie stehe “ im Dienste Gottes” und vollstrecke “das Urteil an dem, der Böses tut” (Röm, 13, 4-5).
Selbstlos meinte Ambrosius im 4. Jahrhundert, ein Christ müsse für die Rettung seines Lebens nicht zur Gewalt greifen, doch sei es seine Pflicht, den zu verteidigen, dem Unrecht geschieht. “Wer gegen das Unrecht, das seinem Nächsten droht, nicht soweit kämpft, als er kann, ist ebenso schuldig wie der, der es diesem antut”.
Augustinus, der als Bischof im nordafrikanischen Hippo von Vandalen und Häretikern bedrängt wurde, zögerte nicht, der ordnenden Hand der politischen Autorität das Wort zu reden. Zwar sollte die von ihm ersehnte “tranquillitas ordinis” nicht repressiv sein, doch räumte er dem römischen Reich das Recht ein, gegen innere und äussere Feinde mit Gewalt vorzugehen, wenn es darum gehe, den Frieden wieder herzustellen.
Damit ist er zum Begründer der christlichen Lehre vom gerechten Krieg geworden. Thomas von Aquin hat sie im ausgehenden Mittelalter in die klassische Form gegossen. Minutiös arbeitete der “doctor angelicus” die Bedingungen heraus, unter denen ein Krieg für die christliche Moral nicht als Sünde zu betrachten ist:
- iusta causa: ein Krieg ist nur gerecht, wenn er begangenes Unrecht ahndet;
- recta intentio: ein Krieg darf keine andere Absicht verfolgen, als Gerechtigkeit und Frieden wiederherzustellen;
- legitima potestas: allein die staatliche Obrigkeit ist befugt, zu einem Kriege aufzurufen.
Zur Zeit des christlichen Imperiums hatten Theologen die Ansicht vertreten, ein gerechter Krieg könne nur vom Papst oder dem Kaiser ausgerufen werden. Thomas von Aquin, der als Begründer der Scholastik den Zerfall des Kaisertums erlebte, räumte dieses Recht jedoch auch den weitgehend selbstständig gewordenen Städten, Provinzen und Königreichen ein.
Vor und nachher ist aber in kirchlichen Kreisen nicht nur von gerechten, sondern auch von heiligen Kriegen gesprochen worden:
- Das war bei den Kreuzzügen der Fall, die von den Päpsten ausgelöst wurden, weil sie glaubten, eine “iusta causa” zu haben, da ihnen das Heilige Land von den Mohammedanern entrissen worden war. Deswegen riefen sie zu einem von “Gott gewollten Krieg” auf, für den sie allen Teilnehmern die Vergebung der Sünden und das ewige Heil versprachen.
- Als Ende des 15. Jahrhunderts spanische Seefahrer den südamerikanischen Kontinent entdeckten, wurde auch unter ihnen von einem heiligen Krieg gesprochen. Die Abenteurer gaben vor, den christlichen Glauben zu verbreiten, auch wenn es den meisten nur um raschen Reichtum ging. Die Päpste hielten sich zurück, der lebensfreudige Papst Alexander VI. beschränkte sich darauf, die neu entdeckten Gebiete zwischen Spanien und Portugal aufzuteilen.
Das brutale Vorgehen der Entdeckungskriege schreckte jedoch manches christliche Gewissen auf. Am schärfsten reagierte der Dominikaner Bartolome de las Casas, der sich als Bischof von Chiapas hartnäckig für die menschenwürdige Behandlung der Indianer einsetzte. Weil er mehr Niederlagen als Erfolge einstecken musste, rief er am Ende seines Lebens in prophetischem Zorn aus, sämtliche Kriege der Spanier in der neuen Welt seien ungerecht gewesen.
Nüchterner kam sein Ordensbruder Francisco de Vitoria auf die Frage zurück. Der Theologieprofessor aus Salamanca, der mit der Lehre des Thomas von Aquin bestens vertraut war, suchte diese den neuen Gegebenheiten anzupassen:
- Für ihn konnte nicht mit religiösen Argumenten entschieden werden, ob ein Krieg gerecht sei, weil es sich ausschliesslich um eine Frage des Naturrechts handle.
- Unter keinen Umständen hielt es Vitoria für vertretbar, anderen mit Gewalt den Glauben aufzuzwingen.
- Den Krieg betrachtete er als Übel, das so lange besteht, als die Völker nicht fähig sind, Meinungsunterschiede mit anderen Mitteln zu lösen.
- Ein Krieg ist nur gerecht, wenn er nicht bloss Unrecht bestraft, sondern das Wohl der Völkergemeinschaft zum Ziele hat.
- Zum Wohle der Völkergemeinschaft gehört das Recht eines jeden, überall Handel zu betreiben und seine Überzeugungen frei zu äussern. Werden diese Rechte verweigert, dürfen sie mit Gewalt erzwungen werden.
Als Vitoria sein Paradigma der Weltgemeinschaft vortrug, waren in Europa die Glaubenskriege zwischen Protestanten und Katholiken im Gange. Von beiden Seiten wurden diese als heilige Kriege geführt, die über ein Jahrhundert mehr Leid als je zuvor hervorgebracht haben. Nach dem Westfälischen Frieden hatte das zur Folge, dass:
- die Staatsführer immer unabhängiger von der christlichen Kriegsmoral operierten;
- unter protestantischen Splittergruppen die Friedenskirchen der Qüaker und Mennoniten zum Vorbild der Urchristen zurückkehrten;
- sowohl die protestantische wie die katholische Kirche sich praktisch auf das “ius in bellum” zurückzogen, um ihre Fürsten wenigstens anzuhalten, Kriege auf humane Weise zu führen.
Zu neuen Ansätzen ist es in der katholischen Lehre erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts gekommen. In seiner viel beachteten Enzyklika “Pacem in terris” sagte Papst Johannes XXIII. kurz und bündig: “In unserem Zeitalter, das sich rühmt Atomzeitalter zu sein, widerspricht es der Vernunft, den Krieg noch als das Mittel zur Wiederherstellung verletzter Rechte zu betrachten“.
Allerdings wurde die beherzte Aussage des “Papa buono” kurz darauf vom Zweiten Vatikanischen Konzil etwas zurückgestuft, indem die Konzilsväter in der Pastoralkonstitution “Gaudium et spes” festhielten: “Solange die Gefahr von Krieg besteht und solange es noch keine zuständige internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man, wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen“. Trotzdem wurde die Unmenschlichkeit des Krieges vom Konzil auf das Schärfste verurteilt, weil sie nicht der Ordnung entspreche, die vom göttlichen Gründer in die menschliche Gesellschaft eingestiftet worden sei.
Seither haben sich die Päpste mehr dem gerechten Frieden als dem gerechten Krieg zugewandt. Von den Nachfolgern des “Papa buono” wurde immer wieder betont:
- nicht Gewalt, sondern friedliches Zusammenleben stellt den zivilisatorischen Fortschritt dar;
- die Achtung der Menschenrechte ist eine unabdingbare Vorraussetzung für die Errichtung einer friedlichen Welt;
- es braucht nicht nur eine neue Diplomatie und mehr multilaterale Zusammenarbeit, allmählich muss eine die Welt umfassende Autorität errichtet werden, die imstande ist, sowohl auf der rechtlichen wie politischen Ebene wirksam zu handeln;
- ohne den solidarischen Willen der Völker, weltweit für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, ist eine stabile Friedensordnung nicht zu erreichen.
2.2. Heutige Situation
Die Geschichte lehrt, dass die lange Tradition der kirchlichen Lehre auf das kriegerische Geschehen nur geringen Einfluss ausgeübt hat. Wenn aber Staatsführer nach dem ersten Weltkrieg selber zur Einsicht gekommen sind, Kriege könnten nicht mehr als ein normales Mittel zur Regelung von Meinungsunterschieden betrachtet werden, stellt das doch eine bedeutende Zäsur dar.
Sowohl in der Satzung des Völkerbundes als auch im Briand-Kellog Vertrag hat diese Wende ihren Niederschlag gefunden. Zwar sind beide Bestrebungen kurz danach gescheitert, dennoch ist der Gedanke nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen worden.
Die Charta der Vereinten Nationen verpflichtet die Mitgliedstaaten auf Prinzipien, die mit der Theorie des gerechten Krieges einiges gemeinsam haben. Mit dem praktisch universalen Beitritt zu der Charta ist nicht mehr nur auf philosophischer, sondern auch auf politischer Ebene eine Haltung entstanden, die Michael Walzer[8] als neues Paradigma bezeichnet, das auf folgenden Elementen beruht:
- es gibt eine internationale Gemeinschaft, die aus unabhängigen Staaten besteht;
- diese haben sich auf eine Rechtsordnung geeinigt, die den Anspruch auf territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit garantiert;
- sowohl die Anwendung als auch die Androhung militärischer Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates ist eine unerlaubte Aggression;
- tritt ein solcher Tatbestand ein, sind individuelle Selbstverteidigung und gemeinsames Vorgehen mehrerer Staaten gegen den Aggressor erlaubt;
- nur der Akt einer Aggression kann den Krieg rechtfertigen;
- wird der Aggressor besiegt, darf er angemessen bestraft werden, um die Wiederholung solcher Aktionen zu vermeiden;
Bis zu einem gewissen Grade weist das Paradigma Ähnlichkeiten mit der innerstaatlichen Bekämpfung der Kriminalität auf. Doch gibt es zwischen der staatlichen und der internationalen Ordnung nach wie vor grosse Unterschiede. Immerhin scheint die allgemeine Akzeptanz des Krieges, die seit dem Westfälischen Frieden vorgeherrscht hatte, überwunden zu sein. Als Folge davon sind auch andere Aspekte des früheren Kriegsrechtes - etwa das Recht auf Neutralität - unter Druck gekommen, denn bei der Bekämpfung krimineller Akte sollte niemand abseits stehen.
Es wird darauf zurückzukommen sein, wie sich dieses “legalist paradigm” seit 1945 ausgewirkt hat. Vorher ist aber noch auf das “ius in bello” einzugehen, mit dem sich ethische Überlegungen ebenfalls seit langem beschäftigt haben.
Das “ius in bello” stellt sich die Frage, wie Kriege - unabhängig von ihrer Ursache - zu führen sind. Seit dem Altertum hat es Generäle und Soldaten gegeben, die auf den Schlachtfeldern nicht “ à tout prix”, sondern ehrenvoll siegen wollten. Für die christlichen Ritter, die vom Kriege lebten, aber nicht in ihm sterben wollten, war das ein besonders wichtiges Anliegen.
Als Kriege immer mehr Opfer verlangten, begann die katholische Kirche zu fordern, dass Gefangene nicht misshandelt werden, Kinder und Frauen zu schonen sind und es zu keinen Plünderungen kommen darf. Auch setzte sie sich dafür ein, heimtückische Waffen - wie die Armbrust - zu verbieten und das Söldnerwesen abzuschaffen. Bereits im ausgehenden Mittelalter hatte sie damit den Gedanken des humanitären Kriegsrechtes antizipiert.
Zur Zeit des Absolutismus war die Armbrust ein historisches Relikt und das Söldnerwesen blühte wie nie zuvor. Zwar suchten Könige Verluste auf dem Schlachtfeld gering zu halten, weil Söldner bezahlt werden mussten. Doch kümmerten sie sich nur wenig darum, dass ihre Soldaten plünderten und die Zivilbevölkerung bedrängten, um ihren kargen Sold aufzubessern.
Die französische Revolution leitete eine neue Etappe ein, weil in immer mehr Staaten die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Zu Tausenden starben Bürger auf den Schlachtfeldern, die von den Regierenden nicht mehr ignoriert werden konnten. Deshalb verstärkte sich die Bereitschaft der Staaten, ihre Kriegsführung gewissen Normen zu unterstellen.
Als Pionier dafür hat der Schweizer Henry Dunant gewirkt, der sich nach der Schlacht von Solferino mit allen Kräften dafür einsetzte, nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern auch verwundete und gefangene Soldaten zu schützen. 1864 gelang es ihm, verschiedene Staaten auf eine entsprechende Konvention zu verpflichten. Das von ihm initiierte Internationale Komitee vom Roten Kreuz wurde bald darauf als Völkerrechtssubjekt “sui generis” anerkannt, das seither für die Überwachung und die Weiterentwicklung des humanitären Kriegsvölkerrechtes eine herausragende Rolle spielt.
Was den Gebrauch unmenschlicher Waffen betrifft, haben sich die Staaten seit Ende des 19. Jahrhunderts auf verschiedene Abkommen geeinigt, mit denen der Einsatz gewisser Waffen verboten wurde:
- Auf den Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 wurden Dum-Dum Geschosse und der Abwurf von Bomben aus Luftballonen und Flugzeugen untersagt.
- 1925 vereinbarte man im Genfer Protokoll, den Einsatz von Gasen und bakteriologischen Kriegsmitteln zu verbieten.
- Das Verbot des Einsatzes biologischer Waffen wurde 1972 auf deren Entwicklung, Produktion und Lagerung ausgedehnt.
- Für chemische Waffen kam es 1992 zu einem gleichen Verbot, das mit umfassenden Überprüfungsmechanismen versehen wurde.
- Unter dem Druck der internationalen Zivilgesellschaft verzichteten die meisten Staaten 1997 auf die Verwendung von Personenminen;
- 2008 wurde ein aehnliches Verbot fuer Streumunition vereinbart, das zwar 2010 in Kraft getreten ist, aber von einer grossen Anzahl Staaten bisher noch nicht ratifiziert worden ist.
Wie haben sich seit 1945 unter dem “legalist” Paradigma die Regeln des “ius ad bellum” und des “ius in bello” ausgewirkt? Zwar sind zahlreiche Erklärungen abgegeben und auch rechtliche Verpflichtungen eingegangen worden, trotzdem scheinen viele von ihnen kaum mehr als die früheren Aufrufe der Kirche beachtet zu werden.
Obwohl die Charta der Vereinten Nationen inzwischen von praktisch allen Staaten ratifiziert worden ist, haben seit 1945 über 200 Kriege stattgefunden, was eine enttäuschend hohe Zahl ist. Schaut man sich aber die Statistiken näher an, lässt sich dennoch behaupten, dass nicht unbedingt alles beim Alten geblieben ist.
- Zwischen nuklearen Mächten ist es nie mehr zu einem militärischen Schlagabtausch gekommen, selbst wenn es unter ihnen frontale Interessenkonflikte gab.
- Unter westlichen Demokratien sind ebenfalls keine Kriege mehr zu verzeichnen.
Abgesehen davon ergibt sich aber ein wenig erfreuliches Bild:
- Gegenüber Dritten sind sowohl die westlichen Demokratien als auch die nuklearen Supermächte in Kriege verwickelt geblieben.
- Bei den europäischen Demokratien waren es vor allem jene, die Mühe bekundeten, ihre kolonialen Besitzungen aufzugeben.
Erst nach schweren Kämpfen zog sich Frankreich aus Indochina (1954) und Algerien (1962) zurück. England, das seine Kolonien friedvoller geräumt hatte, griff zusammen mit Frankreich in die Krise um den Suez-Kanal ein (1956) und verteidigte später - mit besseren Argumenten - den Angriff der argentinischen Militärdiktatur auf die Falkland (Malvinas)-Inseln (1982). Holland und Belgien haben sich nicht ohne Scharmützel aus Indonesien (1949) und dem Kongo (1960) zurückgezogen. Die afrikanischen Kolonien Portugals konnten erst nach der demokratischen Revolution des Mutterlandes ihre Unabhängigkeit erreichen.
- Noch häufiger haben die nuklearen Grossmächte USA und UdSSR seit 1945 militärisch interveniert, um freundlich gesinnte Kräfte an der Macht zu erhalten oder an die Macht zu bringen:
USA: Umsturz von Arbenz in Guatemala (1954); Entsendung von Marineeinheiten nach Libanon (1958); Schweinebucht-Invasion in Kuba (1961) Vietnamkrieg (1963-1973); Interventionen in der Dominikanischen Republik (1965), in Grenada (1983) und in Panama (1989); Luftangriffe auf Libyen (1986); Intervention im Irak (2003)
UdSSR: Interventionen in Ungarn (1956), in der Tschechoslowakei (1968), in Afghanistan (1971-1983).
Die Aufzählung ist lückenhaft, weil nicht alle indirekten Unterstützungen mit Waffenlieferungen, Militärberatern und finanzieller Hilfe berücksichtigt werden.
- Auffallend ist, dass kriegerische Auseinandersetzungen seit 1945 vor allem in der Dritten Welt stattgefunden haben:
Mittlerer Osten: sieben Kriege zwischen Israel und arabischen Nachbarn (1948, 1967, 1973, 1981, 1982, 2006, 2009); syrische Besetzung des Libanon (1976); Krieg zwischen Irak und Iran (1980-1988); Besetzung von Kuwait durch Irak (1990).
Asien: drei Kriege zwischen Indien und Pakistan (1949, 1965, 1971); chinesische Besetzung von Tibet (1950); Grenzzwischenfälle China-UdSSR (1961) sowie China-Indien (1962); Krieg wischen Nord- und Südvietnam (1959-1973); Besetzung von Ost-Timor durch Indonesien (1975); Besetzung von Kambodscha durch Vietnam (1978); Einmarsch chinesischer Truppen in Vietnam (1979);
Afrika: militärische Auseinandersetzung zwischen Algerien und Marokko (1963); Einmarsch libyscher Truppen im nördlichen Tschad (1973); Übergriffe der südafrikanischen Armee in Angola (1975); Einmarsch marokkanischer Truppen in die Westsahara (1975); Konflikte Mali-Burkina Faso (1974/1985); Angriffe katangischer Söldner auf Zaire (1977/1978 ); Besetzung von Ogaden durch somalische Truppen (1977); Intervention von Tansania in Uganda (1979); Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien (1998).
Lateinamerika: Nicaragua-Honduras (1957); Honduras-El Salvador (1969); Peru-Ecuador (1981), Kolumbien-Ecuador (2008).
- Viel häufiger als zu zwischenstaatlichen Kriegen ist es seit 1945 zu internen Konflikten gekommen. Bei diesen geht es entweder um den Aufstand gegen ungerecht empfundene Regime oder um den Kampf ethnischer Minderheiten für Autonomie oder Unabhängigkeit.
Konflikte solcher Art hat es auch in den westlichen Demokratien gegeben (England-Nordirland, Italien-Südtirol), oder schwelen immer noch (Spanien-Baskenland, Frankreich-Korsika).
In ueberwiegender Mehrheit haben sie jedoch in der Dritten Welt und im frueheren Ostblock stattgefunden. In der suedlichen Hemisphaere begann sich deren Zahl schon bald nach der letzten Unabhaengigkeitswelle zu vermehren. In Osteuropa war dies nach dem Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion der Fall.
Seit 1945 hatten durchschnittlich zwei Drittel der Kriege innerstaatlichen Charakter. Heute ist deren Anteil auf ueber 90% angestiegen. Erfreulicherweise sind sie in letzter Zeit numerisch zurueckgegangen, was sich aber wegen zahlreicher ethnischer Spannungen, die nach wie vor bestehen, schnell wieder aendern kann.
2.3. Nukleare Abschreckung
Gegen Ende des zweiten Weltkriegs wurde die Atombombe erfunden. Nachdem sie in Hiroshima und Nagasaki schreckliche Auswirkung gezeigt hatte, ist sie nie mehr zum Einsatz gekommen. Als Mac Arthur im Korea-Krieg darauf zurückgreifen wollte, wurde ihm das von Präsident Eisenhower verweigert, weil er um das Ansehen seines Landes fürchtete.
Waren die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben tausende Male wirksamer als jede bisher bekannte Waffe, ist deren Zerstörungskraft mit der Wasserstoffbombe in das Millionenfache gestiegen. Die Zauberlehrlinge der Wissenschaft hatten eine Waffe erfunden, nit der in Sekunden die gesamte Menschheit vernichtet werden kann.
Auch Realisten erkannten bald, dass militärisch ein völlig neues Zeitalter begonnen hatte. George F. Kennan schrieb, Nuklearwaffen könnten nicht mehr als rationales Mittel der Kriegsführung betrachtet werden. Was ist seither mit dieser Waffe passiert?
- Die USA verteidigten zunächst ihr Monopol, waren jedoch bereit, die Erzeugung zivil verwendeter Atomenergie und die Verwaltung der dafür notwendigen Rohstoffe in die Hände einer internationalen Behörde zu legen (Baruch-Plan von 1946).
- Die Sowjetunion verweigerte die notwendigen Kontrollen, da sie bereits an der Entwicklung einer eigenen Bombe arbeitete und diese 1949 erfolgreich testete.
- 1952 erprobten die Engländer ihre erste Atombombe und traten dem Klub der Atomwaffenmächte bei.
- Dieser weitete sich 1960 auf Frankreich und 1964 auf China aus.
Obwohl unter liberalen und kommunistischen Grosmächten frontale Feindschaft herrschte, kamen beide Seiten rasch zur Einsicht, dass es im gegenseitigen Interesse lag, die Verbreitung der ungeheuerlichen Waffe zu verhindern.
Auf Betreiben der USA und der UdSSR wurde 1968 der Atomsperrvertrag vereinbart, der auf folgende Prinzipien beruht:
- Zum Besitz von Nuklearwaffen sind nur jene fünf Staaten berechtigt, die am 1.1. 1967 einen erfolgreichen Test durchgeführt hatten (USA, UdSSR, UK, Frankreich und China).
- Die übrigen Vertragsparteien verzichten auf den Erwerb und die Entwicklung von Nuklearwaffen.
- Die Nicht-Nuklearstatten sollen für die zivile Nutzung der Atomenergie technologisch unterstützt werden.
- Die Nuklearmächte verpflichten sich, in “naher Zukunft” Verhandlungen über die Beendigung des Wettrüstens und die Abrüstung nuklearer Waffen aufzunehmen.
Dem Vertrag sind bis heute 187 Staaten beigetreten. 1995 wurde er im Konsens auf unbeschränkte Zeit verlängert, obwohl dessen Ziele bei weitem nicht als erreicht betrachtet werden konnten:
- Die Atommächte sind ihren Verpflichtungen zur Abrüstung nur zoegerlich nachgekommen. Die Enttaeuschung richtete sich insbesonders auf die beiden Supermaechte USA und UdSSR, waehrend der Druck auf Frankreich, das Vereinigte Koenigreich und China geringer war, da sie vergleichsweise ueber viel bescheidenere Arsenale verfuegen. Mit den SALT-Veträgen begannen die USA und die UdSSR in den 1970er Jahren das Gleichgewicht des Schreckens auf hohem Niveau zu stabilisieren. 1987 einigten sie sich, ihre Mittelstreckenraketen zu vernichten. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind in verschiedenen Runden von START-Abkommen zwischen den USA und Russland die Obergrenzen fuer einsetzbare Sprengköpfe und Traegersysteme verringert worden. Das erste SART-Abkommen von 1991 sah noch Hoechstwerte fuer Sprengkoepfe von 6000 vor, mit dem New START Abkommen von 2010 sollen diese auf 1550 reduziert werden. Trotzdem verfuegen die USA und Russland nach wie vor ueber ein Volumen an Nuklerawaffen, das die Bestaende von legalen und illegalen Nukleramaechten um ein Vielfaches uebertrifft.
- Positiv zu bemerken ist dagegen, dass sich einige Staaten, die zunächst nicht auf Nuklearwaffen verzichten wollten, entschlossen haben, dem Atomsperrvertrag beizutreten oder zumindest dessen Kontrollregime zu uebernehmen. Das war für Argentinien, Brasilien und Südafrika der Fall, die sich 1990/1991 bereit erklaerten, ihre nuklearen Waffenprogramme einzustellen. Anderseits weigern sich Länder wie Israel, Pakistan und Indien, die über Nuklearwaffen verfügen, bis heute, dem Abkommen beizutreten.
- Leider haben sich die Kontrollen, die der Internationalen Atomenergie Agentur (IAEA) übertragen worden waren, als unzureichend erwiesen. Nach dem ersten Golfkrieg stellte sich heraus, dass der Irak - trotz seiner Mitgliedschaft zum Vertrag - an einem geheimen Nuklearwaffenprogramm arbeitete, das von den Kontrollbehörden nicht entdeckt worden war. Die gleiche Situation hat sich ebenfalls in Nordkorea ergeben. Neuerdings wird der Iran - auch er ein Mitglied des Vertrages - verdächtigt, nukleare Waffenkapazitäten zu entwickeln.
Dass die “legitimen” Atommächte zu wenig abgerüstet haben, ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass sich das “know how” zur Herstellung nuklearer Waffen staendig verbreitet. Die Befürchtung, neben Staaten könnten auch terroristische Gruppen in den Besitz nuklearer Waffen gelangen, ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Somit ist das Risiko, dass Nuklearwaffen zum Einsatz kommen könnten, bei weitem nicht gebannt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schaetzungen SIPRI Yearbook 2011
Heute ist unter den Politikern der legalen Nuklearmächte kaum mehr einer zu finden, der sich offen für den Einsatz von Nuklearwaffen ausspricht. Selbst für den Fall extremer Not, bei dem eine diabolische Macht alle anderen zu unterwerfen sucht, ist man weitgehend der Auffassung, dass mit einem Nuklearschlag von keiner Seite viel zu gewinnen wäre.
Um so mehr muss man sich fragen: a) warum der Besitz von Atomwaffen nach wie vor hingenommen wird; b) ob es erlaubt ist, mit solchen Waffen zu drohen; c) welchen Sinn es macht, sich mit Waffen zu rüsten, die als Mittel der Kriegsführung untauglich sind.
Von den ethischen Traditionen sind darauf unterschiedliche Antworte gegeben worden.
- Die christliche Naturrechtslehre hat Nuklearwaffen schon früh als moralisch nicht akzeptierbar bezeichnet. Papst Johannes XXIII. forderte 1963 in seiner Enzyklika “Pacem in terris” ein totales Verbot für Atomwaffen. Auch wenn das Zweite Vatikanische Konzil das Recht auf Verteidigung bestätigte, lehnte es Kriegshandlungen ab, mit denen “ganze Städte und Völker” vernichtet werden, worunter nukleare Erst- wie nukleare Gegenschläge zu verstehen sind.
- Die Utilitaristen, die mehr Konsequenzen als Prinzipien in den Vordergrund stellen, halten die nukleare Abschreckung als vertretbar, solange sie den Krieg verhindert. Mit etwas zu drohen, das nie zum Einsatz kommen darf, ist nicht verwerflich, weil nicht ein Übel, sondern dessen Verhinderung beabsichtigt wird. Die Möglichkeit eines fatalen Zwischenfalls wird geringer eingeschätzt als die Wahrscheinlichkeit, vor einem Angriff abzuschrecken. Dass jede Nuklearmacht im Stande sein muss, auf einen Angriff mit einem vernichtenden Zweitschlag antworten zu können, ist notwendige Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der Abschreckung.
Auch wenn zwischen den Nuklearmächten seit Hiroshima und Nagasaki nie mehr Kriege stattgefunden haben, bleibt der Atomsperrvertrag doch ein sonderbares Gebilde. Sollen mit dem Besitz von Nuklearwaffen wirklich Kriege verhindert werden, ist nicht einzusehen, warum nur fünf Staaten das Recht haben sollten, über solche zu verfügen.
Der Neo-Realist Kenneth N. Waltz hat schon vor Jahren die Meinung vertreten, es sei für die internationale Sicherheit nicht schlechter, wenn mehr Staaten in den Besitz von Nuklearwaffen kämen[9]. Denn so würden auch diese gezwungen, mit Gewaltanwendung vorsichtiger umzugehen. Ist es aber wirklich notwendig, dass die ganze Welt auf einem nuklearen Pulverfass sitzt, das beim kleinsten Irrtum zu den fatalsten Konsequenzen führen kann?
Die Forderung, auf Nuklearwaffen zu verzichten, ist berechtigt, doch nicht ohne weiteres zu erfüllen. Da die nukleare Waffentechnologie immer leichter zugänglich wird, kann man sich nicht darauf beschränken, nur von den “legalen” Nuklearmächten die völlige Abrüstung zu verlangen. Denn von “illegalen” Nuklearmächten könnten gerade nicht-nukleare Staaten als erste in eine Situation völliger Erpressbarkeit geraten.
Inzwischen hat sich sogar der amerikansiche Praesident Obama auf das Ziel verpflichtet, eine Welt ohne Nuklearwaffen herbeizufuehren. Um das zu erreichen, waere der heutige Atomsperrvertrag wohl umzugestalten und schrittweise auf eine voellig neue Persperktive auszurichten:
- Zunaechst sollten alle Nuklearstaaten - ob sie dem Atomsperrvertrag angehören oder nicht - die Verpflichtung übernehmen, keinen Erstschlag (“first strike”) durchzuführen;
- Auf die frühere Idee des Baruch-Plans, die Bewirtschaftung der Atomenergie einer internationalen Behörde zu übertragen, muesste man wieder zurueckkommen.
- Darauf sollten die Nuklearstaaten auch die Lagerung ihrer Waffenarsenale den Vereinten Nationen übertragen, wobei für Entscheide über deren Verwendung das Veto-Recht im Sicherheitsrat geändert werden müsste.
- Schliesslich haetten alle Länder, die Forschung für Abwehrsysteme betreiben, ihre Bemühungen zusammenzulegen und den Kauf solcher Systeme auch anderen Staaten zugänglich zu machen.
Vor einem solchen Szenario ist man freilich noch weit entfernt. Letztlich kann aber der Verzicht auf den Erstschlag von keinem vernünftigen Staat verweigert werden. Auch wuerde die gemeinsame Bewirtschaftung des Brennstoffzyklus viele Probleme der Kontrollen loesen. Nuklearwaffen den Vereinten Nationen zu übergeben, klingt zugegebenrmassen illusorisch, doch würde damit der Anreiz für die Entwicklung geheimer Nuklearwaffenprogramme vermindert. Multilaterale Zusammenarbeit bei der Erforschung von Raketenabwehsystemen könnte schliesslich den Verdacht ueberwinden, dass solche Systeme zu offensiven Zwecken entwickelt werden.
2.4. Selbstbestimmung der Völker
Früh vermochten die englischen, französischen und spanischen Königsreiche nationale Identitäten herauszubilden, auch wenn sie Minderheiten mit harter Hand behandelten. Für die französischen Revolutionäre war das Thema der Minderheiten bedeutungslos, weil sie die Gleichheit aller Menschen verkündeten.
Dem deutschen und dem italienischen Volk ist es erst im 19. Jahrhundert gelungen, sich unter dem Banner einer eigenen Regierung zu vereinigen. Damals breitete sich in Europa ein starker Nationalismus aus, der verlangte, dass jedes Volk sich selber regieren müsse.
Als die Vielvölkerreiche der Habsburger, Zaren und Ottomanen nach dem ersten Weltkrieg zusammenbrachen, machte sich der amerikanische Präsident Wilson zum Anwalt des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Doch ging es ihm vor allem darum, europäischen Völkern, die schon früher unabhängig gewesen waren, wieder zu einem eigenen Staat zu verhelfen.
Auf dem komplexen Hintergrund der europäischen Geschichte war naemlich klar, dass nicht jeder ethnischen, sprachlichen oder religiösen Gemeinschaft die Unabhängigkeit gewährt werden konnte. Deshalb kam man in den Pariser Friedensverträgen zum Kompromiss, den besiegten Mächten und den neu entstandenen Staaten besondere Vorschriften für die Behandlung von Minderheiten aufzuerlegen.
Nach dem zweiten Weltkrieg fand das Selbstbestimmungsrecht der Völker Eingang in die Charta der Vereinten Nationen, worauf es in allen Vereinbarungen über die Menschenrechte wiederholt wurde. Keines dieser Dokumente definierte jedoch, was unter einem Volk zu verstehen ist.
Hatte für Wilson noch mehr die Unabhängigkeit der unterjochten Völker in Europa im Vordergrund gestanden, lautete die Botschaft nach dem zweiten Weltkriege, dass nun auch das Ende der europäischen Kolonialherrschaft über die südliche Hemisphäre gekommen sei. Als immer mehr Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden, machten deren neue Führer umgehend klar, dass die von den Kolonialmächten hinterlassenen Grenzen nicht verändert werden dürfen.
Darüber kam man sowohl unter alten wie neuen Staaten rasch zu einem Konsens, selbst wenn man sich bewusst war, dass es in den neuen Staaten eine Vielzahl von Minderheiten gab. Allgemein herrschte die Ansicht vor, eine stabile Weltordnung wäre nicht möglich, wenn man den über 10 000 ethnischen, sprachlichen und religiösen Minderheiten der Welt ein Recht auf Unabhängigkeit zugestehen würde.
Dennoch kam es unter den früheren Kolonien verschiedentlich zu neuen Grenzziehungen:
- Das war bereits 1947 für Indien und Pakistan der Fall, die sich bei der Unabhängigkeit in zwei verschiedene Staaten trennten, obwohl sie von den Engländern gemeinsam verwaltet worden waren.
- 1971 erlangte Bangladesh, die ehemals östliche Provinz von Pakistan, die Unabhängigkeit
- Als die Portugiesen 1975 ihre Kolonie Osttimor aufgaben, wurde die Insel von Indonesien besetzt und konnte erst 2002 - nach jahrelangen Kämpfen und internationalem Druck - die Unabhängigkeit erreichen.
- 1950 beschloss die UNO, die ehemalige italienische Kolonie Eritrea dem äthiopischen Kaiserreich, das praktisch immer unabhängig geblieben war, als autonome Provinz einzuverleiben. Nach einem dreissigjährigen Bürgerkrieg und einer Volksbefragung wurde Eritrea 1993 von der internationalen Staatengemeinschaft als unabhängiger Staat anerkannt.
- Unter aehnlichen Umstaenden ist der Suedsudan 2011 unabhaengig geworden.
Zu der grössten Zahl neuer Staaten ist es jedoch nach dem Fall der Berliner Mauer im ehemals kommunistischen Osteuropa gekommen:
- Tschechen und Slowaken vereinbarten 1992 eine friedliche Trennung.
- Weniger reibungslos war kurz vorher die Sowjetunion in 15 neue Staaten aufgelöst worden. Die unter dem Kommunismus entstandene Föderation hatte ihren Mitgliedern das Recht eingeräumt, den Verbund jederzeit wieder verlassen zu koennen. Als das Recht tatsaechlich beansprucht wurde, sorgte das in den frueheren Machtzentralen fuer einige Fustration.
- Viel blutiger verlief der Prozess im ehemaligen Jugoslawien, dessen sozialistische Verfassung die gleiche Bestimmung enthielt. Auf deren Grundlage verkündeten 1991 Slowenen und Kroaten ihre Unabhängigkeit, was wenig später auch Mazedonien und Bosnien-Herzegowina taten. Nach langjährigen Kriegen blieb nur mehr der Verbund zwischen Serbien und Montenegro übrig, der 2006 ebenfalls auseinander fiel.
- Für Kosovo, der ethnisch unterschiedlichsten Gruppe im ehemaligen Jugoslawien, hatte Tito den Status einer konstitutiven Republik verweigert und das Gebiet als autonome Provinz der serbischen Republik zugeteilt. Nachdem Milosevic den Kosovaren die Autonomie entzogen hatte, kam es zu jahrelangen Gewalttätigkeiten, die trotz intensiver Vermittlungsversuche nicht gelöst werden konnten. Schliesslich riefen die Kosovaren 2008 einseitig die Unabhängigkeit aus, die inzwischen von über 60 Staaten anerkannt worden ist.
- Als im August 2008 Georgien seine abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien in sein international anerkanntes Staatsgebiet zurückzuführen suchte, wurde das von russischen Truppen verhindert, worauf sich die beiden Provinzen als unabhaengig erklaerten, obwohl diese bisher nur wenig Anerkennung gefunden haben.
Nach wie vor gibt es auf der ganzen Welt ein Dutzend Kriege, bei denen Minderheiten für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Die meisten unter ihnen finden in den früheren Kolonien der südlichen Hemisphäre statt. Beispiele dafür sind neben vielen anderen die Westsahara, Kaschmir und die muslimischen Südprovinzen der Philippinen. Die mit solchen Bestrebungen verbundene Zahl ändert sich ständig, weil einige Regierungen entweder am Verhandlungstisch oder auf dem Kriegsschauplatz erfolgreich sind, waehrend es an anderen Orten zu neuen Konflikten kommt.
Was ist von dem proklamierten, aber nie definierten Selbstbestimmungsrecht der Völker zu halten? Unabhängigkeitsbewegungen sind stets entlang sprachlicher und religiöser Grenzen entstanden. Trotzdem gibt es viel mehr multiethnische als völlig homogene Staaten. Da niemand darauf erpicht ist, neue Staaten anzuerkennen, verlangen selbst zentralistische Regierungen, Minderheitenprobleme über Autonomiestatute zu regeln.
Wenn das Selbstbestimmungsrecht der Völker unbestimmt geblieben ist, hat das damit zu tun, dass ein Volk weniger mit objektiven Kriterien (Sprache, Religion, Rasse) als mit subjektiven Gefühlen der Zusammengehörigkeit zu definieren ist. Subjektive Gefühle sind Aenderungen unterworfen, weshalb weiterhin mit Unabhängigkeitsbewegungen zu rechnen ist. Somit bleiben einige der Kriterien aktuell, die John Stuart Mill im nationalistischen Europa des 19. Jahrhunderts entwickelt hat:
- Freiheit kann einem Volk nicht aufgezwungen werden, sondern muss von ihm selber errungen werden.
- Deswegen ist es nicht erlaubt, selbst ein diktatorisches Regime von aussen mit Gewalt zu beseitigen.
- Hat sich aber ein Staat bei einem internen Konflikt auf die eine Seite geschlagen, kommt anderen Staaten das gleiche Recht zu.
Auch wenn diese aus dem klassischen Verständnis der Souveränität entwickelten Richtlinien eine gewisse Gültigkeit behalten, stellt sich heute die Frage, ob es ethisch verantwortbar ist, gegenüber einer Regierung, die massiv die Menschenrechte der eigenen Bevölkerung verletzt, völlig passiv zu bleiben.
2.5. Humanitäre Interventionen
Aus politischen Gründen sind nach dem Kalten Krieg in mehreren Staaten massenhaft Menschen ermordet worden. Das war nicht neu, aber die globale Kommunikation verbreitete unerträgliche Bilder menschlichen Leidens. Von der öffentlichen Meinung kamen Regierungen unter Druck, gegen solche Grausamkeiten vorzugehen.
Für die Staaten war und ist das kein einfaches Thema. Zwar hatten sie schon früher bei internen Konflikten ihre Staatsbürger, die dort lebten, mit militärischen Mitteln in Sicherheit gebracht. Aber konnten sie das Gleiche auch für bedrohte Bürger eines anderen Staates tun, nachdem sie wiederholt beteuert hatten, sich nicht in interne Angelegenheiten einmischen zu wollen?
Nach wie vor werden von der Charta der Vereinten Nationen die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit als Grundpfeiler der internationalen Ordnung betrachtet. Zwar sind diese Prinzipien häufig verletzt worden, nicht zuletzt von den Grossmächten, die in anderen Staaten intervenierten, um ihren ideologischen Einflussbereich zu erhalten. Zumindest war dabei aber klar, dass es sich um illegale Aktionen handelte. Völlig anders ist die Frage, ob ein militärisches Vorgehen gerechtfertigt ist, wenn in einem Staat massenhaft Menschen umgebracht werden, weil die Regierung die Kontrolle verloren hat oder sogar selber hinter den Ausschreitungen steht.
Es waren die fatalen Ereignisse in Ruanda, Bosnien-Herzegowina und Kosovo, die eine Debatte über die Zulässigkeit humanitärer Interventionen auslösten. Allerdings sind Interventionen solcher Art schon früher vorgekommen, aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg sei nur an folgende Beispiele erinnert:
- Der Einmarsch von Indien in Ostpakistan (1971), dem heutigen Bangladesh, wo die pakistanische Armee, nachdem die dortige Bevölkerung mehr Autonomie verlang hatte, zu einem fürchterlichen Gemetzel schritt, das die indische Armee in einem Feldzug von zwei Wochen zum Stillstand brachte;
- Der Übergriff der tansanischen Armee auf Uganda (1978), als Idi Amin über 300’ 000 eigene Bürger umbrachte, was zu massiven Flüchtlingsströmen nach den Nachbarländern führte.
- Die Besetzung von Kambodscha durch Vietnam (1979), wo die vietnamesische Armee dem Terror-Regime von Pol Pot ein Ende setzte, das fast einen Drittel seiner Landsleute ausgerottet hatte.
Indien, Tansania und Vietnam haben ihre Aktionen stets mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründet (Art. 51 der UNO-Charta), weil sie unter Flüchtlingsströmen und Grenzverletzungen zu leiden hatten. Den Begriff “humanitäre Intervention” vermieden sie, da dieser in der UNO-Charta nicht vorhanden war und sie auch befürchteten, dass sie eines Tages selber davon betroffen werden könnten.
Befürchtungen solcher Art sind bis heute erhalten geblieben, was erklärt, warum die Staatengemeinschaft nach dem Ende des Kalten Kriegs auf humanitäre Katastrophen grossen Ausmasses meistens passiv reagierte. Nur in wenigen Fällen ist man entweder auf eigene Faust vorgegangen, oder hat sich im Rahmen von Beschlüssen des UNO-Sicherheitsrates an nicht sehr erfolgreichen Massnahmen beteiligt.
- Nach dem ersten Golfkrieg richteten Amerikaner, Engländer und Holländer im Nord- und Südirak militärische Schutzzonen für die von Saddam Hussein verfolgten Kurden und Schiiten ein, ohne dass sie dafür von der UNO eine ausdrückliche Ermächtigung erhalten hatten (1991).
- Als die Regierungsgewalt in Somalia zusammenbrach und Tausende von Menschen an Hunger starben, beschloss der Sicherheitsrat den Einsatz einer UNO-Friedenstruppe zur Sicherung der Nahrungsmittelhilfe (1992), der jedoch in einem Fiasko endete.
- Obwohl sich in Ruanda ein Völkermord abzeichnete, begnügte sich der Sicherheitsrat mit der Entsendung einer kleinen Beobachtergruppe, die wenig zu bewirken vermochte, auch als Frankreich in letzter Minute ein vages und nicht uninteressiertes Mandat zur Errichtung einer Schutzzone erhielt (1994).
- 1995 entsandte der Sicherheitsrat Blauhelmtruppen nach Bosnien-Herzegowina, um die humanitäre Hilfe zu gewaehrleisten und die von Serben und Kroaten verfolgten Bosnier zu schützen, was nach den skandalösen Vorfällen in Srebrenica erneut zu einem beschämenden Misserfolg führte.
- Als die Regierung in Belgrad den Kosovo ethnisch zu säubern suchte und der Sicherheitsrat blockiert war, entschied sich die NATO 1999 einseitig zu einem militärischen Eingriff, der zwar die rasche Rückkehr von über 800’000 Flüchtlingen ermöglichte, indirekt aber die spätere Unabhängigkeit der Kosovo-Albaner bewirkte.
- Den ebenfalls einseitig ausgelösten Interventionen westafrikanischer Mitglieder der ECOWAS in Liberia und Sierra Leona zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat der Sicherheitsrat erst nachträglich das “nihil obstat” erteilt.
- Trotz aller Bemühungen der UNO und der Afrikanischen Union ist es bisher nicht gelungen, dem Völkermord in Darfur ein Ende zu setzten.
Die wenig glücklichen Erfahrungen lassen die Frage offen, ob ein Recht auf humanitäre Intervention besteht. Von Völkerrechtlern wird das mehrheitlich verneint, weil die territoriale Integrität eines Staates nur im Falle einer Aggression verletzt werden darf und der UNO-Sicherheitsrat ausschliesslich bei der Bedrohung des Weltfriedens militärische Massnahmen beschliessen kann.
Realisten betrachten den Begriff der humanitären Intervention als Unsinn, da Staaten nur aufgrund eigener Interessen handeln und deswegen auch keine Soldaten zur Rettung fremder Menschen in den Krieg zu schicken haben.
Befürworter meinen dagegen, die UNO-Charta hätte den Schutz der Menschenrechte zu einer internationalen Verpflichtung gemacht, so dass deren massive Verletzung als Bedrohung des Weltfriedens zu betrachten sei. Ihrer Meinung nach kann ein Staat nur Anspruch auf Nichteinmischung erheben, wenn er fähig ist, einen minimalen Schutz der eigenen Bürger zu verwircklichen. Darueber hinaus behaupten einige sogar, das Recht auf humanitäre Interventionen sei im Völkergewohnheitsrecht verankert, was trotz aller Sympathie für das Thema etwas weit hergeholt erscheint.
Als die muslimischen Bosnier von Serben und Kroaten gnadenlos abgeschlachtet wurden, kam Papst Johannes Paul II., der sich Kriegen jeglicher Art vehement widersetzt hatte, ohne juristische Spitzfindigkeiten zum Schluss:
“Wenn alle Möglichkeiten diplomatischer Verhandlungen, alle Verfahren internationaler Vereinbarungen und Organisationen ausgeschöpft sind, trotzdem aber ganze Bevölkerungsteile einem ungerechten Aggressor zum Opfer fallen, haben die Staaten nicht mehr das Recht, indifferent zu bleiben. Vielmehr haben sie die Pflicht, den Aggressor zu entwaffnen, nachdem alle übrigen Mittel unwirksam geblieben sind. Die Grundsätze der Souveränität und der Nichteinmischung in interne Angelegenheiten behalten zwar ihre Berechtigung, dürfen aber nicht ein Schutzwall sein, hinter dem gefoltert und getötet wird.” (Neujahrsansprache an das diplomatische Korps vor dem Heiligen Stuhl, 1993)
Das war zumindest Klartext, der jedoch weder die Ratlosigkeit noch die Meinungsunterschiede unter den Regierungen zu überwinden vermochte. Nachdem die NATO einseitig in Kosovo eingegriffen hatte und das schlechte Gewissen für den unsäglichen Völkermord in Ruanda weiterhin herrschte, wagte UNO-Generalsekretär Kofi Annan 1999 den versammelten Staatenvertreter der UNO die Frage zu stellen:
“Falls die humanitäre Intervention als eine unannehmbare Verletzung der Souveränität zu betrachten ist, wie sollen wir dann auf Situationen reagieren, wenn - wie in Ruanda und Srebrenica - die Menschenrechte in einer derart offenen massiven und systematischen Weise verletzt werden, die allen unseren Vorstellungen von der Menschenwürde widerspricht?”
Umgehend wurde das Thema von der kanadischen Regierung aufgegriffen, die eine 10-köpfige Kommission von Experten aus allen Weltteilen einberief, welche den Gegensatz zwischen Souveränität und humanitärer Intervention untersuchen sollte.
Zwölf Monate später veröffentlichte die Kommission ihren Bericht “Die Verantwortung für die Beschützung”[10]. Die Experten sprachen nicht von humanitärer Intervention, sondern wählten den Begriff der Beschützung, weil sie hofften, damit gewisse Widerstände abzubauen. Trotzdem kamen sie klar zum Schluss, dass bei extremen Situationen der Schutz von Menschenleben höher als die Beachtung der staatlichen Souveränität einzustufen ist.
Für die Definition extremer Fälle schlug die Kommission Kriterien vor, die sich auf die Theorie des gerechten Krieges stützen:
- Die Verantwortung, Menschenleben zu schützen, ist primär Aufgabe des Staates. Ist ein Staat nicht willens oder fähig, diese Aufgabe zu erfüllen, geht die Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft über (“legitima potestas“).
- Das Prinzip der Nichteinmischung ist nicht mehr zu halten, wenn Menschen aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen im grossen Ausmass umgebracht werden oder eine imminente Gefahr dafür besteht (“iusta causa“).
- Bei Interventionen in einem solchen Staat darf kein anderes Ziel verfolgt werden, als das Leiden der betroffenen Bevölkerung zu beenden (“recta intentio”).
- Der Rückgriff auf militärische Aktionen ist nur gestattet, wenn vorher alle Mittel für eine gewaltlose Lösung ausgeschöpft worden sind.
- Eine militärische Aktion hat sich strikte auf das zu beschränken, was zum Schutz von Menschenleben notwendig ist.
- Sie darf nur begonnen werden, wenn eine Aussicht auf Erfolg besteht.
Auf die Frage, bei wem die “legitima potestas” liegt, um über die “iusta causa” zu befinden, antwortete die Kommission:
- Diese Kompetenz liegt beim UNO-Sicherheitsrat, der immer mit der Frage zu befassen ist.
- Zur Erleichterung von Entscheiden sollten die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates auf ihr Veto-Recht verzichten, wenn für sie keine vitalen Interessen auf dem Spiele stehen (konstruktive Enthaltung).
- Kommt der Sicherheitsrats zu keinem Entscheid, ist die UNO-Generalversammlung nach dem Verfahren “Unitig for Peace” mit der Angelegenheit zu befassen, weil diese mit einer weitgehend unterstützen Empfehlung den Sicherheitsrat unter Druck setzen könnte.
- Ist der Sicherheitsrat auch so zu keinem Entscheid fähig, sind einseitige Vorgehen einzelner Staaten erlaubt, was jedoch dem Ansehen der UNO schweren Schaden zufügen würde.
Die Empfehlungen der Kommission sind von den UNO-Mitgliedstaaten an ihrem Gipfel von 2005 weitgehend uebernommen worden. Allerdings wurde die Komptenz fuer einen Entscheid zur Intervention ausschliesslich auf den Sicherheitsrat beschraenkt. Sechs Jahre spaeter konnte sich dieser zum ersten Mal fuer eine solche Aktion in Lybien entscheiden. Die nach wie vor divergierenden Interessen unter den Veto-Maechten, aber auch deren zweifelhafte Bereitschaft, die entpsrechenden Risiken einer militaerischen Intervention auf sich zu nehmen, lassen einige Zweifel offen, ob die Verantwortung fuer die Beschuetzung auch in jedem Fall tatsaechlich wahrgenommen wird.
2.6. Terrorismus
Leute, die aus politischen Überzeugungen andere Menschen töten oder deren Eigentum schädigen, verstehen sich nicht als Terroristen, sondern als Freiheitskämpfer. Sie behaupten, sich für eine höhere Sache zu verwenden, die von der “auctoritas principis” unterdrückt werde, so dass keine andere Möglichkeit übrig bleibe, als mit Gewalt vorzugehen.
Der Terrorismus wird heute mehr denn je verworfen, doch ist er so alt wie der Krieg.
- Zynisch meinte kürzlich ein Staatsoberhaupt, die Schweiz - eine der ältesten Demokratien Europas - sei von einem Terroristen begründet worden, was nicht völlig falsch ist, denn nach der Überlieferung sind die schweizerischen Bauern dank dem treffsicheren Armbrustschützen Willhelm Tell unabhängig geworden, der dabei jedoch das Leben seines Sohnes zu retten vermochte.
- Im Mittelalter waren es Theologen, die zwar nicht selber zu den Waffen griffen, aber in ihren Schriften den Tyrannenmord rechtfertigten. Johannes von Salisbury und Marsilius von Padua hielten es als erlaubt, Herrscher mit Gewalt zu beseitigen, wenn diese nicht das Naturrecht respektierten.
- Ohne moralische Skrupel suchten später Diplomaten an ihren Tafelrunden unliebsame Gegner mit Giftbechern auszuschalten, wenn das von ihren Herrschern gewünscht wurde.
- Ende des 19. Jahrhunderts gingen russische Anarchisten mit Pistolen gegen Vertreter des verhassten Zarenreiches vor. Ein serbischer Student, der 1914 in Sarajewo den Thronfolger des österreichischen Kaisers ermordet hatte, löste den Ausbruch des ersten Weltkrieges aus.
Seit der Verbreitung der Demokratie ist der Terrorismus nicht weniger häufig geworden. Obwohl er empört abgelehnt wird, gibt es auch heute noch Fälle, wo ihm mit Verständnis begegnet wird.
- Den terroristischen Aktionen des polnischen Widerstandes gegen die nazistische Besetzung stimmten demokratische Kräfte zu, weil man sich bewusst war, dass den unterdrückten Polen keine andere Möglichkeit übrig blieb.
- Mit Entsetzen reagierte die öffentliche Meinung zunächst auf die spektakulären Flugzeugentführungen und Gewalttätigkeiten der palästinensischen Befreiungsbewegung (PLO), inzwischen meint aber mehr als einer, es wäre an der Zeit, den Palästinensern jenen Staat zu geben, der ihnen schon 1948 von der UNO versprochen worden war.
- Ähnlich - aber nicht ganz gleich - ist es Nelson Mandela ergangen, der mit friedlichen Mitteln die Apartheid in Südafrika zu überwinden suchte, sich nach jahrelangen Misserfolgen zu Terroranschlägen gezwungen sah, dafür während zwei Jahrzehnten im Gefängnis sass und heute einhellig als Held und grosser Staatsmann gefeiert wird.
Manchmal haben Staaten mit gleichen Mitteln auf terroristische Anschläge reagiert, ohne damit besonders erfolgreich gewesen zu sein.
- Der israelische Staat ist seit seiner Gründung gegen palästinensische Terroristen nach dem Moto “Auge um Auge, Zahn um Zahn” vorgegangen, obwohl das Ergebnis wenig überzeugend ist.
- Während des algerischen Unabhängigkeitskriegs wurde von der französischen Armee gefoltert und getötet, was die endgültige Niederlage Frankreichs beschleunigt hat.
- Mehrere südamerikanische Militärdiktatoren, die Tausende junger Oppositioneller verschwinden liessen, sind schliesslich nach Justizverfahren in Gefängnissen gelandet.
- Das Apartheid-Regime in Südafrika suchte sich mit allen Mitteln zu behaupten, ist aber dennoch zusammengebrochen.
Heute steht die Debatte um den islamischen Terrorismus im Vordergrund. Am 11. September 2001 haben 19 todesbereite Flugzeugentführer in New York und in Washington mehr Opfer gefordert als die japanische Attacke auf Pearl Harbor. Die Aktion war gegen die Vereinigten Staaten gerichtet, obwohl 40% der Opfer aus 80 anderen Ländern stammten. Ähnliche Anschläge haben danach in europäischen Ländern - vor allem in England und Spanien - stattgefunden. Seither ist es vor allem in muslimischen Ländern zu einer noch viel höheren Zahl von Opfern gekommen.
Der Terrorismus von Al Kaida stellt eine neue Etappe dar, weil er:
- religiöse Ziele zu verfolgen behauptet;
- sich ganz bewusst nicht auf Einzelpersonen, sondern auf massenhafte Opfer ausrichtet;
- Attentäter rekrutiert, die bereit sind, ihr Leben zu opfern;
- über eine transnationale Organisation verfügt, die sich neben Spenden auch mit eigenen Investitionen finanziert;
- moderne Mittel der Logistik und Kommunikation beherrscht und in der Lage sein dürfte, sich Massenvernichtungswaffen zu beschaffen.
Ist es erlaubt, zwischen guten und bösen Terroristen zu unterscheiden? Lassen sich die einen rechtfertigen, während andere verwerflich sind? Dazu hat es immer unterschiedliche Meinungen gegeben, ein klares Urteil darüber ist nicht leicht zu fällen.
Terroristische Aktionen sind vertretbar, wenn sie sich gegen diktatorische Regime richten, die in konstanter Willkür grundlegende Menschenrechte verletzen. Bedingung dafür ist, dass sie sich auf Ziele beschränken, die direkt mit der Diktatur verbunden sind und sich in erster Priorität gegen Sachwerte und nicht gegen Menschenleben richten. Unter keinen Umständen sind wahllose Anschläge auf unschuldige Personen zu rechtfertigen, selbst wenn damit der Widerstand gegen das Regime gefördert werden soll.
Weil terroristische Aktionen mit grossen Emotionen verbunden sind, hat man sich mit deren Legitimität nur wenig befasst. Erneut sind jedoch in der Theorie des gerechten Krieges - trotz aller Unterschiede - hilfreiche Ansätze zu finden. Wie beim gerechten Krieg können solche Aktionen nur unter extremen Umständen als zulässig gelten, nämlich wenn:
- seitens einer Regierung schweres Unrecht begangen wird (“iusta causa”);
- vorher alle Bemühungen für eine friedliche Lösung unternommen worden sind (“ultima ratio“);
- nur gegen Ziele vorgegangen wird, die unmittelbar für das Unrecht verantwortlich sind (kein wahlloses Vorgehen gegen Unbeteiligte);
- man sich bei den Mitteln darauf beschränkt, was zur Beseitigung des Unrechts notwendig ist und eine minimale Aussicht auf Erfolg besteht.
Für diese Argumentation gibt es in der neueren Geschichte kein besseres Beispiel als die schwarze Befreiungsbewegung in Südafrika.
- Dass die Apartheid-Politik eine krasse Verletzung grundlegender Menschenrechte darstellte, ist offenkundig.
- Der ANC (“African National Congress”) hat zunächst auf den Dialog mit der weissen Minderheitsregierung gesetzt, um die Rassengesetze abzuschaffen.
- Als dieser nichts fruchtete, wandte er sich an die öffentliche Meinung.
- Weil er auch damit nicht weiter kam, griff er zu Massnahmen zivilen Ungehorsams, wobei sich die dafür Verantwortlichen ohne Widerstand verhaften liessen.
- Erst als der ANC als illegal erklärt wurde und keine anderen Kommunikationsmöglichkeiten übrig blieben, kam es zu Sabotageakten, die vorwiegend Sachobjekte zum Ziele hatten.
Völlig verschieden operierten rote Fanatiker in europäischen Demokratien - vor allem in Italien und in Deutschland -, die zur gleichen Zeit versuchten, prominente Vertreter des “faschistischen” Kapitalismus zu ermorden:
- Die Zielsetzungen dieser Gruppen waren diffus, es war schwierig zu verstehen, von wem sie unterdrückt wurden.
- Ihre Anhänger hatten weder mit den Regierungen noch mit der Zivilbevölkerung den Dialog gesucht, sondern griffen gleich zu Methoden wahlloser Gewalt.
Nicht so eindeutig fällt das Urteil über die terroristischen Aktionen der IRA, der ETA und der FARC aus:
- Dass die katholische Minderheit in Nordirland diskriminiert wurde, ist wohl kaum zu bestreiten. Die IRA, die dagegen kämpfte, hat anfänglich ihre Aktionen auf staatliche Einrichtungen und Würdenträger beschränkt. Ihr Ziel, das Problem mit der Eingliederung in die irische Republik zu lösen, war jedoch der protestantischen Mehrheit Nordirlands nicht zuzumuten. Selbst wenn die IRA schliesslich zu einer Verhandlungslösung gekommen ist, hat sie zur Gewalt gegriffen, bevor alle Mittel einer friedlichen Lösung ausgeschöpft worden sind.
- Die baskische Widerstandsbewegung ist vom Franco-Regime hart unterdrückt worden. Nach dem demokratischen Wandel in Spanien hat die ETA ihre Attentate auf Vertreter des spanischen Staates weitergeführt, obwohl von diesem Verhandlungen angeboten worden waren. Dass die ETA nach wie vor an ihrem Ziel festhaelt, solange der spanische Staat auf ihre Forderung der Unabhängigkeit nicht eingeht, ist nicht nachvollziehbar, weil dieses Postulat selbst unter der baskischen Bevölkerung umstritten ist.
- Wenn die FARC in Kolumbien vor 60 Jahren die soziale Gerechtigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat, konnte das damals durchaus als “iusta causa” gelten. Nachdem aber die Guerilla nach so vielen Jahren unter demokratischen Verhältnissen nur wenig Unterstützung findet, mit Entführungen grausam erpresst und sich über den Drogenhandel finanziert, hat sie sich von der Gerechtigkeit ihres ursprünglichen Anliegens weit entfernt.
Es gibt noch andere Bewegungen, deren Operationen mit ähnlichen Fragen zu versehen sind.
Zum blutigen Terrorismus von Al Kaida ist im Lichte der vorgenannten Kriterien folgendes zu sagen:
- Das Ziel von Al Kaida, die islamische Religion von der Unterdrückung zu befreien, ist wenig klar. Die Urheber dieser “Verfolgung” bleiben unbestimmt, selbst wenn dafür laizistische Strömungen innerhalb der muslimischen Staaten verantwortlich gemacht werden.
- Die Methoden von Al Kaida, massenhaft unbeteiligte Personen zu ermorden, sind völlig unakzeptabel, um so mehr als dafür selbst Minderjährige und geistig Behinderte rekrutiert werden.
Nach dem tragischen Attentat vom 11. September 2001 hat Papst Johannes Paul II. vielen aus dem Herzen gesprochen, als er in seiner Neujahrsbotschaft vom 1. Januar 2002 sagte: “Es ist eine Profanierung der Religion, sich als Terroristen im Namen Gottes zu bezeichnen”. Vorbehaltlos anerkannte er das Recht, sich gegen einen solchen Terrorismus zu wehren, weil er ein “Verbrechen gegen die Menschheit” darstelle. Dennoch warnte der Papst davor, nur mit Gewalt zu reagieren, da “mutig und entschlossen” auch Situationen von Unterdrückung und Ausgrenzung anzugehen seien, um solchen Aktionen ihren “Nährboden “ zu entziehen.
Wie ist unter diesem Gesichtspunkt die amerikanische Reaktion auf die Terrorakte vom 11. September 2001 zu beurteilen?
- Als Präsident Bush mit Attacken gegen Staaten drohte, die international tätige Terroristen beherbergen und unterstützen, und diese Drohung kurz darauf in Afghanistan wahr machte, stand das durchaus auf der Linie eines legitimen Aktes der Selbstverteidigung.
- Im Falle des Krieges gegen den Irak war das Argument weniger überzeugend, weil es für eine aktive Verbindung zwischen dem Diktator Saddam Hussein und Al Kaida keine Beweise gab, obwohl an der gegenseitigen Sympathie nicht zu zweifeln war.
- Um wahllos vorgehende Terroristen zu verfolgen, sind geheime und verdeckte Operationen erlaubt, bei Notwehr darf auch getötet werden.
- Nicht vertretbar ist dagegen, gefangene Terroristen zu foltern, um von ihnen Informationen über den Verbleib von Mitkämpfern zu erwirken, denn Menschenrechte sind auch gegenüber Terroristen zu beachten.
3. Menschenrechte
3.1. Geschichtliche Wurzeln
Viele Politiker kümmern sich heute um die Menschenrechte. Das bedeutet nicht, dass diese erst in der Neuzeit erfunden worden sind. Nach Ansicht von Anthropologen sollen gerade primitive Stammesgemeinschaften zwischen individuellem Wohlbefinden und kollektiven Interessen einen glücklichen Ausgleich gefunden haben.
Die Geschichte war jedoch mehr von Imperien und absoluten Herrschern geprägt, die Menschen vorwiegend als Objekte behandelten. Die Masse der Untertanen hatte keine andere Wahl, als sich einem kläglichen Schicksal zu fügen.
Dagegen wurde immer wieder revoltiert, lange aber nur wenig erreicht. Dennoch vermochte sich das Gedankengut von Philosophen und Theologen zu erhalten, mit dem etwas anderes ersehnt wurde.
Um an dieses zu erinnern, wird hier einmal mehr nur die abendländische Geschichte berücksichtigt, ohne damit zu unterstellen, dass andere Kulturkreise nicht ebenfalls wichtige Beiträge geleistet hätten.
Im Abendland, wo über Jahrhunderte Imperien herrschten, geht die Idee der Menschenrechte auf die griechische Antike zurück.
- In den griechischen Stadtstaaten verfügten die erwachsenen Männer über weitgehende Freiheitsrechte. Der Verlust dieser Rechte nach der Eroberung durch Philipp von Mazedonien war für sie eine schmerzliche Erfahrung. Um ihre Mitbürger zu trösten, entwickelte die Philosophenschule der Stoa die Lehre, dass jedem Menschen Rechte zukommen, die unabhängig von seiner staatlichen Zugehörigkeit gelten. Weil diese in der menschlichen Natur begründet seien, müssten sie von politischen Obrigkeiten sowohl gegenüber den eigenen Untertanen als auch gegenüber Fremden beachtet werden. Cicero, der prominente Jurist des römischen Reiches, den die Lehre der Stoa stark beeindruckt hatte, sagte dazu, es gebe “eine natürliche Vertrautheit unter den Menschen, derart, dass ein Mensch gerade darum, weil er ein Mensch ist, dem anderen Menschen nicht fremd zu sein scheint”. Es liege deshalb in der Natur des Menschen, “sich auch um das Wohl von seinesgleichen zu kümmern“.
- Wenig später verkündete Jesus, der Sohn des Zimmermanns, in einfachen Worten die universale Gleichheit aller Menschen:
- “Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen” (Mt. 5,43).
- “Alles, was ihr wollt, dass es euch die Menschen tun, das sollt ihr auch ihnen tun” (Mt. 7,12)
Der Völkerapostel Paulus zog daraus den Schluss: “Es gibt nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allen” (Kol. 3,11)
- Augustinus und Thomas von Aquin, die den christlichen Glauben philosophisch zu erklären suchten, griffen auf die Lehre der Stoa zurück. Ihr Ausgangspunkt war, dass alle Menschen gleich seien, weil Gott jeden als sein Ebenbild erschaffen habe. Nach dem Schöpfungsplan sollten alle die Möglichkeit haben, ihre Vollendung zu erreichen. Durch die Erbsünde sei die vom Schöpfer gewollte Natur des Menschen zwar geschwächt, aber nicht zerstört worden. Den ursprünglich in ihn gesetzten Plan könne der Mensch dank der Erlösung Christi wieder aufnehmen.
- Besonders klar hat Thomas von Aquin die christliche Naturrechtslehre formuliert:
- Am Anfang steht das ewige Gesetz Gottes (lex aeterna), an dem der Schöpfer alle Menschen teilnehmen lassen wollte.
- Auch nach dem Sündenfall bleibt der Mensch befähigt, die von Gott gewollte Ordnung mit seiner Vernunft und seinem Gewissen zu erkennen (lex naturalis).
- Die göttlichen Offenbarungen (lex divina) stehen in keinem Gegensatz zu der Vernunft, sie sollen dem Menschen bloss helfen, zu dem ursprünglichen Schöpfungsplan zurückzufinden;
- Weil jeder Mensch mit Vernunft ausgestattet ist, hat er die Pflicht, das positive Recht (ius positivum) der menschlichen Gemeinschaft nach den Prinzipien des Naturrechts zu gestalten.
Von dieser Lehre ging die spanische Spätscholastik aus, die sich nach den Entdeckungsfahrten mit neuen Fragen konfrontiert sah:
- Der Dominikaner Francisco Vitoria hielt es nicht als erlaubt, primitive Völker zu versklaven. Sofern diese friedfertig seien, habe niemand das Recht, sie mit Gewalt zu erobern.
- Die Begründung, der Papst und der Kaiser müssten den richtigen Glauben nötigenfalls auch mit Gewalt verbreiten, wies er zurück. Der Glaube sei ein Akt der Vernunft und dürfe nicht mit Gewalt aufgezwungen werden.
- Vitoria sprach bereits von einer Gemeinschaft der Völker, die nicht nur Christen, sondern auch Heiden umfasse. Alle ihre Mitglieder müssten sich in gegenseitigem Respekt und freiem Meinungsaustausch begegnen. Kriege seien nur zu rechtfertigen, wenn sie im Interesse des weltweiten Gemeinwohls stünden.
Der Jesuit Francisco Suarez - ebenfalls ein Vertreter der spanischen Spätscholastik - trat dem Gottesgnadentum der christlichen Könige entgegen. Zwar hielt er am göttlichen Ursprung der Staatsgewalt fest, weil sich der Mensch nach dem Schöpfungsplan nur in der Gesellschaft entfalten könne. Aber gerade deswegen sei die Staatsgewalt vom göttlichen Schöpfer nie für Einzelne reserviert worden, sie bleibe immer bei allen Mitgliedern einer Gesellschaft verankert. Selbst wenn diese zeitweilig auf eine oder mehrere übertragen wurde, könne sie vom Volk jederzeit wieder zurück genommen werden.
Nach der Reformation ging der Einfluss der katholischen Gesellschaftslehre zurück. Die mit Gewalt ausgetragenen Glaubensstreitigkeiten hatten viele skeptisch gemacht. Zur Zeit der Renaissance wurde eine Sicht des Menschen entwickelt, die weniger religiös geprägt war. Es ging noch nicht um die totale Abkehr vom Glauben, doch verbreitete der Erfolg der Naturwissenschaften die Überzeugung, Gott hätte seinen Geschöpfen alle Mittel mitgegeben, um ihre Probleme selber zu lösen. An die Stelle einer sakralen Weltanschauung trat der Wille, aus eigner Kraft das “hic et nunc” der Welt zu erklären und zu gestalten.
Von der Aufklärung wurde die menschliche Vernunft in den Mittelpunkt gestellt. Politisierende Philosophen und philosophierende Juristen trugen neue Leitlinien für die gesellschaftliche Ordnung vor. Milton, Locke und Rousseau forderten, jeder Mensch habe ein Recht auf Leben, Freiheit und Glück. Damit sind sie zu den Vätern der modernen Menschenrechte geworden.
Den liberalen Nachfolgern des 19. Jahrhunderts, die sich mehr um wirtschaftliche Zusammenhänge kümmerten, ging es vor allem darum, das Joch des staatlichen Einflussbereiches zurückzudrängen, weil sie überzeugt waren, dass die freie Initiative des Einzelnen zum grösstmöglichsten Glück für alle führen werde.
Die beiden Ansätze - einerseits die rational begründeten Menschenrechte, anderseits die positive Auswirkung individueller Freiheiten auf den materiellen Wohlstand - üben bis heute eine grosse Anziehungskraft aus.
Marx kam dagegen mit seiner Theorie des Klassenkampfes zu einem völlig anderen Schluss. Die Ursache aller Übel ging für ihn auf das Privateigentum zurück. Die Menschenrechte der Aufklärung betrachtete er als Instrumente des kapitalistischen Systems, um die Ausbeutung der Arbeiterschaft aufrecht zu erhalten.
Marx war überzeugt, die proletarische Revolution werde die auf individuellen Egoismus ausgerichteten Menschenrechte überflüssig machen. Erst in der sozialistischen Gesellschaft erlange jeder das Recht auf Arbeit ohne Ausbeutung, was die Voraussetzung gleicher Rechte für alle sei. Somit gehe es vor allem um wirtschaftlich-soziale Rechte, weil erst diese die effektive Ausübung politischer und ziviler Rechte ermöglichen würden.
Verschiedene Länder der Dritten Welt haben sich nach dem Ende der Kolonisierung von der marxistischen Ideologie beeinflussen lassen, weil:
- sie von ihren Eliten übernommen worden war;
- sich Menschen in ihren Traditionen schon immer mehr als Mitglieder einer Gruppe verstanden hatten;
- sie als rückständige Länder daran interessiert waren, wirtschaftliche Rechte gegenüber dem reichen Norden in den Vordergrund zu stellen.
Aus anderen Gründen wandte sich Singapur, das mit eigenen Werten zu einem erstaunlichen Wirtschaftserfolg gekommen war, gegen die westliche Auffassung der Menschenrechte. 1994 wurde ein amerikanischer Junge, der Personenwagen mit Graffitis bespritzt hatte, in dem kleinen Stadtstaat zu sechs Stockschlägen verurteilt. Das Urteil verursachte in den Vereinigten Staaten eine derartige Empörung, dass Präsident Clinton intervenieren musste. Darauf reduzierte der Premierminister von Singapur die Strafe auf vier Stockschläge, hielt aber unverblümt fest:
Der Westen befinde sich in einer moralischen Krise, da er nur dem Individualismus und dem Egoismus huldige. Familien fielen auseinander, gemeinnützige Institutionen würden durch Missbrauch ausgehöhlt, das Leistungsprinzip werde durch Drogenkonsum, Müssiggang und Kriminalität untergraben, weil jeder nur mehr an sich selber denke, um seine hedonistischen Neigungen zu befriedigen.
Hans Küng - ein katholischer Theologe, der häufig Schwierigkeiten mitr seiner Hierarchie hatte - vertritt schon seit langem die Ansicht, den internationalen Erklärungen zu den Menschenrechten sollte eine Charta über die Menschenpflichten beigefügt werden.[11] Mit seinem Ansinnen ist er bis heute nicht erfolgreicher geworden als jene Revolutionäre, die mit der gleichen Forderung bereits 1789 im französischen Parlament unterlegen waren.
Der aufmüpfige Schweizer Theologe ist jedoch nicht weit von der Lehre seiner Kirche entfernt, wenn er die Auffassung vertritt, eine Gesellschaft könne nicht bestehen, wenn jeder nur Rechte einfordere, ohne auch Pflichten zu übernehmen.
Dass Menschenrechte die Pflicht implizieren, diese gegenüber anderen zu respektieren, liegt auf der Hand. Doch braucht es für Küng noch etwas mehr, nicht nur der Wille, eigene Rechte durchzusetzen und die der anderen zu respektieren, sondern auch die Bereitschaft, sich darüber hinaus im Namen der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit für das Wohl anderer einzusetzen.
Diese elementare Einsicht ist nach Küng in allen religiösen Traditionen vorhanden. Auch mit Nichtgläubigen könne man sich darüber verständigen, weil niemand zu bestreiten wage, dass eine Gesellschaft ohne den Willen zur Zusammenarbeit nicht bestehen kann.
Empirisch-rationale Politikwissenschafter liefern vier Begründungen, gemäss denen ein Minimum an Menschenrechten unter allen Umständen einzuhalten ist:
- die Theorie menschlicher Grundbedürfnisse, die davon ausgeht, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und Überleben hat;
- das viel anspruchsvollere Postulat, dass alle einen Anspruch auf eine sozial gerechte Gesellschaft haben;
- die eher pragmatische Annahme, dass zumindest jene Menschenrechte zu garantieren sind, ohne die andere Güter von gemeinsamen Interesse nicht verwirklicht werden können;
- und die viel nüchterne Feststellung, dass Menschenrechte national wie weltweit nur zum Durchbruch kommen, wenn sie auf einem Konsens unter den Beteiligten beruhen.
Ethisch gesehen ist der Konsens ein schwaches Argument, denn was sein soll, kann nicht mit dem begründet werden, was ist. Trotzdem hat auch dieses Argument seine Bedeutung, weil gemeinsam empfundene Rechte in jedem Fall höher zu bewerten sind als die Willkür von Tyrannen.
3.2. Praktische Verwirklichung
Blickt man auf die Geschichte der heute verfochtenen Menschenrechte zurück, kommt man nicht um die Feststellung herum, dass:
- diese vornehmlich aus dem westlichen Abendland hervorgegangen sind;
- der lockere Gemeinschaftssinn des abendlaendischen Feudalismus mehr aus Pflichten als aus Rechten bestand;
- die danach entstandenen Königreiche eine immer stärkere Kontrolle über ihre Bürger ausübten, was zu Widerständen führte;
- dabei mehr mit Gewalt als mit Konsens etwas verändert wurde.
Nicht nur britische Schulkinder kennen die “Magna Charta” von 1215, die zu den Geburtsstunden der Menschenrechte gezählt wird. Es handelte sich um einen ersten, aber noch kleinen Schritt, weil es den englischen Baronen bloss darum ging, ihrem König ein paar Rechte für sich selber abzuringen.
Allerdings hat das Beispiel nachgewirkt, denn nach der “glorious revolution” sind in der englischen “Bill of Rights” von 1689 eine Reihe persönlicher Rechte festgeschrieben worden, die für alle Gültigkeit hatten. Obwohl die “Bill of Rights” unter turbulenten Umständen zustande gekommen war, ist sie danach von den englischen Königen immer respektiert worden.
Zu den Protagonisten der naechsten Etappe gehoerte allerdings nicht mehr England, sondern Amerika und Frankreich, was Ende des 18. Jahrhunderts von viel tieferen Umwälzungen begleitet war.
- Als sich England gezwungen sah, wegen seiner Kriegs- und Kolonialpolitik den amerikanischen Kolonien neue Steuern aufzuerlegen, kam es zu einem Aufstand, der zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten führte. Mit der Erklärung der Unabhängigkeit wurde die “Virginia Bill of Rights” verkündigt, die auf die Freiheitsideale der “pilgrims” zurückgriff, die nach Amerika ausgewandert waren, um der religiösen Verfolgung in Europa zu entgehen. Auch orientierte sich die “Bill of Rights” an der englischen Tradition der Menschenrechte, deren Beachtung vom Mutterland versprochen worden war. Ferner wurden Elemente aus dem Geistesgut der Aufklärung uebernommen. Dennoch waren die Nachfolger der “pilgrims” nicht sehr darauf erpicht, ihre Errungenschaften als universale Sendung zu betrachten, zumal die “Virginia Bill of Rights” den Makel enthielt, dass Sklaven und Indianer nicht in den Genuss der gleichen Rechte kamen.
- Obwohl die Menschenrechtserklärung der französischen Revolution der “Virginia Bill of Rights” nahe stand, ist diese unter viel radikaleren Umständen zustande gekommen. Sie war die Antwort auf ein dekadentes Regime, das zu einer horrenden Finanz- und Wirtschaftskrise geführt hatte. Vordergründiges Ziel war deshalb, die parasitäre Monarchie abzuschaffen. Im Gegensatz zur “Virginia Bill of Rights” spielte christliches Gedankengut kaum mehr eine Rolle. Menschenrechte wurden allein mit der Vernunft begründet, wie es die Aufklärung gelehrt hatte. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit galten nicht mehr als Zugeständnisse von Regierenden, weil sie der politischen Gemeinschaft vorausgehen. Die wichtigste Aufgabe des Staates war für die französischen Revolutionäre, die Menschenrechte zu achten und zu fördern.
- Viel mehr als ihre amerikanischen Vorkämpfer fühlten sich die französischen Revolutionäre mit einer universalen Sendung betraut. Ihre radikalen Kräfte schreckten nicht davor zurück, die Ideen der Revolution mit Kriegen zu verbreiten. Doch endeten die Feldzüge - selbst unter dem begnadeten, aber wenig demokratischen Feldherrn Napoleon - in kläglichen Niederlagen.
Obwohl das “Ancien Regime” vom Wiener Kongress wieder hergestellt worden war, vermochte sich die Idee der Menschenrechte zu erhalten. In verschiedenen europäischen Staaten konnte sie sich im Verlauf der liberalen Revolutionen des 19. Jahrhunderts verbreiten. Auch fand sie Eingang in die Verfassungen lateinamerikanischer Länder, die damals ihre Unabhängigkeit erlangten.
Je mehr menschliche Grundrechte von Staaten anerkannt wurden, umso mehr waren Regierungen bereit, für gewisse Rechte über die eigenen Grenzen hinaus zusammen zu arbeiten. Diese Bereitschaft blieb zunächst auf spezifische Themen beschränkt.
- Einer der ersten Schritte war das humanitäre Kriegsvölkerrecht. Dem Aufruf des Schweizers Henry Dunant, für den Krieg Vorschriften über den Schutz der Zivilbevölkerung, der Verwundeten und Gefangenen zu vereinbaren, folgten die Staaten recht willig. Denn die Massenheere, die sich nach der französischen Revolution verbreiteten, führten zu immer zahlreicheren Opfern, die nicht mehr Söldner, sondern Bürger waren. 1864 wurde in Genf das internationale Komitee vom Roten Kreuz gegründet, das mit der Überwachung dieser Normen beauftragt wurde. Die unabhängige Instanz, die über Völkerrechtspersönlichkeit verfügt, hat seither nicht nur überwacht, sondern auch konstant für die Weiterentwicklung dieser Regeln gewirkt.
- Der zweite Schritt war ebenfalls mit der Hartnäckigkeit einer Person verbunden. Der englische Abgeordnete William Wilberforce kämpfte über Jahrzehnte für die Abschaffung der Sklaverei. Mit der Zeit gelang es ihm, die öffentliche Meinung der “zivilisierten” Welt zu mobilisieren. 1890 wurde in Brüssel ein Verbot des Sklavenhandels erlassen, ein allgemeines Verbot der Sklaverei kam danach erst 1926 im Völkerbund zustande.
- Die Industrialisierung des 19. Jahrhundert war für viele Arbeiter von einem Los begleitet, das manche mit der Sklaverei verglichen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen einige Regierungen die Lebensbedingungen der Arbeiter über gesetzliche Vorschriften zu verbessern. 1901 wurde in Genf eine private Vereinigung mit dem Ziel gegründet, solche Minimalstandards über staatliche Grenzen hinaus zu verbreiten. Diese Initiative wurde 1918 im Rahmen des Völkerbundes in eine zwischenstaatliche Organisation umgewandelt. Die internationale Arbeitsorganisation, in der neben staatlichen Delegierten auch solche der Arbeiterschaft und der Unternehmer vertreten sind, hat seither zahlreiche Konventionen zum Schutz der Arbeiter ausgearbeitet.
- Als sich nach dem ersten Weltkrieg die Vielvölkerreiche der Habsburger und der Ottomanen auflösten, entstand eine Reihe neuer Staaten. Der amerikanische Präsident Wilson, der zum Sieg der Alliierten beigetragen hatte, war ein überzeugter Verfechter des Selbstbestimmungsrechtes der Völker. Doch wurde bald klar, dass es nicht möglich war, nur ethnisch homogene Staaten zu schaffen. Verschiedene Friedensverträge nach dem ersten Weltkrieg enthielten deshalb Schutzvorschriften zugunsten nationaler Minderheiten, mit denen ihnen die Nicht - Diskriminierung und die Pflege ihrer Sprache und Kultur garantiert wurden. Allerdings galten die Vorschriften nur für Staaten, die zu den Kriegsverlierern gehörten oder nach dem Krieg neu entstanden waren. Die Siegermächte, in denen es ebenfalls Minderheiten gab, hielten es nicht für notwendig, sich selber solchen Normen zu unterwerfen.
Nach dem ungeheuerlichen Holokaust waehrend des zweiten Weltkrieges forderte eine beschämte Welt, so etwas dürfe nie mehr geschehen. Auch Staatslenker kamen zur Überzeugung, die Beachtung grundlegender Menschenrechte müsse im Interesse des Weltfriedens umfassend und global verankert werden.
Deshalb setzte sich die UNO-Charta zum Ziel, “die Achtung von den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen”. Die Generalversammlung erhielt den Auftrag, dafür konkrete Vorschläge auszuarbeiten.
Schon drei Jahre später konnte diese mit 48 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen die allgemeine Erklärung über die Menschenrechte verabschieden. Allerdings erfolgte das nur in der Form einer politisch verbindlichen Resolution. Achtzehn Artikel der Erklärung waren den klassischen Freiheitsrechten gewidmet, sechs enthielten Rechte wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Natur, die den Anliegen kommunistischer Mitgliedstaaten Rechnung trugen.
Die Absicht war, auf der Grundlage dieser Resolution möglichst rasch zu einem völkerrechtlichen Vertrag zu kommen. Doch geriet das Unterfangen ins Stocken, weil sich während des Kalten Krieges die Meinungen über den Stellenwert der politischen und wirtschaftlichen Rechte verhärteten. Erst 1966 konnte man sich auf den Kompromiss einigen, die beiden Aspekte in zwei unterschiedlichen Verträgen zu regeln. Am 19. Dezember 1966 konnten von der Generalversammlung gleichzeitig das Abkommen über bürgerliche und politische Rechte sowie das Abkommen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte genehmigt werden. Beide Abkommen sind seither von über 150 Staaten ratifiziert worden.
Darüber hinaus haben sich die Vereinten Nationen bemüht, für spezifische Themen rechtliche Vereinbarungen auszuhandeln. Bei einigen Themen war das rasch möglich, bei anderen musste darauf gewartet werden, bis man sich auf die Menschenrechtspakte geeinigt hatte. Die wichtigsten unter ihnen sind:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: „United Nations Treaty Collection“ 2012
Nicht nur die Vereinten Nationen, sondern auch regionale Organisationen haben sich nach dem zweiten Weltkrieg mit dem Thema der Menschenrechte befasst.
- Im Europarat wurde 1951 eine Menschenrechtserklärung angenommen, die demokratische Freiheitsrechte festschrieb, wie sie sich in unter den Mitgliedstaaten entwickelt hatten. Nach intensiven Debatten kam 1964 eine Sozialcharta hinzu, welche die Besonderheit aufwies, dass sich Staaten aus einem umfangreichen Katalog nur auf ein gewisses Minimum zu verpflichten hatten. Die Hoffnung war, dass dank dem guten Beispiel von Einzelnen mit der Zeit alle in der Charta aufgezählten Verpflichtungen übernommen würden.
- Als die westlichen Staaten 1969 auf den sowjetischen Vorschlag eingingen, eine Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa einzuberufen, taten sie das unter der Bendingung, dass nicht nur über Grenzen und Wirtschaft, sondern auch über Menschenrechte gesprochen werden muesse. Nach der Helsinki-Akte von 1975 löste dieses Thema an periodischen Folgekonferenzen harte Auseinandersetzungen aus. Doch ist daraus eine Dynamik entstanden, die nicht ohne Wirkung auf die politischen Veränderungen von 1989 geblieben ist.
- Die Organisation Amerikanischer Staaten - die als loser Zusammenhalt schon seit 1890 bestand, sich jedoch erst 1948 eine formelle Satzung gab - verabschiedete 1969 eine Menschenrechtserklärung, die weitgehend die traditionellen Freiheitsrechte übernahm. Wenig später einigte auch sie sich auf ein Zusatzprotokoll, in dem wirtschaftliche und soziale Rechte festgelegt wurden.
- In der Organisation für die Afrikanische Einheit kam es 1981 zur Banjul-Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, die individuelle Rechte verankerte, aber auch das Recht der Völker auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung unterstrich. Als erste sprach sie nicht nur von Rechten, sondern auch von Pflichten, wobei namentlich hervorgehoben wurde, sich nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Familie und das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen.
- Die Konferenz islamischer Staaten nahm 1990 in Kairo eine Menschenrechtserklärung an, die auf dem Prinzip beruhte, dass sich der Mensch nur im richtigen Glauben entfalten kann. Menschenrechte müssen deshalb nach der Lehre des Propheten verwirklicht werden. Der Koran enthält grundlegende Aussagen zur Menschenwürde, seine unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau bleibt aber kontrovers.
- Der asiatische Kontinent ist der einzige, auf dem es bis heute weder eine regionale Dachorganisation, noch eine regionale Menschenrechtserklärung gibt. Jedoch sind gerade auf diesem Kontinent uralte Traditionen vorhanden, die von einem Verständnis des Menschen ausgehen, das selbst moderne Bürger des Westens anzieht. Dahinter verbirgt sich eine Kosmologie, die sich stark von den individualistisch verstandenen Menschenrechten des Westens abhebt. Ob der wirtschaftliche Fortschritt, der auf diesem Kontinent stattfindet, daran etwas ändert, ist vorläufig nicht zu beantworten.
3.3. Schwierige Umsetzung
Menschenrechte sind zu einem Paradigma der Politik von demokratischen Regierungen geworden. Obwohl ständig darüber geredet wird, bleibt man jedoch weit davon entfernt, dass sie für alle Gültigkeit haben.
Die Umsetzung ist in der Tat die entscheidende Herausforderung. Widersprüchliche Auffassungen haben paradoxerweise dazu geführt, dass auf dem Papier nicht weniger, sondern stets neue Rechte entstanden sind.
- Am Anfang standen der Schutz des Individuums vor Übergriffen der Herrschenden (“status negativus“) sowie seine politischen Beteiligungsrechte (“status activus“) im Vordergrund.
- Später entwickelten sich - nicht nur in kommunistischen Ländern, sondern auch in westlichen Industriestaaten - wirtschaftliche und soziale Rechte, die auf Leistungen des Staates ausgerichtet waren (“status positivus“).
- In letzter Zeit sind Rechte wie jene auf Entwicklung und Frieden hinzugekommen, bei denen unklar ist, von wem und bei wem sie eingefordert werden können.
Alle Staaten werden mit dem Beitritt zur UNO verpflichtet, die Menschenrechte zu achten und sich dafür international einzusetzen. Nicht nur die UNO, sondern auch regionale Organisationen haben Mechanismen entwickelt, um den Respekt der Menschenrechte grenzüberschreitend voranzutreiben.
- Auf weltweiter Ebene ist das häufigste Instrument die periodische Berichterstattung, in der die Vertragsstaaten darzulegen haben, wie sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Die Berichte sind jeweils von den Staaten eingerichteten Ausschuessen zu unterbreiten, die diese überprüfen und Empfehlungen abgeben.
- Da diese Organe stark von Regierungsvertretern beeinflusst werden, führen die Überprüfungsverfahren häufig zu politischen Debatten, die mit den eigentlichen Rechten wenig zu tun haben. Das war jahrelang auch in der Uno-Menschenrechtskommission der Fall, wobei sich daran nach der Gruendung des Menschenrechtsrates, der an ihre Stelle getreten ist, bisher ebenfalls nur wenig geändert hat.
- Um die Diskussionen zu versachlichen, werden manchmal Einzelpersonen als Sonderberichterstatter eingesetzt, die für eine Abklärung der Fakten sorgen sollen. Ihre Ernennung kommt aber nur zustande, wenn es unter den Staatsvertretern zu Einvernehmen kommt.
- Auf der Wiener Konferenz von 1993 konnte man sich darauf einigen, in der UNO ein Menschenrechtskommissariat zu schaffen. In der OSZE, der Nachfolgeorganisation der KSZE, entstand nach dem Kalten Krieg mit dem Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte eine ähnliche Institution. Dahinter lag jeweils die Hoffnung, die Kontrolle von Verpflichtungen unabhängiger zu gestalten. Für die neu geschaffenen Ämter konnten zunächst hochrangige Persönlichkeiten gewonnen werden, von denen sich jedoch mehrere wegen politischer Druckversuche bald wieder zurückgezogen haben.
- Im Unterschied zu anderen Organisationen hat der Europarat für die Überwachung seiner Menschenrechtscharta schon früh eine supranationale Gerichtsbarkeit eingerichtet. Das ursprüglich mehrstufige Verfahren wurde 1998 völlig in den Europäischen Gerichtshof integriert. An diesen können sich auch Einzelpersonen wenden, nachdem sie die nationalen Instanzen durchlaufen haben. Die Umsetzung der Urteile gibt in den Vertragsstaaten nur mehr beschraenkt Anlass zu politischen Diskussionen.
- Die Menschenrechtserklärung der amerikanischen Staaten kennt ein ähnliches System, wie es ursprünglich in der europäischen Menschenrechtserklärung bestanden hat. Danach müssen Individualbeschwerden zunächst an die Kommission gerichtet werden, die allein bemaechtigt ist, Beschwerden an den Gerichtshof weiterzuleiten.
- Die afrikanischen Staaten haben in der Erklärung von Banjul ebenfalls eine Kommission eingesetzt, deren Befugnissse jedoch auf Promotion und Empfehlungen beschränkt blieben. Inzwischen ist auch von ihnen ein Gerichtshof geschaffen worden, dessen Bewährungsprobe noch aussteht.
- In der Erklärung von Kairo der islamischen Staaten sind keine speziellen Mechanismen für die Überwachung vorgesehen worden.
Da einzelne Staaten die bestehenden Überwachungssysteme als ungenügend empfinden, setzten sie sich für die Achtung der Menschenrechte auch in ihrer bilateralen Aussenpolitik ein. Das tun vor allem westliche Demokratien, obwohl sie häufig recht unterschiedlich vorgehen. Selbst Regierungen des gleichen Landes schlagen je nach politischer Farbe andere Töne an. So war der amerikanische Präsident Carter für seinen energischen Einsatz bekannt, während seine republikanischen Nachfolger mit dem Thema viel diskreter umgingen. Solche Diskrepanzen kommen auch in anderen Ländern vor.
- In mehreren Ländern besteht die Praxis, die Ausfuhr von Waffen nach Ländern mit einer prekären Menschenrechtslage zu verbieten. Das ist mehr als gerechtfertigt, sind doch Waffen das häufigste Mittel für die Verletzung von Menschenrechten. Umso bedauerlicher ist es, dass dabei aus wirtschaftlichen Interessen immer wieder ein Auge zugedrückt wird.
- Häufig wird ebenfalls die Entwicklungshilfe mit der Einhaltung der Menschenrechte verknüpft. Dagegen hat die Gruppe der asiatischen Länder an der UNO-Menschenrechtskonferenz von 1993 heftig protestiert. Das war und ist nicht zu rechtfertigen, weil Entwicklungshilfe - obwohl sie eine ethische Verpflichtung der reichen Länder darstellt - durchaus an Bedingungen über die Menschenrechte geknüpft werden darf. In beiden Fällen geht es um Zielsetzungen, die gleichzeitig erfüllt werden können und müssen.
- Da Demokratien meistens marktwirtschaftlich organisiert sind, fällt es ihnen schwer, Handel und Investitionen ihrer Unternehmen menschenrechtlichen Auflagen zu unterstellen. Auch haben sich wirtschaftliche Sanktionen wiederholt als wenig erfolgreich erwiesen. Dennoch können so genannte “smart sanctions”, welche die Bewegungsfreiheit und die Finanztransaktionen von Regierungsverantwortlichen einschränken, wirksam sein. Im Falle Südafrikas haben Investitionsverbote einiger Staaten wesentlich zur Überwindung der Apartheid beigetragen.
- Trotzdem ist mit stiller Diplomatie manchmal mehr als mit viel Lärm zu erreichen. Eine Reihe von Ländern unterhalten Menschenrechtsdialoge, die diskret über diplomatische Kanäle geführt werden. Häufig ist es auf diesem Wege zumindest gelungen, Einzelfälle zu lösen. Über positive Anreize - Ausbildung von Polizisten und Richtern, materielle Beiträge zur Reform des Gefängniswesens und der Justiz - wird versucht, zur Verbesserung der allgemeinen Lage beizutragen. Allerdings stösst auch stille Diplomatie an Grenzen, wenn sie zu lange ohne Ergebnisse bleibt und Gefahr läuft, als Feigenblatt benutzt zu werden.
Staaten, die gereizt auf Anklagen von Menschenrechtsverletzungen reagieren, geben aus der Defensive zu, dass sie das Problem nicht mehr ignorieren können. Wenn das immer mehr der Fall ist, kommen dafür den 2000 nicht-gouvernementalen Menschenrechtsorganisationen (NGOs), die in letzter Zeit entstanden sind, grosse Verdienste zu.
Bei den meisten handelt es sich um kleine Gruppierungen, die sich auf die Situation ihres Landes beschränken. Was solche zu bewirken vermögen, hat sich beim Zusammenbruch der kommunistischen Staaten erwiesen. Andere Organisationen - wie Amnesty International oder Human Rights Watch - sind von bescheidenen Anfängen zu weltweit operierenden Akteuren geworden. Ihre Finanzierung erfolgt hauptsächlich über freiwillige Beiträge, die Unterstützung von Regierungen wird häufig abgelehnt, um die Unabhängigkeit zu bewahren.
Das erste Ziel dieser Nicht-Regierungsorganisationen ist, über Basiskontakte an verlässliche Informationen heran zu kommen. Je nach den Ergebnissen treten sie an die Öffentlichkeit, um Regierungen und internationale Organisationen unter Druck zu setzten. Entscheidend hängt ihre Wirkung von dem Echo ab, das sie in den Medien finden. Obwohl auch ihnen Fehler unterlaufen, haben sie sich wiederholt als effizientes Frühwarnsystem erwiesen
Viele NGOs begnügen sich jedoch nicht nur mit Kampagnen in den Medien. Sie leisten darüber hinaus konkrete Beiträge, um Leute über ihre Rechte aufzuklären und ihnen bei Gerichtsverfahren zur Seite zu stehen. Sie nehmen sich ebenfalls dem Schutz von Zeugen an und leisten finanzielle Hilfe an Opfer, um ihnen die Wiedereingliederung in ein normales Leben zu erleichtern.
Kofi Annan hatte als UNO-Generalsekretär frühzeitig die neue Kraft der internationalen Zivilgesellschaft erkannt und stets die Arbeit der Menschenrechts - NGOs unterstützt. Am Weltwirtschaftsgipfel von 1999 in Davos suchte er ausserdem, die transnationalen Unternehmen für seine Zielsetzung zu gewinnen. Er schlug ihnen einen globalen Pakt (“global compact”) vor, in dem sich diese freiwillig verpflichten sollten, in ihren Niederlassungen überall auf der Welt international vereinbarter Normen über Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz einzuhalten.
Viele Gralshüter der Menschenrechte reagierten darauf skeptisch. Warum mächtige Unternehmen auffordern, freiwillig Menschenrechte zu achten, die für alle verbindlich sind? Der Einwand war berechtigt, doch ging Kofi Annan von der nüchternen Annahme aus, dass das zwar so sein sollte, aber nicht so ist. Über einen medienwirksamen Mechanismus wollte er unter den transnationalen Unternehmen das Streben nach dem Klassenbesten fördern. Er war überzeugt, dass solche Unternehmen in Ländern, wo Menschenrechte missachtet werden, mit ihrem Beispiel grossen Einfluss ausüben können.
Der Versuch scheint sich gelohnt zu haben, ist doch der “global compact” umgehend von 50 grossen Unternehmen unterzeichnet worden. Inzwischen sind ihm über 4 000 transnationale Unternehmen beigetreten. Die Unterzeichner verpflichten sich, jährlich - also häufiger als Vertragsstaaten von den meisten Abkommen - der UNO in New York über die Einhaltung ihres Versprechens Bericht zu erstatten.
Die Befürchtung, dass dieser Mechanismus von den Unternehmen bloss zur “Image-Pflege” benützt wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Man kann aber davon ausgehen, dass NGOs, die Berichte staatlicher Behörden zu widerlegen vermögen, noch leichter im Stande sein dürften, beschönigenden Informationen transnationaler Unternehmen auf die Spur zu kommen.
Beunruhigend ist weiterhin die Tatsache, dass die universale Gültigkeit der Menschenrechte nach wie vor von einigen Regierungen in Frage gestellt wird. Die westlichen Demokratien, die bei der Gründung der UNO die Mehrheit bildeten, waren überzeugt, bürgerliche und politische Grundrechte müssten überall verbreitet werden. Dem setzten sich zunächst die kommunistischen Staaten entgegen, weil für sie die eigentlichen Menschenrechte erst im sozialistischen Arbeiterparadies zu erreichen waren. Inzwischen gibt es Staaten, die zwar über die Marktwirtschaft erfolgreich geworden sind, die jedoch darauf beharren, Menschenrechte könnten nur im Rahmen ihrer eigenen Traditionen verwirklicht werden.
Wie sehr auch kulturelle Vielfalt zu schätzen ist, muss man sich dennoch fragen, wo es auf der Welt Menschen gibt, die es sich nicht wünschen würden, ihr Leben zu wahren und von Folter verschont zu bleiben. Wer ungerechterweise in Gefängnissen schmachtet, wird sich kaum mit der “Kultur” seines Landes trösten lassen. Vielmehr dürfte er mit jenen “Utopisten” einig gehen, für die Staaten, die ihren Bürgern grundlegende Menschenrechte verweigern, nicht mehr als souverän betrachtet werden sollten.
Darüber wäre rasch ein weltweiter Konsens zu finden, wenn er in Freiheit zugelassen würde. Zwar darf nicht alles über den Leisten westlicher Vorstellungen geschlagen werden, doch gibt es elementare Rechte, nach denen sich jeder Mensch sehnt.
Wie die Erfahrung lehrt, ist eine unabhaengige Gerichtsbarkeit das beste Mittel, um den Schutz der Menschenrechte transnational zu gewaehrleisten. Dogmatischer Perfektionismus fuehrt aber haeufig nicht zum erwuenschten Ziel. Deshalb ist die Spekulation erlaubt, ob in einem ersten Schritt nicht auf eine weltweite Gerichtsbarkeit hinzuarbeiten waere, wie sie im Europarat besteht, ohne dass sich diese von Anfang an auf alle vereinbarten Rechte erstrecken müsste. Das mag illusorisch klingen, doch ist auch das westliche Menschenrechtssystem nicht über Nacht entstanden. Vielmehr lehrt seine Entstehungsgeschichte, dass ein progressiver Ansatz durchaus zu einer fortschrittlichen Dynamik führen kann.
Ein Schimmer der Hoffnung ist diesbezueglich, dass sich neulich Staaten aus allen Regionen der Welt darauf einigen konnten, schwere Kriegsverbrechen einer internationalen Gerichtsbarkeit zu unterstellen. Waren die Kriegsverbrechertribunale für Jugoslawien und Ruanda vom UNO-Sicherheitsrat eingesetzt worden, sind seither mehr als 100 Staaten dem Statut über den internationalen Strafgerichtshof beigetreten, das 1998 an einer Staatenkonferenz in Rom ausgearbeitet worden war.
Der neu geschaffene Strafgerichtshof kann gegen Individuen vorgehen, die sich als Regierungsmitglieder oder einfache Bürger an Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen beteiligt haben. Die Zuständigkeit des Gerichtshofes ist subsidiär, weil sie erst eintritt, wenn es ein Mitgliedstaat verfehlt, eigene Bürger oder andere Verbrecher, die auf seinem Territorium gewirkt haben, zur Verantwortung zu ziehen.
Zwar sind dem Römer Statut wichtige Länder wie die USA, Russland und China noch nicht beigetreten. Auch ist die Anklagebehörde des Gerichtshofes bisher nur in wenigen Fällen aktiv geworden. Bemerkenswert ist jedoch, dass das Römer Statut nicht nur von westlichen, sondern auch von zahlreichen Ländern der Dritten Welt ratifiziert worden ist. Damit wächst die Einsicht, dass zumindest schwere Verletzungen von Menschenrechten international geahndet werden müssen.
Schon das blosse Bestehen des Gerichtshofes wird abschreckende Wirkung haben. Die Perspektive, in einem Gefängnis in Den Haag zu enden, wird manchen Politikern zu denken geben. Deswegen ist auch die Hoffnung erlaubt, dass sich die schwierige Frage humanitärer Interventionen in Zukunft weniger häufig stellen sollte.
Erheblich komplizierter ist die Frage, wie wirtschaftliche und soziale Rechte international umgesetzt werden koennen. Dass solche von ärmeren Ländern gefordert werden, ist keine Überraschung. Anderseits sind sie bisher am effektivsten von Industriestaaten verwirklicht worden, die sich bewusst waren, dass es mehr um Vorgaben für staatliche Sozialpolitik als um einklagbare Individualrechte ging.
Wer möchte bestreiten, dass jedem Menschen ein Recht auf Nahrung und Beschäftigung zukommen sollte. Moderne Wohlfahrtsstaaten bemühen sich, mit finanziellen Zuwendungen minimale Standards zu gewährleisten. Dagegen ist es noch keinem Wirtschaftssystem gelungen, ein nachhaltiges Recht auf Arbeit zu verwirklichen.
Wenn internationale Dokumente solche Rechte proklamieren, ist höchst unklar, wie und bei wem sie eingefordert werden können. Das heisst nicht, dass auf zwischenstaatlicher Ebene nichts gemacht werden sollte. Wie sehr man auch von den grundlegenden Freiheitsrechten überzeugt sein mag, liegt auf der Hand, dass Meinungsfreiheit kaum mehr Sinn macht, wenn jemand vom Hungerstode bedroht ist.
Dass zwischen klassischen Freiheitsrechten und wirtschaftlichen und sozialen Rechten ein Zusammenhang besteht, ist offensichtlich. Letztere über eine internationale Gerichtsbarkeit verwirklichen zu wollen, liegt aber noch in weiter Ferne. Zuvor wäre eine viel grössere Verständigung notwendig, wie weltweit mehr soziale Gerechtigkeit erreicht werden kann.
Das ist ein ebenso wichtiges Postulat wie die Achtung der traditionellen Menschenrechte, denn abgesehen von ethischen Überlegungen sprechen dafür auch politische und wirtschaftliche Gründe. Auf diesem Wege ist aber nur voran zu kommen, wenn sich Staaten noch viel mehr als bisher bereit erklären, Konzessionen an ihre Souveränität zu machen und diese immer mehr miteinander zu teilen.
4. Soziale Gerechtigkeit
4.1. Arme und Reiche
Bald nach dem zweiten Weltkrieg setzte in den industriellen Demokratien ein starkes Wachstum ein. Die OECD-Staaten konnten zwischen 1945 und 1973 eine jährliche Zunahme von 4,9% ihres BIP verzeichnen. Davon profitierten in diesen Laendern auch ärmeren Schichten, obwohl nach wie vor grosse Einkommensunterschiede zu verzeichnen waren.
Für die Staaten der südlichen Hemisphäre, von denen die meisten erst damals unabhängig wurden, fiel das Wachstum deutlich geringer aus. Weil ihr Geburtenüberschuss viel höher war, wurde der Graben zwischen armen und reichen Ländern immer grösser.
Nach den Erdölkrisen der 70er und 80er Jahre verflachte sich der Boom der Nachkriegsjahre. In den Industriestaaten ging das Wachstum um die Hälfte zurück, während Entwicklungsländer, die über kein Erdöl verfügten, noch stärker betroffen wurden. Sie hatten nicht nur höhere Erdölrechnungen zu begleichen, sondern mussten wegen ihrer Verschuldung auch viel mehr Mittel für den Schuldendienst aufbringen. Die meisten von ihnen gerieten in eine Phase der Stagnation, weshalb sich die Reichtumsunterschiede weiter verschärften.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erst nach der Jahrtausendwende begannen die Entwicklungsländer rascher als die Industriestaaten zu wachsen. Zwischen 2000 und 2010 stieg das BIP der ärmsten Länder um jährlich 6%, die Länder mittleren Einkommens wuchsen um 5%, während die alten Industriestaaten bloss um 2% expandierten. Zurückzuführen war das hauptsächlich auf folgende Faktoren:
- nach den kleinen asiatischen Tigern (Singapur, Südkorea, Hongkong und Taiwan) setzte in China und Indien - den zwei bevölkerungsdichtesten Ländern der Welt - ein starkes Wachstum ein;
- weil sich die alten Industrieländer von der Börsenblase der neuen Technologien relative rasch erholten, ergab sich auf den internationalen Kapitalmärkten eine grössere Flüssigkeit, die eine spürbare Senkung der Zinssätze zur Folge hatte;
- unter dem Einfluss guenstigen Kapitals und der raschen Entwicklung in China und Indien verstärkte sich die Nachfrage nach Rohstoffen, was zu Preissteigerungen und höheren Exporterträgen in vielen Entwicklungsländern führte.
Seit der Finanz-und Wirtschaftskrise, die 2008 im Norden ausbrach, liegt das Wachstum verschiedener Laendern des Suedens deutlich hoeher als in den meisten alten Industrienationen. China, Indien und Brasilien sind sogar zu Hoffnungstraegern geworden, um konjunkturelle Schwierigkleiten der Weltwirtschaft abzufedern. Selbst auf dem „verlorenen“ Kontinent Afrikas sind mancherorts erstaunliche Wachstumszahlen zu verzeichnen. Dennoch ist der Reichstumsunterschied zwischen den 20% Reichsten und den 20% Aermsten der Welt kaum zurueckgegangen.
Denn einige positive Veränderungen in der Dritten Welt, die sich hoffentlich als nachhaltig erweisen werden, vermoegen nicht über die Tatsache hinwegzutaeuschen, dass der Abstand zwischen Armen und Reichen von skandalösem Ausmass bleibt.
- Eine Milliarde Menschen leiden an Hunger, weil sie weniger als über 1,25 USD pro Tag verfügen.
- Drei Milliarden Menschen - fast die Hälfte der Weltbevölkerung - müssen mit 2,5 USD pro Tag auskommen, was nichts anderes als eine klägliche Lebengrundlage bedeutet.
- Mehr als eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu gesundem Wasser.
- Ueber eine Milliarde Menschen sind Analphabeten.
- Täglich sterben 30 000 Kinder an Unterernährung.
- 70 Millionen Kinder können keine Schule besuchen.
Mit einem Prozent der globalen Militärausgaben wäre allen Kindern der Welt eine Grundausbildung zu ermoeglichen. Dieser Betrag entspricht etwa der Hälfte von dem, was in reichen Ländern jährlich für das Futter von Haustieren aufgewendet wird. Die 41 ärmsten Länder der Welt erwirtschaften ein Bruttosozialeproukt, das geringer als das Vermögen der 7 reichsten Leute der Welt ist.
Über die Aussagekraft einiger dieser Zahlen kann man sich streiten. In den letzten Jahren sind jedoch verstaerkte Anstrengungen unternommen worden, um die realen Reichtumsunterschiede zwischen armen und reichen Ländern genauer zu erfassen:
- Hatte man lange auf das durchschnittliche Pro-Kopf Einkommen eines Landes abgestellt, das zu laufenden Wechselkursen in Dollar umgewandelt wurde, ist man zu Berechnungen mit Kaufkraft bereinigten Dollars (PPP = purchasing power parity) übergegangen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht handelbare Güter - namentlich Dienstleistungen - in ärmeren Ländern billiger sind;
- Seit 1990 erarbeitet das UNO - Entwicklungsprogramm (UNDP) jährlich den “Human Development Index” (HDI), der neben dem Kaufkraft bereinigten Pro-Kopf Einkommen soziale Indikatoren wie die Lebenserwartung und den erreichten Ausbildungsgrad der Bevölkerung berücksichtigt.
- Da beide Methoden nur Durchschnittswerte pro Land errechnen, hinter denen sich grosse Unterschiede verbergen, ermittelt die Weltbank Werte absoluter Armut, die zur Zeit auf 1,25 USD. pro Tag festgelegt sind und mit Umfragen über Einkommen und Konsum berechnet werden.
Zweifelsohne kommen diese neuen Methoden der Realität näher, doch wird damit der Graben zwischen Ärmsten und Reichsten nicht verringert:
- 2010 betrug das Kaufkraft bereinigte Pro-Kopf Einkommen des reichsten Staates der Welt - Luxemburg - 89 769 USD, jenes des ärmsten Landes - Demokratische Republik Kongo - 345 USD;
- Norwegen erreichte 2010 beim “ Human Development Index” einen Wert von 0,943, während jener der Demokratischen Republik Kongo bloss 0,286 betrug.
Glauben viele Experten, dass sich starke Reichtumsunterschiede auf das Wachstum negativ auswirken, bieten die ärmeren Länder in dieser Hinsicht ebenfalls kein vorteilhaftes Bild. Der Gini - Koeffizient, der solche Unterschiede misst - ein Wert von Null bedeutet absolute gleiche Verteilung, einer von 100 absolut ungleiche Verteilung - , ist in ärmeren Ländern deutlich höher als in reicheren:
- in Schweden lag er 2010 bei 23,0
- in Namibia war er mit 70,7 drei Mal hoeher.
Allerdings haben sich seit der Globalisierung die Reichtumsunterschiede auch innerhalb der Industrieländer verschärft. In diesen Ländern ist der Gini - Koeffizient in den letzten Jahren um mehr als zwei Punkte gestiegen. Übertriebene Gehälter von Spitzenverdienern waren dafür ein ausschlaggebender Grund. Der Unterschied zwischen dem durchschnittlichem Lohn eines Mitarbeiters und jenem des obersten Chefs betrug in Grossunternehmen 1987 noch 1:30, kurz vor Ausbruch der Finanzkrise war er auf 1:520 gestiegen.
Derartige Unterschiede sind kaum mit Produktivität, sondern eher mit korporativ organisierter Gier zu erklären. Wurden solche Missstände früher rückständigen Grossgrundbesitzern in Entwicklungsländern angelastet, hat sich inzwischen herausgestellt, dass dagegen auch gut ausgebildete Manager nicht gefeit sind.
4.2. Theorien und Strategien
Den reicheren Ländern ist nicht vorzuwerfen, dass sie die Armut der zurückgeblieben Länder völlig ignoriert hätten. Nachdem sich die westeuropäischen Länder dank des Marshall-Plans rasch erholen konnten, kam man auf beiden Seiten des Atlantiks bald zur Einsicht, dass nun auch den ärmeren Ländern des Südens geholfen werden müsse.
Dafür wurden nicht nur Mittel gesprochen, sondern auch Bemühungen unterstützt, um die Hilfe effizient zu gestalten. War nach dem Ersten Weltkrieges eine eigene Forschung über die Verhinderung des Krieges entstanden, kam nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklungsökonomie hinzu, die helfen sollte, den Rückstand ärmerer Länder möglichst rasch zu überwinden.
Forscher auf westlichen Universitäten kamen zunächst zur Überzeugung, dass:
- die Industrialisierung der einzige Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen,
- dafür den unterwickelten Ländern Kapital zugeführt werden muss,
- dieses jedoch nur Wirksamkeit entfalten kann, wenn, auch technische Hilfe geleistet wird.
Diese Theorien prägten die ersten Hilfsprogramme westlicher Regierungen. Schon bald wurde man sich aber bewusst, dass es nicht genügt, die Methode des Marshall-Plans linear auf die Länder des Südens zu übertragen. Deren strukturelle Bedingungen waren zu verschieden, denn sie verfügten über keine industrielle Erfahrung und standen einer hohen Masse landwirtschaftlicher Arbeitskräfte mit äusserst tiefer Produktivität gegenüber.
Zwar hielten Entwicklungsökonomen, die sich dessen bewusst geworden waren, am Ziel der Industrialisierung fest. Zur Überwindung der Strukturschwächen in den zurückgebliebenen Ländern plädierten sie dafür, überschüssige Arbeitskräfte besser auszubilden, damit sie der Industrie zugeführt werden können. Gleichzeitig verlangten sie, die Produktivität der Landwirtschaft zu steigern, um die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicher zu stellen. Viele westliche Staaten haben auch diesen Forderungen in ihrer Entwicklungshilfe Rechnung getragen.
Kommunistische Staaten, die mit geringeren Mitteln in die Entwicklungshilfe eingestiegen waren, suchten das Modell der zentral gelenkten Planungswirtschaft voran zu treiben, bei dem die Schwerindustrie im Vordergrund stand.
Als keiner der Ansätze zu raschen Erfolgen führte, entwickelten Ökonomen in Lateinamerika die Dependenz-Theorie, die davon ausging, dass sich Entwicklungsländer nicht aus ihrem Rückstand befreien können:
- solange sie bloss Rohstoffe und Agrarprodukte exportieren,
- denn das relative Preisverhältnis (“terms of trade”) dieser Produkte verschlechtere sich staendig, da die Nachfrage nach Rohstoffen und Nahrungsmitteln weniger rasch als jene nach Industrieprodukten steige,
- jeglicher Versuch, dem Nachteil mit erhöhter Produktion zu begegnen, die Situation bloss verschlimmern wuerde.
Ihre Empfehlung an die Entwicklungsländer lautete, sich vorläufig von der Weltwirtschaft abzukoppeln. Anstatt Industrieprodukte zu importieren, sollten sie mit Zollschranken und staatlicher Unterstützung dafür sorgen, dass solche Produkte von ihnen selber hergestellt werden können.
Als auch damit nicht der erhoffte Fortschritt eintrat, begannen Politiker der Entwicklungsländer nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung zu rufen. Auslöser dafür war der Erfolg der Erdöl exportierenden Länder, die mit dem Boykott von 1973 ihre Exporteinnahmen stark zu steigern vermochten.
Von den Eliten vieler Entwicklungsländer wurde daraus der Schluss gezogen, nun sei die Stunde gekommen, das Funktionieren der internationalen Märkte durch politische Eingriffe zu korrigieren. 1974 vermochten die Entwicklungsländer in der UNO-Generalversammlung, wo sie über die numerische Mehrheit verfügten, eine Erklärung sowie ein Aktionsprogramm und eine Charta über die wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten durchzusetzen, mit denen eine neue Weltwirtschaftsordnung errichtet werden sollte.
Zwei Prinzipien bildeten den Kern dieser Dokumente:
- alle Staaten verfügen über eine uneingeschränkte Souveränität ihrer natürlichen Ressourcen und duerfen folglich diese nach ihrem Gutdünken nationalisieren.
- Staaten, die Rohstoffe und Nahrungsmittel produzieren, sind berechtigt, sich in Kartellen zusammenzuschliessen, ohne dass diese Bestrebungen von anderen Staaten behindert werden dürfen.
Da die reichen Länder noch mit zahlreichen anderen Forderungen konfrontiert wurden, reagierten sie mit passivem Widerstand. Das fiel ihnen umso leichter, als die Entwicklungsländer ihre grösste Hoffnung auf die Errichtung eines integrierten Rohstoffprogramms setzten, mit dem:
- für 18 Produkte internationale Ausgleichslager (“buffer stocks”) geschaffen werden sollten, die auf den internationalen Märkten über den Ankauf oder den Verkauf die Preise zu stabilisieren hätten.
- für die übrigen Rohstoffe die internationale Finanzierung von Forschungsprogrammen verlangt wurde, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.
Weil auch diese Erwartungen wenig fruchteten, kam es nach zehn Jahren erneut zu einem Kurswechsel. Als zahlreiche Entwicklungsländer in Zahlungsschwierigkeiten geraten waren, ging der Norden in die Offensive, indem er unter der Führung konservativer Kräfte predigte, dass es weder eine Korrektur der Weltwirtschaft noch eine Entwicklungsökonomie brauche. Vielmehr sollten die Entwicklungsländer im eigenen Interesse zu den alt bewährten Prinzipien der freien Marktwirtschaft zurückkehren.
Damit begann der neoliberale Konsens von Washington, der von den Entwicklungsländern verlangte, dass sie zur Restrukturierung ihrer Schulden nur neue Kredite erhalten würden, sofern sie sich bereit erklärten:
- eine restriktive Geldpolitik zu betreiben;
- ihre Haushaltsdefizite in Ordnung zu bringen;
- die Privatisierung unproduktiver Staatsbetriebe einzuleiten;
- sowohl den Aussenhandel als auch den Kapitalverkehr zu liberalisieren.
In ihrer finanziellen Not blieb den meisten Entwicklungsländern nichts anderes übrig, als das Rezept zu übernehmen. Bald stellte sich aber heraus, dass auch dieses zu spärlichen Ergebnissen führte. Denn die Konsequenz war, dass die meisten Entwicklungsländer für zwei Jahrzehnte in eine Stagnation verfielen, die den Graben zu den reichen Ländern des Nordens weiter verschärfte.
Immerhin bewirkte die Rosskur, dass sich das makroökonomische Umfeld vieler Entwicklungsländern verbesserte, so dass sie sich heute in einer besseren Ausgangslage befinden.
Zu einem Konsens zwischen Nord und Süd kam es zum ersten Mal im Jahre 2000, als man sich an der UNO-Generalversammlung in New York auf die so genannten Millenniumsziele einigte, mit denen bis zum Jahre 2015 durch gemeinsame Anstrengungen erreicht werden sollte, dass:
- der Anteil der Menschen, die an Hunger leiden und weniger als über 1,25 USD verfügen, bis zu diesem Zeitpunkt halbiert wird;
- alle Kinder die Möglichkeit erhalten, eine Grundschule zu absolvieren;
- auf allen Bildungsstufen zwischen Knaben und Mädchen keine Diskriminierung mehr besteht;
- sich die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um zwei Drittel verringert;
- die Sterblichkeitsrate von Müttern um drei Viertel gesenkt wird;
- für Krankheiten wie Aids und Malaria die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr weiter zunimmt, sondern abzunehmen beginnt;
- der Anteil der Menschen, die über kein sauberes Trinkwasser verfügen, halbiert wird;
- die Entwicklungshilfe und der Schuldenerlass an ärmere Länder erhöht werden und ein nicht diskriminierendes internationales Handels- und Finanzsystem aufgebaut wird.
Mit Ausnahme des letzten, eher diffus gefassten Zieles ging es nicht mehr um blumige Rhetorik, sondern um konkrete Absichten, die schlimmste Armut zu verringern. Hatte man zu Beginn der Entwicklungszusammenarbeit noch gehofft, über die Zufuhr von Kapital den Graben zwischen Reichen und Armen rasch schliessen zu können, stellte man sich nun auf den viel bescheideneren Ansatz ein, für Millionen von Menschen minimale Überlebensbedingungen zu schaffen.
4.3. Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung
Zu von der Inflation bereinigten Werten haben die reicheren Länder seit 1950 über 2 500 Mia. USD für Entwicklungshilfe geleistet. Die amerikanische Wiederaufbauhilfe an Europa - der immer wieder zitierte Marshall-Plan - betrug dagegen bloss 100 Mia. USD. Der eklatante Unterschied hat in den letzten Jahren vermehrt Kritik an der Wirksamkeit der Hilfe fuer die Länder des Südens hervorgerufen.
Auftrieb erhielt die Kritik, als einige asiatische Staaten, die relativ wenig Hilfe erhalten hatten, zu raschem Wachstum gelangten. Das war zunächst für Singapur, Südkorea, Hongkong und Taiwan der Fall, die mit einfachen Industriegütern auf die Weltmärkte vorzustossen vermochten. In die gleiche Richtung entwickelte sich später China, das grösste Land der Welt, das seit der kommunistischen Machtübernahme kaum Unterstützung aus dem westlichen Ausland erhalten hatte.
Diese Erfolge bestärkten neoliberale Kräfte in ihrer Überzeugung, dass es nicht Hilfe, sondern Handel brauche, um zurückgebliebene Länder auf den Pfad des Wachstums zu bringen.
Das hat einiges an sich, doch ist kaum zu behaupten, dass China nur dank neoliberaler Rezepte zu Wachstum gekommen ist:
- China entwickelte sich, ohne sich zu demokratisieren;
- seine kommunistische Regierung war zwar makroökonomischer Stabilität verpflichtet, öffnete sich aber nur bedächtig dem internationalen Handel und den ausländischen Investitionen;
- anstatt die Märkte sofort zu liberalisieren, wurde die Planwirtschaft nur schrittweise abgebaut.
Für Indien, das ebenfalls zu einem Wirtschaftswunder geworden ist, haben liberale Ansätze schon eher eine Rolle gespielt. Das seit seiner Unabhängigkeit demokratisch regierte Land hatte sich zunächst einem idealistischen Sozialismus verschrieben, der über drei Jahrzehnte nur mässige Resultate hervorbrachte. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entschloss es sich zu Öffnung seiner Märkte, worauf sich sein Wachstum verdoppelte. Allerdings konnte es den Rhythmus dieser Öffnung selber bestimmen, weil es weniger als andere von den Konditionalitäten der internationalen Finanzinstitutionen abhängig geblieben war.
Aus den Erfolgen dieser Länder ist schwerlich zu schliessen, dass die neoliberale Kritik an der Entwicklungshilfe gerechtfertigt ist. Sicher hätte man sich mehr Wirksamkeit erhofft, doch für Unzulänglichkeiten kommt ein Teil der Verantwortung auch den Geberländern zu. Nicht alles, was als Entwicklungshilfe ausgewiesen wurde, ist wirklich zu diesem Zweck verwendet worden:
- während des Kalten Krieges dienten viele Gelder der Entwicklungshilfe vor allem dazu, den politischen Einflussbereich der Geberländer zu erhalten, was dazu führte, dass korrupte und diktatorische Regime unterstützt wurden;
- die Tendenz ist zwar nach dem Ende des Kalten Krieges etwas zurückgegangen, hat sich aber seit dem Krieg gegen den Terrorismus wieder verstärkt;
- noch heute wird Entwicklungshilfe häufig dafür verwendet, um sich Stimmen unterentwickelter Länder in internationalen Organisationen zu kaufen;
- wenn auch der Anteil der gebundenen Hilfe deutlich abgenommen hat, wird Entwicklungshilfe nach wie vor dafür eingesetzt, um wirtschaftliche Interessen der reicheren Länder voran zu treiben.
Unter Kritikern der Entwicklungshilfe gibt es einige extreme Stimmen, die behaupten, es sei kein Grund zur Aufregung, wenn eine Milliarde Menschen weiterhin an Hunger leiden. Hilfsgelder wuerden naemlich nur dazu beitragen, eine unhaltbare Bevölkerungsexplosion zu perpetuieren.
Dass diese Haltung nicht grosse Unterstützung findet, bestätigen die zahlreichen Spendeaktionen von Privatpersonen, wenn bei Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen unerträgliche Bilder menschlicher Not über die Fernsehschirme gehen.
Häufig geraten dabei Situationen in Vergessenheit, die von den Medien nicht mehr thematisiert werden. Dennoch gibt es nur wenig Widerspruch, dass der Hunger ein Skandal ist, den es auszurotten gilt, zumal dafür auf der Welt genügend Nahrungsmittel vorhanden wären.
Der australische Philosoph Peter Singer, der nicht als Frömmler bekannt ist, hat zu dem Thema 1972 einen berühmt gewordenen Artikel veröffentlicht.[12] Anlass dafür war der Ausbruch einer Hungersnot in Bangladesh, auf die reichere Länder nur zögernd reagierten, obwohl von ihnen gleichzeitig viel Geld für Luxusobjekte ausgegeben wurde.
Der liberale Utilitarist vertrat die Ansicht, menschliches Leiden, das wegen Hunger und fehlender Betreuung zum Tode führe, dürfe nicht hingenommen werden. Staaten und Individuen seien verpflichtet:
- sich für die Rettung von Menschenleben einzusetzen, wenn sie das tun können, ohne einen moralisch gleichwertigen Schaden zu erleiden;
- oder – besser noch - so weit zu gehen, bis ihre Hilfe das eigene Wohlergehen merklich beeinträchtigt.
Singer erläuterte seine Überzeugung mit dem Beispiel eines ertrinkenden Kindes, das zu retten ist, auch wenn man sich dabei seine Kleider verschmutzt. Weil er selber von der härteren seiner beiden Varianten ausging, kam er zum Schluss, zur Überwindung des Hungers habe jeder soviel beizutragen, bis zusätzliche Leistungen seinen Wohlstand betraechtlich verringern wuerden.
Der provokative Philosoph ging damit über das Beispiel des guten Samariters hinaus und stellte sich auf den Standpunkt, dass in der Welt alle den gleichen Anspruch auf das Lebensnotwenige haben, unabhängig davon, wie und von wem Reichtum produziert wird.
Etwas weniger radikal setzte sich Onora O Neill mit dem Hunger auseinander.[13] Sie ging von Kants Imperativ aus, blieb damit aber hinter den extremen Forderungen ihres liberalen Kollegen Peter Singer zurück.
Kant verlangte bekanntlich, menschliches Verhalten so zu gestalten, dass es zu einem universal gültigen Gesetz werden kann. Daraus ergibt sich für Onora O Neil, jeder habe zur Linderung des Hungers mindestens so viel beizutragen, dass auch der Hungernde zu einem moralisch befähigten Leben kommen kann. Der Unterschied mag marginal erscheinen, doch betonte O Neill mehr die Pflichten der Geber als die Rechte der Empfänger.
Wie Singer war O Neill eine überzeugte Kosmopolitin, liess aber mehr Verantwortung für Individuen und für die auf Souveränität bedachten Staaten übrig. Dass Regierende Hilfsleistungen von aussen verweigern, nur weil sie befürchten, sie koennten ihre Macht verlieren, wies sie jedoch entschieden zurück.
Der praktischen Politik ist anzuerkennen, dass sie sich in den Millenniumszielen darauf geeinigt hat, die Bekämpfung des Hungers zur ersten Priorität der Entwicklungshilfe zu machen. Allerdings ist das Ziel bescheiden geblieben, denn bis zum Jahre 2015 soll der Anteil der Hungernden bloss um die Hälfte reduziert werden.
Wer das Glas lieber halbvoll als halbleer sieht, muss darin doch einen Fortschritt sehen.
So ist hervorzuheben, dass man den Schwächsten unter den Armen - Frauen und Kindern - spezielle Aufmerksamkeit schenkte. Zwar waren deren Rechte bereits in der Menschenrechtserklärung der UNO von 1948 proklamiert worden, doch bestand damals noch grosse Skepsis, dass diesbezüglich eine internationale Verantwortung besteht.
Positiv ist auch, dass die Millenniumsziele sowohl die reichen wie die armen Länder zu gemeinsamen Anstrengungen verpflichteten:
- die Geberländer versprachen, mindestens 20% ihrer Entwicklungshilfe für den Kampf gegen den Hunger zu verwenden,
- die armen Länder stellten in Aussicht, wenigstens 20% ihrer nationalen Budgets für das gleiche Ziel zu reservieren.
Von Experten ist der Mittelbedarf zur Erreichung der Millenniumsziele wie folgt geschätzt worden:
- die Entwicklungsländer müssten ihr Steueraufkommen um 4% des eigenen Wirtschaftsproduktes erhöhen, was einen Betrag von 400 Mia. USD. ausmachen würde,
- die Industrieländer hätten 0,54% ihres BIP für die Millenniumsziele einzusetzen, was einer Summe von 200 Mia. US entsprechen würde. Um andere Projekte der Entwicklungshilfe weiterzuführen, wäre diese auf mindestens 0,7 % ihres BIP zu erhöhen.
Die Millenniumsdeklaration hat die finanziellen Aspekte nicht im Detail geregelt. Nur vage wurde festgehalten, die Industrieländer sollten ihre Entwicklungshilfe erhöhen und eine grosszügige Entschuldung einleiten.
Auf das Finanzproblem kam die Folgekonferenz der UNO von 2002 in Monterrey zurück. Die Entwicklungsländer wiederholten, dass sich die reichen Länder verbindlich auf eine Hilfe von 0,7% ihres BIP verpflichten sollten. Sie blieben damit hinter der Forderung des Brandt-Berichtes zurück, der schon 1980 postuliert hatte, die Entwicklungshilfe der reichen Länder bis zum Jahre 2000 progressiv auf 1% ihres BIP zu erhoehen.
Obwohl das Ziel des Brandt- Berichtes bereits von einigen - vor allem nordischen - Staaten erfüllt wird, war es in Monterrey nicht möglich, sich auf das Niveau von 0,7% zu einigen, weil das nicht nur von den USA, sondern auch von anderen Industriestaaten abgelehnt wurde.
Inzwischen haben sich die EU-Staaten autonom verpflichtet, bis 2015 ihre Entwicklungsbudgets auf 0,7% zu steigern. Kanada und Japan bekannten sich zum gleichen Ziel, ohne für dessen Verwirklichung einen konkreten Zeitrahmen festzulegen.
Nach wie vor scheint es so zu sein, dass die meisten Geberländer ihre Hilfe mehr als einen Akt der Wohltätigkeit (“caritas”) als eine Verpflichtung betrachten. Im besten Falle akzeptieren sie, dass es sich um eine unvollkommene Pflicht handelt, was in der ethischen Tradition bedeutet, dass die Pflicht als solche nicht ignoriert werden darf, über deren Ausmass aber jeder selber entscheiden kann.
4.4. Vorschläge für alternative Finanzierungsmechanismen
Deshalb ist es schon seit einiger Zeit zu Ideen gekommen, die Entwicklungshilfe von staatlichen Budgetentscheidungen unabhängiger zu machen und sie durch andere Finanzierungsmechanismen zu ergänzen.
Einer der ersten, der in diese Richtung ging, war Papst Paul VI., der 1964 auf seiner Reise nach Indien die Staatslenker aufrief, einen Teil ihrer Rüstungsausgaben in einen Weltfonds einzubezahlen, um die Hilfe an die Not leidenden Völker zu verstärken.
In der Enzyklika “Populorum progressio” kam er drei Jahre spaeter auf den Vorschlag zurück und unterstrich, multilaterale Hilfe sei der bilateralen vorzuziehen:
- weil diese erlauben würde, “unfruchtbare Rivalitäten” unter den Geberländern zu überwinden,
- die Empfänger weniger zu befürchten hätten, dass mit finanzieller und technischer Hilfe Druck ausgeübt wird, um “Vormachtstellungen” zu akzeptieren.
Paul VI. spezifizierte nicht, wie gross der Beitrag an den von ihm gewünschten Weltfonds sein sollte, auch ist sein Vorschlag - sieht man von einigen Pazifisten ab - auf wenig Echo gestossen.
Bedenkt man aber, wie viel unnötiges Leid von Waffen verursacht wird, ist doch in Betracht zu ziehen, dass:
- die heutigen Rüstungsausgaben aller Staaten über 1 000 Mia. USD. pro Jahr betragen, so dass mit einer Abgabe von ein Prozent 10 Mia. USD. zusammenkommen würden;
- der internationale Waffenhandel jährlich 60 Mia. US Dollar ausmacht, weshalb - hätten sowohl Lieferanten wie Käufer auf jede Transaktion 10% abzugeben - sich 12 Mia. USD ergeben würden.
Zu 80% wird der internationale Waffenhandel von den fünf ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates getaetigt. Ihre Gewinne aus diesem Geschäft machen mehr aus, als sie für die Entwicklungshilfe aufbringen.
Unter den besten Kunden für Waffen befinden sich Entwicklungsländer, die gute Gründe hätten, andere Prioritäten zu setzen.
Ein weiterer Vorschlag wurde wenig später vom amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler James Tobin gemacht. Als der US-Dollar abgewertet wurde und Währungen häufig unter spekulativen Druck gerieten, regte der spätere Nobelpreisträger an, eine weltweite Steuer auf Devisentransfers zu erheben.[14]
Bei jedem Umtausch einer Währung sollte eine Abgabe zwischen 0,2% und 1% erhoben werden. Für Devisen, die zum Warenhandel und zu langfristigen Investitionen benötigt werden, würde das kaum ins Gewicht fallen. Auf ständig wiederholte Transaktionen, die nur für spekulative Währungsgewinne gemacht werden, hätte bereits eine Steuer von 0,2% spürbare Kosten zur Folge:
- bei Operationen, die monatlich von einer Währung in eine andere wandern, müsste eine jährliche Belastung von 2,4% in Kauf genommen werden;
- auf wöchentlich wiederholten Transaktionen würden die Mehrkosten auf 10,4% steigen;
- für tägliche Verschiebungen würde die Abschöpfung 40,5% pro Jahr betragen.
Nach Schätzungen wird nur 5% des Umsatzes auf den Devisenmärkten für realwirtschaftliche Bedürfnisse benötigt. 80% der restlichen Transaktionen sollen mindestens ein Mal pro Woche zwischen zwei verschiedenen Währungen hin und her geschoben werden.
Tobin schlug vor, die Einnahmen seiner Steuer der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds zukommen zu lassen. Vordergründig wollte er damit nicht zusätzliche Mittel für die Entwicklungshilfe erschliessen. Sein Hauptziel war, die Spekulation auf den Devisenmärkten einzudämmen, unter der schwächere Länder mehr als andere zu leiden hatten.
Die Absicht des Keynesianers war, der staatlichen Fiskal- und Geldpolitik mehr Autonomie zurückgeben, damit besser für die Interessen der realwirtschaftlichen Entwicklung gehandelt werden kann.
Während dreissig Jahren ist sein Vorschlag von Fachkollegen zerrissen worden. Darauf haben ihn plötzlich Kritiker der Globalisierung entdeckt, die mit Attac eine eigene NGO gründeten, um seine Verwirklichung voranzutreiben.
In diesen Kreisen war man sich mit der fortschreitenden Kapitalliberalisierung bewusst geworden, dass über die Tobin-Steuer enorme Mittel für die Hilfe an arme Länder abzuschöpfen wären:
- das tägliche Verkehrsvolumen auf den Devisenmärkten war auf die fast unvorstellbare Zahl von 3 000 Mia. USD pro Tag gestiegen;
- selbst wenn spekulative Währungsbewegungen durch die Steuer massiv verringert würden, wäre immer noch mit einem Betrag zu rechnen, der sich auf der Höhe der Entwicklungshilfe aller OECD-Länder bewegen dürfte.
Auch wenn die Kampagne der Attac dem Vater der Idee nicht behagte, vermochte sie den Druck auf die Politiker zu verstärken. Mehrere von ihnen begannen sich zugunsten der Steuer auszusprechen. Idealerweise sollte diese jedoch lückenlos von allen Ländern angewendet werden, weshalb sich deren Einfuehrung immer noch als schwierig erweist.
Im Jahre 2008 fuehrten masslose Spekulationen auf den Finanzmärkten zur grössten Wirtschaftkrise seit 1930. Plötzlich stieg dass Bewusstsein, die internationalen Kapitalmärkte müssten strenger überwacht werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Diskussion ueber die Tobin-Steuer neu belebt worden.
Ein dritter Vorschlag stammt vom deutschen Philosophen Thomas W. Pogge, der an der Columbia University in New York lehrt. In einem 1995 veröffentlichen Artikel schlug er vor, eine globale Rohstoffdividende einzuführen, um den Hunger und die radikale Ungleichheit in der Welt zu überwinden.[15]
Der Ethiker ging bei seinem Vorschlag von zwei unterschiedlichen Kategorien von Verpflichtungen aus:
- eine positive, gemäss der die Reichen den Armen zu helfen haben, weil sie ohne grössere Einbussen ihres Lebensstandards Not lindern könnten;
- eine negative, die sich daraus ergibt, dass die Reichen für das Bestehen der Armut Verantwortung tragen, weil sie davon profitieren.
Klar stellte sich Pogge hinter die zweite These, weil die heutige Weltordnung in seinen Augen ungerecht ist. Nationale wie internationale Institutionen lassen es zu, dass Armut erzeugt wird, die vermieden werden könnte. Wer nichts dagegen unternimmt, trägt eine kausale Verantwortung für das Elend, das in der Welt existiert.
Für Pogge ist die bestehende Weltordnung aus einem historischen Prozess massiver Verbrechen der Versklavung und der Kolonisation hervorgegangen. Daraus leitet er keine Ansprüche auf Reparationen ab, weil es nicht sittlich wäre, Menschen für Vergehen zu strafen, die sie nicht begangen haben. Trotzdem gehört diese Vergangenheit zu den Ursachen, dass Millionen von Menschen ohne eigene Schuld in eine miserable Lebensperspektive hineingeboren werden.
Dennoch wollte sich Pogge - wie er sagt- auf einen “massvollen Reformvorschlag” beschränken. Sein Ausgangspunkt war die höchst ungleiche Aneignung von Bodenschätzen und Rohstoffen, die noch heute stattfindet. Selbst wenn die Reichen glauben, dafür zu bezahlen, können sie nicht annehmen, dass die Armen einer solchen Ungleichheit “rational” zustimmen, weil für sie aus dem “gemeinsamen Erbe der Menschheit” nicht einmal das herausschaut, was für ihr Überleben notwendig ist.
Deshalb kommt Pogge zu dem Vorschlag, eine Dividende auf den Verbrauch von Rohstoffen einzuführen. Die Verfügungsgewalt der Staaten über ihre Rohstoffe würde erhalten bleiben, doch hätten sie einen Teil ihrer Gewinne an eine internationale Organisation abzuliefern.
Bewusst überliess der Philosoph die Details seiner Idee Wirtschaftsexperten und Völkerrechtlern. Mit einfacher Arithmetik kam er jedoch zum Schluss, dass bereits mit einer Erdöldividende von 12% eine Summe zu erzielen wäre, die den Umfang der heutigen Entwicklungshilfe übersteigen würde.
Um diese Mittel zu verteilen, hätte eine bestehende oder zu schaffende internationale Organisation dafür zu sorgen, dass Länder privilegiert werden, die wirksam gegen Hunger und Armut vorgehen. Für Regierungen, die das zu wenig oder überhaupt nicht tun, sollte der proportional zustehende Anteil vermindert, im Extremfall sogar gestrichen werden.
Da die Ausfuhrländer die zu erhebende Rohstoffdividende auf die Preise der - vorwiegend reicheren - Konsumenten überwälzen würden, wäre zusätzlich zu bewirken, dass mit dem Verbrauch von Rohstoffen sparsamer umgegangen wird. Ausserdem bestünde die Möglichkeit, Rohstoffe, die von baldiger Erschöpfung bedroht sind oder deren Ausbeutung grosse Umweltschäden verursacht, mit höheren Abgaben zu belegen.
Gerade unter letzterem Aspekt erscheint die Idee von Pogge sehr attraktiv. Jedenfalls haben in letzter Zeit verschiedenen Politiker vorgeschlagen, eine international abgestimmte Steuer auf Emissionen von Kohlendioxyd zu erheben. Wie bei der Tobin Steuer geht es auch bei diesem Vorschlag nicht prioritär um den Hunger in der Welt, sondern um Massnahmen gegen den Klimawandel. Doch sollte der Erlös der Steuer überdurchschnittlich ärmeren Ländern zugute kommen, um diesen bei der Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung zu helfen.
Unter verschiedenen anderen Vorschlägen ist noch die Idee einer Abgabe auf internationale Flugtickets zu erwähnen. Sie wird von NGOs seit Jahren propagiert und konnte bisher als einzige auf der Ebene der praktischen Politik ein minimales Echo finden.
Im Jahre 2006 hat die französische Regierung eine solche Steuer eingeführt, indem sie internationale Flugscheine nach dem europäischen Wirtschaftsraum in der Tourismus- Klasse mit 1 EUR, in der Business- und ersten Klasse mit 4 EUR belegte. Für Flüge über diesen Raum hinaus wurden vier Mal höhere Beträge festgelegt. Mehrere Länder haben versprochen, sich dem französischen Beispiel anzuschliessen, zu einer weltweiten Vereinbarung ist es aber bisher nicht gekommen.
All den genannten Vorschlägen ist gemeinsam, dass sie:
- nach automatischen Mechanismen suchen, um die Hilfe an arme Länder weniger von der Budgetpolitik der reichen Länder abhängig zu machen;
- zusätzliche Mittel dort zu erschliessen suchen, wo man es am wenigsten spürt, um Ziele des globalen Gemeinwohls zu erreichen;
- in grenzüberschreitender Erhebung und multilateraler Verteilung den Vorteil sehen, dass die Hilfe von den Empfängern als weniger erniedrigend empfunden wird.
Die Anliegen sind zu begrüssen, setzen allerdings voraus, dass multilaterale Hilfe ebenso effizient wie bilaterale ist. Internationale Bürokratien stehen nationalen an Schwerfälligkeit kaum nach. Dass es aber um ihre Wirksamkeit nicht so schlecht bestellt ist, kann daraus geschlossen werden, dass selbst reiche Geberländer bis zu 40% ihrer Entwicklungshilfe über multilaterale Kanäle abwickeln lassen.
4.5. Postulate für eine neue Weltwirtschaftsordnung
Aus moralischer Sicht ist jeder verpflichtet, sein Möglichstes zu tun, um sich für Hungernde einzusetzen. Ob darüber hinaus die reichen Länder den armen Ländern zu helfen haben, damit auch sie zum wirtschaftlichen Erfolg kommen, ist eine Frage, die auch unter Ethikern kontrovers bleibt.
Für jene, die darauf positiv antworten, stehen zwei Argumente im Vordergrund:
- die heute zurueckgebliebenen Länder sind arm, weil sie zur Zeit des Kolonialismus ausgebeutet worden sind und deshalb ein Anrecht auf Entschädigung haben;
- die Weltwirtschaft ist nach wie vor so organisiert ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden.
Das erste Argument hat historisch einiges für sich, doch wirft es Probleme auf wie:
- gibt es eine Sippenhaft, die über Generationen bestehen bleibt, wenn sich Nachkommen von Missetätern moralisch einwandfrei verhalten;
- müsste man nicht weit in die Geschichte zurückgehen, weil es über die Jahrtausende zu Eroberungen gekommen ist, die zu Unterdrückung und Ausbeutung geführt haben;
- würden die von Europa kolonisierten Völker heute besser da stehen, wenn sie auf sich selber angewiesen geblieben wären.
Eine Sippenhaft, die eine Generation unschuldiger Nachkommen trifft, ist unter moralischen Gesichtspunkten nicht zu rechtfertigen:
- wie sollte eine weisse Frau, die von europäischen Erobern abstammt, sich aber mit ihrem Ehemann, dem Nachkommen schwarzer Sklaven, täglich für die Hilfe an Arme einsetzt, dafür verantwortlich gemacht werden, dass ihre Urgrosseltern eine Plantage mit Sklaven betrieben haben;
- könnten sogar Nachkommen alter Römer der Lombardei, sofern sie noch vorhanden sind, gegenüber den Sprösslingen barbarischer Longobarden des 4. Jahrhunderts, die ebenfalls kaum mehr zu identifizieren sind, einen Anspruch auf Entschädigung für erlittenes Unrecht geltend machen.
Die Frage, ob es den kolonisierten Völkern besser gehen würde, wenn sie nicht erobert worden wären, ist nicht zu beantworten. Auch - und gerade - nicht von jenen, die den Kolonialismus zu entlasten suchen, indem sie argumentieren, dass:
- einige der reichen Länder - wie die nordischen Staaten und die Schweiz - nie Kolonialmächte gewesen sind,
- unter den ärmsten Ländern sich solche befinden, die - wie Afghanistan, Nepal und Liberia - nie kolonisiert worden sind,
- einige der ehemaligen Kolonien - wie die USA, Australien und Neuseeland - zu den reichsten Ländern der Welt geworden sind.
Zwar befinden sich darunter unbestreitbare Tatsachen, dennoch gilt es zu bedenken, dass:
- gerade Afghanistan kein gutes Beispiel ist, um zu beweisen, es sei so arm geblieben, weil es nie kolonisiert worden war;
- Länder, die nicht zu den Kolonialmächten gehörten, häufig für ihren Erfolg von einem kolonialen Umfeld profitiert haben.
Demnach ist zu bezweifeln, solche Spekulationen wuerden zu etwas führen. Vordringlicher ist jedenfalls die Frage, ob die heutige Weltwirtschaftsordnung tatsächlich verantwortlich ist, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden.
Für Marxisten liegt das auf der Hand, weil der Kapitalismus national wie international zu den gleichen Ergebnissen führt. Aus nicht ganz gleichen Gründen sind auch die Dependenz-Theoretiker zu ähnlichen Schlüssen gekommen, da in ihren Augen die aus der Kolonialzeit stammende Abhängigkeit von Rohstoffexporten ärmere Länder unausweichlich zu Verlierern macht.
Apodiktisch meinte der norwegische Entwicklungs- und Friedensforscher J. Galtung, jegliches Tauschverhältnis zwischen Reichen und Armen falle immer zum Nachteil der letzteren aus. Seine neo-marxistische Kollegen suchten das mit ihrer Theorie des Lohngefälles zu erklären:
- Industrieländer vermögen Produkte zu exportieren, zu deren Herstellung viel höhere Löhne bezahlt werden,
- ärmere Länder haben dagegen nur mit Erzeugnissen eine Chance, für die Subsistenzlöhne bezahlt werden, weshalb die Arbeiter der armen Peripherie nicht nur von den Kapitalisten, sondern auch von ihren Kollegen des reichen Zentrums ausgebeutet werden.
Die Lösung der Marxisten bestand darin, die pervertierten Mechanismen des Kapitalismus mit einer proletarischen Weltrevolution abzuschaffen. Das etwas bescheidenere Postulat der Dependenz-Theoretiker, die armen Länder sollten sich vorläufig von der Weltwirtschaft abkoppeln, hat ebenfalls zu keinem grossen Erfolg geführt.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass Abschottung nur zu grösseren Armut führt, während ärmere Länder, denen es gelungen ist, mit ihren Produkten auf die Weltmärkte vorzustossen, ihr Wachstum erheblich zu steigern vermochten.
Dennoch ist nicht zu behaupten, über Handel komme es automatisch zu einem Ausgleich der Einkommen. Das hat weniger mit der Theorie als mit der Tatsache zu tun, dass der Freihandel von den Stärkeren nur solange propagiert wird, als ihnen daraus keine Nachteile entstehen.
Der Hoffnung, dass sich Gerechtigkeit über eine unsichtbare Hand verwirklichen lässt, ist deshalb nicht zu vertrauen. Dass dafür auch der Wille der Beteiligten notwendig ist, hatten schon die Philosophen der griechischen Antike erkannt:
- von ihnen wurde zwischen der Verfahrens- und der Verteilungsgerechtigkeit unterschieden;
- Verfahrensgerechtigkeit bedeutete für sie, dass alle die gleiche Chance haben, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen;
- Verteilungsgerechtigkeit ging dagegen weiter, weil mit dieser allen eine gerechte Beteiligung am Ergebnis gesellschaftlichen Zusammenwirkens gesichert werden sollte.
Von der heutigen Weltwirtschaftsordnung ist schwerlich zu behaupten, dass sie auch nur dem Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit entspricht.
Reichere Länder predigen ständig den Freihandel, doch sind sie nicht bereit, diesen auch für ihre subventionierten Agrarprodukte zu akzeptieren, bei denen schwächere Länder eindeutige Wettbewerbsvorteile hätten.
Dass transnationale Unternehmen dort investieren, wo überschüssige Arbeitskräfte vorhanden sind, ist mehr als zu begrüssen. Wenn sie aber ihre Überlegenheit benützen, um Monopolgewinne zu erzielen und über Transferpreise Steuern zu umgehen, hat das mit Chancengleichheit nicht mehr viel zu tun.
Für konkrete Anwendungen erweist sich die private Forschung gegenüber der öffentlichen meistens als effizienter. Führt aber der Patentschutz dazu, dass dringend benötigte Medikamente ärmeren Schichten unzugänglich bleiben, kommt man nicht um die Frage herum, wie das zu rechtfertigen ist.
Verschiedentlich haben Wirtschaftskapitäne aus unersättlicher Gier das internationale Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruches getrieben, was die Krise von 2008 erneut auf dramatische Weise zum Vorschein gebracht hat.
Somit ist die heutige Weltwirtschaftsordnung schon unter dem Aspekt der Verfahrensgerechtigkeit dringend zu korrigieren:
- auf den Warenmärkten sind gleiche Zugangsmöglichkeiten für alle zu schaffen, ohne dass gewisse Vorzugsbedingungen für ärmere - nicht aber für reichere - Länder aufgegeben werden;
- es braucht eine internationale Kotrolle der Finanzmärkte, die weder den produktiven Kapitalverkehr behindert noch zu Schuldenwirtschaft führt, die jedoch für Sparer jeglicher Herkunft dauerhaftes Vertrauen schafft;
- wegen des Einflusses transnationaler Grossunternehmen ist eine internationale Kartellbehörde zu schaffen, die über die notwendigen Mittel verfügt, um im Interesse des gesunden Wettbewerbs Monopolgewinne weltweit zu verhindern,
- der internationale Patentschutz ist so zu gestalten, dass er in Notfällen nicht zu einer Situation führt, bei der er seine Glaubwürdigkeit verliert.
Mehrere dieser Themen stehen heute auf der Agenda zwischenstaatlicher Diskussionen, auch wenn vorläufig nicht grosse Fortschritte erreicht worden sind.
Was die Verteilungsgerechtigkeit betrifft, hat diese bereits auf nationaler Ebene Mühe, für die internationalen Beziehungen ist sie aber noch viel schwieriger zu realisieren.
Nach dem Marxismus und der christlichen Soziallehre hat der Amerikaner John Rawls die soziale Gerechtigkeit wieder zu einem Thema der modernen Philosophie gemacht.[16] Der aus der liberalen Tradition stammende Denker unterschied jedoch klar zwischen der Gerechtigkeit innerhalb staatlicher Gemeinwesen und der Gerechtigkeit unter den Staaten.
Für die staatliche Ebene ging Rawls davon aus, dass sich das Problem der Gerechtigkeit stellt, wenn sich Personen zusammenschliessen, um mehr zu produzieren. Der damit erzielte Mehrwert ist auf die Dauer nur zu sichern, wenn er unter den Beteiligten gerecht verteilt wird.
Zu dessen gerechter Verteilung griff Rawls auf einen imaginären Gesellschaftsvertrag zurück, bei dem Menschen unter dem Schleier der Unwissenheit - das heisst ohne Kenntnis ihrer persönlichen Ausgangslage - zusammenkommen und sich mit “nackter“ Vernunft auf eine gerechte Gesellschaftsordnung einigen, die wie folgt aussehen würde:
- jeder soll möglichst weit gehende Freiheitsrechte besitzen, die nur begrenzt werden dürfen, wenn das zur Sicherung der Freiheit anderer notwendig ist;
- alle haben Anspruch auf faire Chancengleichheit, die es ihnen ermöglicht, zu höheren Ämtern und Positionen aufzusteigen;
- soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur vertretbar, wenn sie den am wenigsten Begünstigten den relativ höchsten Vorteil bringen.
Das letztere Prinzip, das als Differenzprinzip bekannt geworden ist, hat eindeutig mit der Verteilungsgerechtigkeit zu tun. Rawls meinte jedoch, dieses Prinzip gelte nur innerhalb von Gesellschaften, bei denen bereits eine dichte Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen vorhanden sei.
Für die internationalen Beziehungen war das seiner Ansicht noch nicht der Fall. Für diese Ebene stellte er sich einen imaginären Gesellschaftsvertrag zweiter Stufe vor, bei dem nicht Einzelpersonen, sondern Abgeordnete von Völkern unter dem Schleier der Unwissenheit - ohne Kenntnisse, ob sie einem grossen oder kleinen, einem reichen oder armen Staat angehoeren - zu entscheiden haben, wie die Beziehungen unter ihnen zu regeln sind.
Aus dem Gedankenexperiment zog Rawls Schlussfolgerungen, die er selber als wenig spektakulaer bezeichnete. Wie er sagte, würden sich unter dem Schleier der Unwissenheit die Vertreter von Völkern bloss auf Prinzipien wie Gleichheit, Selbstbestimmungsrecht, Vertragstreue, Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Selbstverteidigung und humanitäre Kriegsführung einigen, die schon damals weitgehend anerkannt waren.
Charles R. Beitz, ein Schüler von Rawls, warf seinem Meister vor, die von ihm entworfene Gerechtigkeitstheorie zu wenig konsequent auf die internationalen Beziehungen ausgedehnt zu haben.[17]
An erster Stelle bemängelte Beitz, Rawls habe in seinem imaginären Gesellschaftsvertrag unter den Völkern ein wichtiges Element vergessen. Weil die natürlichen Ressourcen auf der Welt ungleich verteilt seien, wären die Vertreter von Völkern unter dem Schleier der Unwissenheit zum Schluss gekommen, der Zugang zu diesen müsse allen gewährleistet werden. Man hätte sich - mit anderen Worten - darauf geeinigt, dass Staaten über Bodenschätze keine ausschliessliche Souveränität beanspruchen können.
Ausserdem kritisierte Beitz die Annahme von Rawls, unter den Staaten würde zum gegenseitigen Nutzen nur wenig Zusammenarbeit bestehen. Mit Recht wies er darauf hin, dass durch Handel, Kapitalverkehr und Tourismus über staatliche Grenzen hinweg immer mehr Reichtum geschaffen werde. Da auch dieser gerecht zu verteilen sei, müsse das von Rawls entwickelte Differenzprinzip weltweit zur Anwendung gebracht werden.
Beitz war ein radikaler Vertreter des Kosmopolitismus, der für staatliche Souveränität wenig übrig hatte. Es erstaunt nicht, dass er bei Kommunitaristen, die wie er aus dem liberalen Gedankengut hervorgegangen sind, aber den Wert staatlicher Gemeinschaften viel höher einstufen, auf starke Ablehnung gestossen ist.
Seit je haben sich die Kommunitaristen mehr von Hegel als von Kant inspirieren lassen. Nach ihrer Überzeugung gibt es den über der Schöpfung schwebenden Menschen nicht. Die Persönlichkeit eines Menschen wird von der Gemeinschaft geprägt, in die er hineingeboren wird. Gefühle der Zugehörigkeit bleiben stark auf diesen Umkreis beschraenkt.
Auch wenn Kommunitaristen dafür eintreten, den Krieg zu ächten und universale Menschenrechtstandards zu schaffen, glauben sie kaum, dass zwischenstaatliche Beziehungen über eine friedliche Koexistenz hinausgehen können. Schon dem Gedanken, zugunsten der Menschenrechte von aussen zu intervenieren, stehen sie skeptisch gegenüber. Das Postulat, weltweit zu einer sozialen Gerechtigkeit zu kommen, betrachten sie als realitaetsfremdes Wunschdenken.
Der englische Philosoph Brian Barry kritisierte sowohl die Kommunitaristen als auch die Kosmopoliten, indem er von einer völlig anderen Perspektive ausging.[18] Für ihn war Rawls Annahme, dass Gerechtigkeit auf Reziprozität, gegenseitigem Vorteil und aufgeklärtem Selbstinteresse beruhe, zwar hilfreich, aber nicht genügend.
Denn Gerechtigkeit sei am notwendigsten, wenn weder Reziprozität noch gegenseitiger Vorteil vorhanden seien. Die Armen hätten weder Reziprozität anzubieten, noch seien sie an einem Schema zum gegenseitigen Vorteil beteiligt. Da heute die grössten Reichtumsunterschiede auf zwischenstaatlicher Ebene bestehen, komme eine Theorie der Gerechtigkeit nicht darum herum, sich mit dieser Tatsache auseinandersetzten.
Barry entwickelte dafür das Konzept der Unparteilichkeit, das nicht mit dem Schleier des Unwissens operiert, sondern von realen Teilnehmern an einer Debatte über Gerechtigkeit auszugehen hat, die mit unterschiedlichen Interessen um Lösungen ringen, die von beiden Seiten akzeptiert werden können. Welche Lösungen würden dabei auf internationaler Eben herauskommen?
Im Sinne der Kommunitaristen war sich Barry bewusst, dass solidarisches Empfinden unter lokalen Gemeinschaften stärker als zwischen Staaten ist. Doch war das für ihn kein Grund, die weltweite Ungleichheit zu ignorieren. Deshalb meinte er, mit unparteilicher Vernunft sollte man sich auf zwischenstaatlicher Ebene wenigstens darauf einigen, die natürlichen Ressourcen untereinander gerechter zu verteilen, womit er zu einem ähnlichen Schluss wie Beitz kam.
Darüber hinaus forderte Barry, reichere Länder hätten ärmeren zu helfen, nicht weil das in ihrem Interesse liege, oder weil Vorteile gegenseitiger Zusammenarbeit zu verteilen seien, sondern weil dies aus Gründen der Vernunft nicht verweigert werden könne. In bemerkenswerter Weise meinte er, eine Aufgabe der heutigen Moralphilosophie bestehe darin, zur Verbreitung eines weltweiten Gemeinschaftsgefühls beizutragen.
Die Päpste sind mit ihrer Moraltheologie viel früher zu einem ähnlichen Schluss gekommen. In der Enzyklika “Pacem in terris” sprach Papst Johannes XXIII die Überzeugung aus, dass das gleiche natürliche Sittengesetz, das die Lebensordnung unter den einzelnen Bürgern regle, auch die gegenseitigen Beziehungen unter den Staaten leiten soll.
Sein Nachfolger Paul VI. kam in der Enzyklika “Populorum Progressio” darauf zurück, indem er sagte:
“Noch immer gilt die Lehre Leos XIII. in Rerum novarum: das Einverständnis von Partnern, die in zu ungleicher Situation sind, genügt nicht, um die Gerechtigkeit eines Vertrages zu garantieren. Die Regel, wonach Verträge durch das freie Einverständnis der Partner zustande kommen, ist den Forderungen des Naturrechts untergeordnet. Was dort von dem gerechten Lohn für den einzelnen Arbeiter gelehrt wird, gilt ebenso von internationalen Verträgen: eine Verkehrswirtschaft kann nicht mehr allein auf die Gesetzte des freien und ungezügelten Wettbewerbs gegründet sein, der nur zu oft zu einer Wirtschaftsdiktatur führt. Der freie Austausch von Gütern ist nur dann recht und billig, wenn er mit den Forderungen der sozialen Gerechtigkeit übereinstimmt.”
Wie immer man sich zu diesen Meinungen stellt, für mehr Gerechtigkeit unter den Völkern sprechen heute auch Gründe, die nicht ausschliesslich von der Ethik ausgehen:
- starke Reichtumsunterschiede lösen gewalttätige Konflikte aus und führen zu Verlusten, fuer deren Behebung enorme Mittel benötigt werden;
- wirtschaftlich hätte eine bessere Verteilung der Einkommen den Vorteil, dass die Kaufkraft für viele Produkte zunehmen würde.
Jedoch ist damit das Problem nicht gelöst, wie unter souveränen Staaten zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu kommen ist. Ethiker geben darauf kaum konkrete Antworten, weil sie sich nur für das Ziel, aber nicht für die Mittel als zuständig betrachten.
Die Erfahrungen verschiedener Staaten, die innerhalb ihrer Grenzen mehr Gerechtigkeit erreicht haben, sind nicht so leicht auf die zwischenstaatlichen Beziehungen zu übertragen. Die erfolgreichsten unter ihnen stellen für die Produktion von Gütern auf die Marktkräfte ab, haben aber Mindestlöhne und Sozialversicherungen eingerichtet und nehmen über Steuern eine Korrektur an der Einkommensverteilung vor.
In diese Richtung gehen zwar die Vorschläge, die über Abgaben auf den Waffenhandel, Devisentransfers, Rohstoffe und Flugzeugbillete den ärmeren Schichten der Welt mehr Mittel zuführen wollen. Da man aber auf diesem Wege bisher nicht sehr weit gekommen ist, bleibt die Frage offen, wie das heutige Staatensystem zu reformieren ist, um weltweit zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu kommen.
5. Globales Regieren
5.1. Veränderungen der letzten Jahrzehnte
Offenbar hat Jeremy Bentham 1780 zum ersten Mal den Begriff internationale Beziehungen geprägt. Er entstand zu einem Zeitpunkt, als England mit seiner aufkommenden Industrie Märkte benötigte, die über seinen Einflussbereich hinausgingen. Damals war das europäische System souveräner Staaten, welches das christliche Imperium des Mittelalters abgelöst hatte, schon mehr als ein Jahrhundert alt.
Seit einiger Zeit wird anstatt von internationalen immer mehr von globalen Beziehungen gesprochen. Mit dem neuen Begriff soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass von grenzüberschreitenden Beziehungen heute nicht mehr nur der Handel, sondern viele andere Bereiche betroffen sind.
Die Welt wird immer mehr zu einem grossen Dorf, in dem sich die gegenseitige Abhängigkeit auf das Leben jedes Einzelnen auswirkt. Die einen sehen sich in ihrem Fortschrittsglauben bestärkt, andere befürchten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder unter stets schlechteren Bedingungen leben zu müssen.
Realisten glauben, es handle sich bloss um quantitative Veränderungen, die nichts an den klassischen Beziehungen unter den Staaten ändern würden. Progressive Kräfte meinen dagegen, dass wir uns auf dem Wege zu einer neuen Weltordnung befinden. Marxisten sind nach wie vor überzeugt, es gehe um die letzte Phase des Kapitalismus, die nächstens zu einer sozialistischen Weltrevolution führen werde.
Von der Politikwissenschaft werden drei empirische Kategorien unterschieden:
- internationale Beziehungen bedeuten, dass staatliche Grenzen durchlässiger werden, ohne dass die vorwiegende Gestaltungsrolle der Regierungen verloren geht;
- transnationale Beziehungen entstehen, wenn andere Akteure - internationale Organisationen, grosse Unternehmen, nicht - gouvernementale Organisationen -, mit den Staaten in Konkurrenz treten, um grenzüberschreitende Beziehungen zu beeinflussen;
- unter Globalisierung ist zu verstehen, dass nicht mehr nur Grossakteure, sondern auch Individuen zu Subjekten der internationalen Beziehungen werden.
Schaut man auf die Veränderungen der letzten Jahrzehnte zurück, kommt man nicht um die Tatsache herum, dass ein rasanter Wandel stattgefunden hat, jede der drei Ebenen aber weiterhin in unterschiedlichem Grade miteinander koexistieren.
Handel
Den grenzüberschreitenden Handel gab es bereits zur Zeit der antiken Imperien. Zunächst wurden Güter ausgetauscht, die aus klimatischen Gründen auf den eigenen Märkten nicht zu finden waren. Ab dem 19. Jahrhundert setzte eine Arbeitsteilung ein, mit der sich Europa auf den Export von Industriegütern spezialisierte, während Rohstoffe vorwiegend aus den Kolonien kamen. Dank neuer Transportmittel stieg der Anteil der Exporte an der globalen Produktion zwischen 1870 und 1914 von 4% auf 8%. Die beiden Weltkriege führten zu einem Rückschlag, so dass 1950 der Anteil der Exporte nur mehr 5% betrug. Bald darauf kam es aber erneut zu einer starken Expansion, die Exporte wuchsen doppelt so rasch als die Produktion. Ihr Anteil am Weltprodukt war 1980 auf 16% gestiegen und kletterte in den folgenden zwei Jahrzehnten auf fast 30%. Der technische Fortschritt blieb ein zentraler Faktor, namhaft haben aber auch politische Bemühungen zur Liberalisierung der Märkte beigetragen.
Investitionen
Bis zur Industrialisierung kam es nur wenig zu grenzüberschreitenden Investitionen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten diese aber bereits ein erhebliches Ausmass erreicht. Damals wurde ausländisches Kapital vor allem für die Erschliessung von Rohstoffen und fuer die dafür benötigten Infrastrukturen investiert. Mit den Kriegen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Volumen solcher Investitionen weit unter das Niveau vom Ende des 19. Jahrhunderts zurückgefallen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben jedoch ausländische Direktinvestitionen enorm zugenommen. Lag die Wachstumsrate der Exporte seit 1950 bei jährlicht 6% zu, wurde diese von den Direktinvestitionen um das Doppelte übertroffen. Besonders ausgeprägt war das ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als das Volumen ausländischer Direktinvestitionen um mehr als das Hundertfache zugenommen hat.
Transnationale Unternehmen
Grenzüberschreitende Direktinvestitionen werden vor allem von grossen Unternehmen getätigt, um neue Märkte zu erschliessen oder in billigeren Ländern zu produzieren. Heute läuft fast 50% des Welthandels über transnationale Unternehmen, wobei ein grosser Teil aus konzerninternem Handel zwischen Mutter- und Tochterfirmen besteht. Im Gegensatz zur Arbeitsteilung des 19. Jahrhunderts wird nicht mehr nur der Absatz, sondern auch die Produktion internationalisiert. Die Zahl transnational tätiger Unternehmen ist auf über 40 000 gewachsen. Der Umsatz der 50 wichtigsten Unternehmen übersteigt das Bruttosozialprodukt von zwei Drittel der Staaten.
Finanzmärkte
Mit noch grösserer Geschwindigkeit haben seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die reinen Finanztransaktionen zugenommen. Die täglichen Devisenumsätze, die Ende 1970 bei 75 Mia. USD lagen, sind danach auf die unvorstellbare Zahl von 3 000 Mia. USD gestiegen. Ähnliche Zuwachsraten waren auch bei internationalen Bankeinlagen, Krediten und anderen Finanzinstrumenten zu verzeichnen. Dank der Liberalisierung und der Informationstechnik ist ein weltweiter Kapitalmarkt entstanden, über den täglich 40 Mal mehr Mittel als für den Wert des Handels mit Gütern und Dienstleistungen abgewickelt werden.
Tourismus
Seit 1950 ist die Zahl der Personen, die ausserhalb ihres Landes Ferien machen, von 25 Mio. auf eine Milliarde gestiegen. Noch immer stammt die Mehrzahl der Touristen aus den alten Industrieländern. Ihr Erlebnisdrang sucht stets neue Horizonte, weshalb der Tourismus in einzelnen Entwicklungsländern erheblich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitraegt. Gleichzeitig werden aber der einheimischen Bevoelkerung enorme Reichtumsunterschiede vor die Augen gefuehrt, die schwer erfuellbare Illusionen wecken.
Migration
Das ist einer der Gründe, dass die internationalen Wanderungsströme vom Süden nach dem Norden zunehmen Die Zahl der Migranten wird inzwischen auf über 200 Millionen geschätzt. Die meisten unter ihnen leben in prekären Verhältnissen, weisen aber eine hohe Sparquote aus. Ihre Überweisungen an Familienangehörige zu Hause haben in den letzten Jahren mehr als das Doppelte der internationalen Entwicklungshilfe ausgemacht. Die reichen Länder sehen sich jedoch veranlasst, die Einwanderung zu kontrollieren, was zu hohen Emotionen führt. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die verarmten Schichten, die im 19. Jahrhundert vom Norden nach dem Süden auswanderten, mehr als den Anteil der Weltbevölkerung darstellte, der heute in umgekehrter Richtung erfolgt.
Umweltverschmutzung
Vom Menschen verursachte Umweltschäden hat es immer gegeben. Doch sind diese seit der Industrialisierung exponentiell gestiegen. Erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde man sich bewusst, dass daraus schwerwiegende Probleme entstehen. Schlechte Luft und verseuchte Gewässer überqueren problemlos staatliche Grenzen, von denen nicht nur Nachbarstaaten, sondern auch kollektive Güter der Weltgemeinschaft betroffen werden. Das grösste Problem ist heute die globale Erwärmung, die hauptsaechlich durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe verursacht wird. Gemäss Experten hat die durchschnittliche Temperatur um fast ein Grad Celsius zugenommen. Sollte dieser Trend anhalten, könnten wegen des erhöhten Meeresspiegels weite Küstengebiete überflutet werden. Auch die plötzlichen Dürren und Überschwemmungen, die vermehrt in verschiedensten Regionen auftreten, werden auf den Klimawandel zurückgeführt. Zu befürchten ist zudem, dass von Wärme liebenden Schädlingen neue Epidemien verursacht werden. Auch birgt die Veränderung von Fauna und Flora die Gefahr in sich, dass die heutige Nahrungsmittelkette nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Wird auf diese Entwicklungen kein Einfluss genommen, rechnet der 2006 veröffentlichte Stern-Bericht, dass die vom Klimawandel verursachten Schäden bis 2100 zwischen 5% und 20% der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen werden.
Organisiertes Verbrechen
Überquert die Umweltverschmutzung geräuschlos staatliche Grenzen, ist das immer mehr auch für die organisierte Kriminalität der Fall. Weil Verkehrs- und Kommunikationswege einfacher geworden sind, nimmt nicht nur der legale, sondern auch der illegale Handel zu. Das gilt vor allem für Drogen, Waffen und Menschen, bei denen sich international operierende Banden zu Grosskonzernen entwickelt haben. Der Jahresumsatz der Drogenindustrie wird auf über 800 Mia. USD. geschätzt, was den weltweiten Militärausgaben der Staaten entspricht. In manchen Industriestaaten sollen die Einnahmen aus der Prostitution 5% ihres BIP ausmachen. Von unlauteren Geschäften profitieren nicht nur skrupellose Individuen, sondern auch der politisch organisierte Terrorismus, der als grösste Sicherheitsbedrohung der heutigen Zeit gilt.
Geographisch sind diese Entwicklungen unterschiedlich verteilt. Bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts blieb die Zunahme des Handels und der Investitionen auf das Dreieck USA, Westeuropa und Japan konzentriert. Für die Expansion der Finanzmärkte war das ebenfalls der Fall.
Noch immer ist die Globalisierung ein Phänomen kaufkräftiger Eliten. Zwei Drittel der Menschheit profitieren kaum davon. Die Armen sind zwar bevorzugte Opfer der internationalen Kriminalität und der globalen Umweltverschmutzung, von den Vorteilen der wirtschaftlichen Globalisierung bekommen sie jedoch nur wenig zu spüren.
Die Strukturen der Weltwirtschaft beginnen sich aber merklich zu verändern. Die Dominanz der alten Industriestaaten schwindet mehr und mehr. China ist in kurzer Zeit zu einem Wirtschaftskoloss geworden, der nicht nur beim Handel, sondern auch bei den Finanztransaktionen eine immer grössere Rolle spielt. Daneben sind Länder wie Indien, Brasilien, Südafrika im Begriffe, früher prominente Industrieländer in ihrer Bedeutung zu überholen.
Die aufstrebenden Wirtschaftsmächte des Südens bleiben stark auf ihre Souveränität bedacht, obwohl auch sie nicht um die Tatsache herumkommen, dass sich dieser Begriff immer mehr verändert. Zwar hat sich die Zahl international anerkannter Staaten seit 1945 vervierfacht, ihre Souveränität ist aber nicht mehr das, was sie früher einmal war. Denn die zunehmende Interdependenz schränkt den Handlungsspielraum der Staaten ein:
- die Konjunktur einzelner Wirtschaften kann immer weniger über nationale Zins- und Geldpolitik gesteuert werden;
- auch die Fiskalpolitik ist nicht mehr autonom, weil der Steuerwettbewerb ständig mit der Abwanderung produktiver Substanz droht;
- rein staatliche Wettbewerbspolitik vermag die Bildung transnationaler Kartelle nicht zu verhindern;
- Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken haben immer noch grosse Auswirkungen, doch ist heute das Investitionsverhalten Chinas von entscheidender Bedeutung, wie die Staatspapiere verschuldeter Länder bewertet werden;
- Spekulationen auf den weltweiten Kapitalmärkten können über Nacht Währungen einzelner Länder unter Druck stellen und auch bei den Rohstoffpreisen zu exorbitanten Schwankungen führen, was je nachdem sowohl reiche Importeure als auch arme Exporteure vor grosse Probleme stellt.
Auf diesem Hintergrund kommen einige zum Schluss, die Ära souveräner Staaten neige sich dem Ende zu. Dennoch dürfte es verfrüht sein, den Nationalstaat schon jetzt voellig abzuschreiben.
Bisher waren es nämlich vor allem Staaten, die auf die Veränderungen reagiert haben. Weil sie sich bewusst geworden sind, dass sie immer mehr Probleme nicht allein lösen können, haben sie sich in internationalen Organisationen zusammengeschlossen. Hat sich die Zahl der Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges fast vervierfacht, ist jene der zwischenstaatlichen Organisationen noch deutlich schneller gestiegen.
Heute gibt es über 300 solcher Organisationen, deren Ursprung auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, als die ersten gegründet wurden, um den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern. Nach den Katastrophen der beiden Weltkriege kam man zur Einsicht, nicht nur der Handel, sondern auch der Frieden benoetige kooperative Zusammenarbeit. Seit der Globalisierung ist es in zahlreichen andere Bereichen zur Bildung neuer Organisationen gekommen.
Die Initiative für multilaterale Zusammenarbeit ist allerdings nicht nur von den Staaten ausgegangen. In letzter Zeit wurden sie häufig von nicht-gouvernementalen Organisationen initiiert. Von diesen privaten Vereinen, die sich ohne Gewinnstreben grenzüberschreitenden Problemen widmen, gab es vor 50 Jahren nur ein paar Dutzend, inzwischen ist deren Zahl auf über 3’000 gestiegen. Für die Hilfe an die Armen, die Menschenrechte und die Umweltpolitik haben sie immer grössere Bedeutung erlangt, weil sie fähig sind, auf die Agenda der Zusammenarbeit unter den Staaten Einfluss zu nehmen.
Dank privater Spenden vermögen viele von ihnen, globale Medienkampagnen zu führen, um staatliches Verhalten an den Pranger zu stellen. Auswirkungen hat das nicht nur für demokratische Regierungen, die unter dem Druck ihrer Wähler stehen, sondern auch für autoritäre Regime, die um ihr internationales Ansehen bangen müssen.
In bemerkenswerter Weise gelingt es ihnen auch, wissenschaftliche Kompetenz anzuziehen, die häufig staatlichen Bürokratien überlegen ist. Mit den neuen Informationstechnologien haben sie die Moeglichkeit, sich weltweit ohne grosse Kosten zu vernetzen. Hinzu kommt dass das Sattelitenfernsehen ihre Anliegen bereitwillig bis in die letzten Ecken der Welt verbreitet, weil Skandal trächtige Neuigkeiten für Einschaltquoten sorgen, was für die privaten Medien von grossem Interesse ist.
5.2. Wenig einstimmige Antworten
Während Realisten aller Gattung meinen, die Ereignisse der letzten Jahrzehnte hätten an der Natur der internationalen Politik nichts geändert, steht doch die Frage im Raum, ob unter den mehr als 190 Staaten der Welt allein das Gesetz des Machtkampfes gilt und jegliche Kooperation nur zu diesem Zweck verfolgt wird. Das realistische Credo wird immer fragiler, selbst wenn die angebotenen Alternativen wenig konkret und sehr kontrovers bleiben.
Dem Realismus am nächsten steht die neokonservative Ansicht, die heutigen Umstände würden eine hegemoniale Führungsmacht notwendig machen. Mit dem ursprünglichen Glaubensgut der Realisten hat das zwar wenig zu tun, gemeinsam ist aber beiden Strömungen, dass Macht der entscheidende Faktor der Weltpolitik bleibt.
Wie schon gesagt, wurde die Geschichte über Jahrhunderte von Imperien geprägt. Im Durchschnitt hat jedes dieser Imperien - sei es das Perserreich, das römische Imperium oder die Mongolenherrschaft - nicht länger gedauert als das seit dem westfälischen Frieden entstandene Staatenmodell. Die meisten der alten Imperien gingen an ihrer Überdehnung zugrunde, weil sie ständig neue Gebiete erobern mussten, um äussere Angriffe abzuwehren, und mit der Zeit nicht mehr fähig waren, Widerstände in weit entfernten Grenzgebieten zu kontrollieren.
Obwohl sich die beiden Konzepte widersprechen, hat der imperiale Gedanke lange mit dem System unabhängiger Staaten zusammengelebt. Von vielen europäischen Staaten sind bald nach ihrem Entstehen ausgedehnte Kolonialreiche in Übersee errichtet worden, die autoritär verwaltet wurden. Die letzten von diesen sind erst nach dem zweiten Weltkrieg aufgegeben worden, weil sie zu finanziellen Belastungen geworden waren und auch moralisch nicht mehr zu verteidigen waren.
Selbst nach dem Ende des Kolonialismus ist imperiale Macht erhalten geblieben. Als der Kalte Krieg ausbrach, haben sowohl die USA als auch die UdSSR unter dem Deckmantel formeller oder eingeschränkter Souveränität ihre Satteliten mit militärischen Mitteln kontrolliert, um den eigenen Einflussbereich zu bewahren oder zu vergrössern.
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion blieben die USA als einzige Supermacht übrig. Das war der Anlass für die neokonservative Idee, es brauche in der heute interdependenten Welt einen wohlwollenden Hegemon, der im Interesse aller für Ordnung sorgen muesse. Hegemonie wurde als sanfte Alternative zum Imperium verstanden, weil mehr mit milder Macht als mit militärischen Gewalt operiert werden sollte.
Trotzdem wurde die Hauptaufgabe des Hegemons darin gesehen, die Funktion des Weltpolizisten zu übernehmen, um für das kollektive Gut der Sicherheit zu sorgen, damit auf dieser Grundlage der materielle Fortschritt global verbreitet werden kann.
Das Risiko der Überdehnung, an dem frühere Imperien zugrunde gegangen waren, schätzten die Neo-Konservativen als gering ein. In der Tat können heute dank der Satellitentechnik Vorgänge auf der ganzen Welt in Echtzeit beobachtet werden. Es ist auch möglich, luftgestützte Einheiten in Stunden von einer Ecke der Welt nach der anderen zu verlegen. Schweres Gerät kann in Wochenfrist nachgeliefert werden, in Notfällen ist mit Marschflugkörpern sogar in Minuten oder Sekunden zu reagieren.
Nach dem Terroranschlag vom 11.9.2001 hat sich der amerikanische Präsident George W. Bush voll auf die Theorien der neokonservativen Ideologen eingeschworen. Wenig spaeter musste er in dem von ihm entfachten Krieg gegen das irakische Regime erfahren, dass trotz eines anfänglich atemberaubenden Sieges seine “wohlwollenden” Truppen von dem “befreiten” Volk nicht mit stürmischer Begeisterung empfangen wurden.
Noch schlimmer wurde es, als sich herausstellte, dass neue Technologien ebenfalls viel kleineren Gegnern in die Hände spielen. Selbst in entlegenen Gebieten der Welt vermochten isolierte Widerstandsgruppen über Internet und Mobiltelefone selbstmörderischen Aktionen zu inszenieren, mit denen die “Ordnungsabsichten” des gutmütigen Goliaths durchkreuzt wurden. Gerade bei einem Hegemon, der wie die USA demokratisch organisiert ist - weshalb die Neokonservativen dessen Führungsanspruch als unanfechtbar betrachteten - hat das zur Folge, dass die Wählerschaft die Kosten solcher Expeditionen mit der Zeit nicht mehr zu tragen bereit ist.
Demokratische Hegemonialmächte haben jedoch nicht nur gegen den Widerstand fanatischer Gruppen und die Ermüdung ihrer Stimmbürger zu kämpfen, sie treffen auch in der Staatengemeinschaft auf Ablehnung. Kleinere Staaten wollen prinzipiell von Hegemonie nichts wissen, weil sie gleichberechtigt an der Gestaltung der Weltordnung mitwirken möchten. Noch tiefer liegt das Misstrauen bei grösseren Staaten, von denen keiner die Chance vergeben will, je nach den Verhältnissen selber zu einem Hegemon zu werden.
Wahrscheinlich hätten die USA nach dem Zerfall der Sowjetunion die Chance gehabt, für eine neue, der Globalisierung entsprechenden Weltordnung die Führungsrolle zu übernehmen. Doch sind sie daran unter der Regierung von George W. Bush mit ihrem hegemonialen Alleingang kläglich gescheitert.
Seither findet der liberale Institutionalismus, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, wieder stärkere Beachtung. Liberaler Institutionalismus ist nicht mit neoliberaler Wirtschaftspolitik zu verwechseln. Zwar sind liberale Institutionalisten von Anfang an für den freien Handel eingetreten, weil sie darin ein Mittel sahen, das System sich ständig bekämpfender Staaten zu überwinden. Während neoliberale Wirtschaftspolitik mit dem Realismus gut zusammenleben kann, haben liberale Institutionalisten stets die Ansicht vertreten, die zwischenstaatlichen Beziehungen müssten anders gestaltet werden.
- Eines ihrer ersten Postulate war, dass es unter den Staaten mehr Recht als Macht braucht. Unablässig plädierten sie für eine Verrechtlichung der internationalen Beziehungen. Der Ausbau des Völkerrechtes sollte sich nicht nur mit der Sicherheit von Staaten, sondern auch mit dem Wohlergehen von Individuen befassen. In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl internationaler Verträge enorm zugenommen. Auch ist das Völkerrecht, das lange nur Staaten als Subjekt anerkannte, auf Rechte und Pflichten von Individuen und sozialer Gruppen ausgedehnt worden (Menschenrechte, Rechte für Minderheiten, Rechte für indigene Völker).
- Eine weitere Forderung des politischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts war, Staaten sollten sich gemeinsam organisieren, um grenzüberschreitende Probleme zu lösen. Obwohl man sich dabei zunächst auf wirtschaftliche Themen konzentrierte, wurde damit eine Entwicklung voraus genommen, die in der Multiplizierung internationaler Organisationen auf verschiedensten Gebieten ihren Niederschlag gefunden hat. Dass internationale Organisationen nicht nur die Verrechtlichung zwischenstaatlicher Beziehungen fördern, sondern auch zu deren Einhaltung beitragen und darüber hinaus zu einem Instrument des Dialogs und der Vermittlung geworden sind, ist kaum mehr in Frage zu stellen.
- Die Theorie des Funktionalismus, die schon vor dem zweiten Weltkrieg entstanden war, hat die Gedanken des liberalen Institutionalismus weiter vertieft. Deren Exponenten waren ebenfalls überzeugt, nationalstaatliche Egoismen seien nicht mehr zeitgemäss und müssten überwunden werden. Ihr Ziel war die Schaffung transnationaler Institutionen, für die sie empfahlen, sich zunächst auf technische Bereiche zu beschränken. Schrittweise Erfolge würden sich unweigerlich auf immer weitere Bereiche ausdehnen, um schliesslich den Kern der hohen Politik zu erreichen (spill-over Effekt). Zumindest im europäischen Einigungsprozess hat diese Theorie eine Bestätigung erfahren.
- Als ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts grosse Privatunternehmen häufiger grenzüberschreitend zu operieren begannen und nicht - gouvernementale Organisationen im gleichen Sinne aktiv wurden, setzte eine umfangreiche Literatur ein, die sich mit dem Einfluss neuer Akteure in der internationalen Politik zu beschäftigen begann. Im Vordergrund standen die transnationalen Unternehmen, die über triangulären Handel und die Verlegung von Produktionsstätten die Autonomie staatlicher Fiskal- und Handelspolitik zu untergraben vermochten.
- Gleichzeitig wurde untersucht, wie Nicht-Regierungsorganisationen die Fähigkeit erlangt hatten, auf die Agenda zwischenstaatlicher Verhandlungen Einfluss zu nehmen. Es handelte sich mehrheitlich um empirische Forschungen, die jedoch den Schluss nahe legten, dass das traditionelle Verständnis der internationalen Politik nicht mehr aktuell ist.
Institutionalisten wird nach wie vor der Vorwurf gemacht, ein Wunschdenken zu betreiben, das wissenschaftlich nicht begründet sei. Heute ist jedoch schwerlich zu behaupten, dass sich Institutionalisten weniger als andere um Methoden wissenschaftlicher Forschung bemühen.
Ein Beispiel dafür ist die Regime-Theorie, die seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts von eher realistisch inspirierten Forschern entwickelt worden war. Hat das Wort “Regime” in der deutschsprachigen Empfindung einen undemokratischen Klang, wird es im englischen Sprachgebrauch völlig neutral gebraucht. Von den dort entstandenen Regime-Theoretikern werden darunter Richtlinien und Systeme aller Art verstanden, die das Verhalten von Staaten auf internationaler Ebene beinflussen.
Für Realisten kommn solche Regime nur zustande, wenn sie von den mächtigen Staaten gewünscht und mitgetragen werden. Institutionalisten glauben dagegen, dass man diese auch anders begründen kann. Ihren Ansatz entnehmen sie von Erkenntnissen, die aus der klassischen Mikroökonomie stammen:
- Die Mikroökonomie plädiert für den freien Markt, der keine Obrigkeit kennt und eine optimale Produktion gewisser Güter für den Konsumenten garantiert. Sie ist sich aber bewusst, dass damit eine Reihe benötigter Kollektivgüter nicht zu gewährleisten ist.
- Das Versagen des Marktes zu Herstellung solcher Güter wird auf nationaler Ebene vom Staat getragen, der kraft seiner Autorität Steuern erhebt, um Kollektivgüter wie Erziehung, Strassenbau und Polizeischutz zur Verfügung zu stellen.
- Da im internationalen Bereich wie beim Markt eine übergeordnete Autorität fehlt und der Wettbewerb aller gegen alle vorherrscht, sind sich die Institutionalisten bewusst, dass es schwierig ist, Kollektivgüter der Weltgemeinschaft - wie etwa den Umweltschutz - zu sichern.
- Doch glauben sie, dass die Lücke über internationale Absprachen, mit denen Prinzipien, Normen, Regeln und Entscheidungsprozeduren festgelegt werden, gefuellt werden kann.
- Regime solcher Art können über zwischenstaatliche Verträge und internationale Organisationen entstehen, sind aber häufig auch völlig informeller Natur.
Um das Zustandekommen internationaler Regime zu erklären, greifen die Institutionalisten auf die Spieltheorie zurück. Diese hat das berühmte Gefangenen-Dilemma entwickelt, bei dem zwei Missetäter zunächst nicht mit der Justiz zusammenarbeiten, weil keiner von ihnen weiss, wie die erste Reaktion des anderen ausfällt. Somit entgeht beiden die versprochene Straferleichterung, weshalb ihr vermeintlich rationales Verhalten zu einem sub-optimalen Ergebnis führt.
Sowohl für Realisten als auch für Institutionalisten ist die Staatenwelt von einem ähnlichen Dilemma gekennzeichnet. Kein Staat kann darauf vertrauen, ob vereinbarte Regeln vom anderen eingehalten werden. Auch wenn diese für alle von Nutzen wären, besteht das Risiko, dass einer davon profitiert, ohne für dessen Kosten aufzukommen.
Im Gegensatz zu den Realisten glauben jedoch die Institutionalisten, dass es aus dem Dilemma einen Ausweg gibt. Sie beziehen sich auf eine Variante der Spieltheorie, die von ihren Erfindern selber als optimal bezeichnet worden war. Die Variante lautet, dass beim Gefangenen Dilemma zum besten Ergebnis zu kommen ist, wenn man sich im ersten Zuge kooperativ verhält und darauf in allen weiteren Zügen genau die Wahl des Gegners vom vorherigen Zug wiederholt.
Mit einem solchen Verhalten wird Bereitschaft zur Reziprozität signalisiert, was sich bei fortwährender Missachtung zum Schaden des Gegners auswirkt. Kommt unter dem “tit for tat” ein Regime zustande, plädieren die Institutionalisten dafür, dieses mit möglichst starken Überwachsungsmechanismen zu versehen. Für Fragen militärischer Sicherheit stellen sie Sattelitenüberwachung und unangekündigte Inspektionen in den Vordergrund, bei wirtschaftlichen Regimes obligatorische Schiedsverfahren, im Umweltbereich die Zusammenarbeit mit Experten der Wissenschaft.
Neben den Auseinandersetzungen zwischen Realisten und Idealisten vermochte sich in den letzten Jahren der Konstruktivismus zu profilieren. Er ist aus philosophischen Denkschulen hervorgegangen, die sich mit der Frage auseinandersetzten, wie weit der Mensch Realität zu erkennen vermag. Der gemeinsame Nenner verschiedener Nuancen lautete, der Mensch würde davon nur wissen, was er sich selber darüber konstruiert.
Obwohl solches Wissen von individuellen Bemühungen ausgehen kann, wird es vor allem durch soziale Interaktionen geprägt. Daraus entstehen Konventionen und Normen, die in gesellschaftlichen Strukturen ihren Niederschlag finden. Auch wenn die Realität nie völlig erfasst wird, kommt menschliches Wissen ständig zu neuen Erkenntnissen, was sich auf gesellschaftliche Veränderungen auswirkt.
Die Objektivität der Materie wird von den Konstruktivisten nicht in Frage gestellt, sie meinen jedoch, gesellschaftliche Prozesse seien nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden zu erfassen. Denn Menschen haben die Fähigkeit, über ihre Verhaltensweisen nachzudenken und im Verlauf dieses Prozesses anders als in der Vergangenheit zu handeln.
Viele Konstruktivisten benützen die von Max Weber gelehrte Methode des Verstehens. Sie verwerfen die These der Realisten, dass Gesetze menschlichen Verhaltens aus objektiven Sachverhalten zu entnehmen sind. Ebenso sehr grenzen sie sich von den Institutionalisten ab, die ihre Postulate der Evolution mit einer von der Vernunft diktierten Notwendigkeit begründen.
Dem Konstruktivismus wird vorgeworfen, dass er bloss ex-post erklärt, ohne künftige Entwicklungen zu prognostizieren. Das kümmert dessen Anhänger wenig, weil sie das weder tun wollen noch als “realistisch” erachten. Sie wollen bloss verstehen, wie sich gesellschaftliche Verhaltensmuster über individuell und kollektiv erlangte Einsichten verändern können.
Das macht die Attraktivität des Konstruktivismus in einer Zeit raschen Wandels aus. Dafür sei unter vielen anderen nur an zwei Beispiele erinnert:
- Bis weit in das 19. Jahrhundert wurde die Sklaverei von der “zivilisierten” Welt als normal betrachtet. Mit der von einem Einzelkämpfer bewirkten Kehrtwende in der britischen Hegemonialmacht ist sie in wenigen Jahrzehnten als völlig unakzeptabel empfunden worden.
- Die UNO-Charta unterstrich die Notwendigkeit der Achtung der Menschenrechte, bekräftigte aber gleichzeitig das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Immer mehr verstärkt sich jedoch die Ansicht, dass die Nichteinmischung bei massiven Verletzungen von Menschenrechten innerhalb eins Staates nicht mehr absolute Gültigkeit beanspruchen kann.
Praktisch zur gleichen Zeit wie der Konstruktivismus hat sich der Feminismus in der Theorie der internationalen Beziehungen etabliert. Er geht auf die Frauenbewegungen zurück, die schon seit mehr als einem Jahrhundert für ihre Gleichberechtigung gekämpft haben. Liberale Verfechterinnen glauben, dass man das über gesetzliche Anpassungen erreichen koenne. Marxistisch inspirierte Kolleginnen meinten, dafür müsste die kapitalistische Produktionsweise überwunden werden. Heute steht der Ansatz im Vordergrunde, wie geschlechtliche Rollen von strukturellen Machtfaktoren geprägt werden.
Es ist bezeichnend, dass Frauen, die sich mit internationalen Theorien beschäftigen, von der Friedensforschung und den Problemen der Armut ausgingen. Auf die Frage, wo sich Frauen in der internationalen Politik befinden, wurde mit gutem Grund geantwortet, dass diese mehrheitlich als billige Arbeitskräfte, als Prostituierte, als Flüchtlinge, im besten Fall als Diplomatenfrauen auftreten.
Häufig wird von feministischen Wissenschaftlerinnen das traditionelle Konzept militärischer Sicherheit kritisiert, das in ihren Augen auf männlichen Werten beruht. Die meisten von ihnen unterstützen begeistert das neue Konzept menschlicher Sicherheit, das sich nicht bloss der Sicherheit unter den Staaten widmet, sondern sich mit der Sicherheit der Menschen befasst, damit alle ein Leben “ free from fear and free from want” führen können.
Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen untersuchen Feministinnen auch unter dem Gesichtspunkt der internationalen Arbeitsteilung. Mit empirischen Fakten wird festgestellt, dass im Norden illegale Putzfrauen ausgebeutet werden, während die Textilindustrie in den Süden ausgewandert ist, wo auf die goldenen Hände arbeitswilliger und wenig organisierter Frauen zurückgegriffen werden kann.
Liegt der Anteil der Frauen unter “Staatsmännern” immer noch unter 20%, sind sie in nicht - gouvernementalen Organisationen deutlich stärker vertreten. Das entspricht dem Trend, dass sich Frauen auch auf nationaler Ebene zunächst auf soziale Berufe ausgerichtet haben.
Vieles befindet sich jedoch in rascher Bewegung. Bemerkenswert ist etwa, dass auf der Millenniums-Generalversammlung der UNO vom Jahre 2000 die mehrheitlich männlichen Staatenvertreter zur Einsicht gekommen sind, die Ausbildung der Frauen könnte sich als ein wirksames Mittel zur Überwindung der Armut erweisen.
Alle hier kurz gestreiften Theorien stammen vorwiegend aus der nördlichen Hemisphäre, von der das Phänomen der Globalisierung ausgegangen ist. Ihre selbst erklärte Fortschrittlichkeit wird in der südlichen Hemisphäre manchmal als eine neue Form intellektuellen Imperialismus empfunden. Mehr denn je ist aber auch der Süden gefordert, eigene Antworten auf die neuen Herausforderungen zu entwickeln, wenn er aus dem klassischen Feindbild fremdbestimmter Rückständigkeit herauskommen will.
5.3. Ethische Herausforderungen
Unter den Philosophen und Politikwissenschaftlern, die sich mit der Ethik in den internationalen Beziehungen befassen, haben sich zwei grosse Richtungen herausgebildet:
- Der Kommunitarismus, der sich auf die Tatsache stützt, dass es unter den Völkern unterschiedliche moralische Vorstellungen gibt. Erklärt wird das damit, dass Werte starke lokale Wurzeln haben. Für den Kommunitarismus haben lange Traditionen in den verschiedenen Gemeinschaften Normen eines spezifischen Gefühls der Zusammengehörigkeit herausgebildet. Der Einzelne verspürt gegenüber seinen Mitbürgern eine viel grössere Verbundenheit als gegenüber Angehörigen anderer Staaten. Es gibt keinen universalen Gemeinschaftssinn, mit dem die verschiedenen Wertsysteme unter einen Hut zu bringen waeren. Normen, die innerhalb staatlicher Gemeinschaften Gültigkeit haben, können nicht automatisch auf zwischenstaatliche Beziehungen übertragen werden. Weltweit ist nur eine dünne Schicht von Ethik möglich, die nicht darüber hinausgeht, als Toleranz zu üben, für friedliche Koexistenz zu sorgen und niemandem zu schaden. Das Postulat einer globalen Verteilungsgerechtigkeit ist in den Augen der Kommunitaristen illusionär. Selbst bei den Menschenrechten, die ihnen sehr am Herzen liegen, stehen sie externen Interventionen skeptisch gegenüber.
- Im Unterschied zu den Kommunitaristen sind die Kosmopoliten überzeugt, dass dem Menschen, wo immer er lebt, der gleiche Wert zukommt. Sie glauben an eine universale Gemeinschaft, in der jeder Mensch den Anspruch hat, nicht als Mittel, sondern als Ziel betrachtet zu werden. Dass es staatliche Grenzen gibt, wird nicht bestritten, aber ethisch als unerheblich betrachtet. Staatliche Gemeinschaften haben nur eine Berechtigung, wenn sie sich für das Wohl aller Individuen einsetzen. Lokal wie weltweit, individuell wie kollektiv gilt die Pflicht, jeden Menschen gleich zu behandeln. Eine der klassischen Definitionen des Kosmopolitismus geht auf Immanuel Kant zurück, der forderte, jeder Mensch habe sich so zu verhalten, dass er zu einem Beispiel für alle anderen werden kann.
- Die Utilitaristen, die ebenfalls zu den Kosmopoliten gehören, stellen mehr als Prinzipien die Konsequenzen menschlichen Verhaltens in den Vordergrund. Aber auch sie verlangen, dass damit stets zum grösstmöglichen Glück aller beizutragen ist. Weder Kantianer noch Utilitaristen setzen voraus, dass es zur Verwirklichung ihrer Postulate einen Weltstaat braucht.
In Westeuropa ist es nach dem zweiten Weltkrieg zu einer Entwicklung gekommen, die zwischen den verschiedenen Polen einen Mittelweg eingeschlagen hat. Auf dem gleichen Boden, wo die souveränen und kriegsfreudigen Nationalstaaten entstanden waren, suchten visionäre Politiker wie Schuman, de Gasperi und Adenauer nach konkreten Massnahmen, um die blutige Rivalität alter Erzfeinde zu überwinden.
Der erste Schritt war 1951 die Gründung der Kohle- und Stahlgemeinschaft, die zwei damals noch wichtige Elemente der Kriegsführung unter eine supranationale Behörde stellte. Auf ähnliche Weise wurde 1957 in den Römer Verträgen die zivile Nutzung der Atomenergie geregelt. Viel bedeutender war jedoch der Beschluss, mit dem Aufbau einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) zu beginnen.
Das Projekt erwies sich relativ schnell als erfolgreich. Die Abschaffung der Binnenzölle und die Errichtung einer gemeinsamen Aussenwirtschaftspolitik führten in den sechs Gründerstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien sowie den drei Benelux-Ländern) zu einer raschen Erholung der Industrieproduktion. Im Gegenzug musste eine nicht sehr marktfreundliche Agrarpolitik eingerichtet werden, die es jedoch erleichterte, die Organe des Integrationsprozesses mit eigenen Einnahmen zu versehen.
Zunächst fehlte in dem Bunde der Gründungsmitglieder unter den westeuropäischen Grossmächten das Vereinigte Königreich, das sich lange Zeit für das Gegenprojekt einer industriellen Freihandelszone eingesetzt hatte. Interne Schwierigkeiten und der Erfolg der EWG brachten aber 1973 Grossbritannien - zusammen mit Irland und Dänemark - in den kontinentalen Einigungsprozess.
Darauf ist es periodisch zu neuen Erweiterungen gekommen, in deren Verlauf sich die Zahl der Mitgliedstaaten auf 27 erhöht hat:
- 1981 wurde Griechenland aufgenommen, 1986 kamen Spanien und Portugal hinzu, drei Länder, die sich zunächst ihrer autoritären Regime entledigen mussten, bevor sie beitrittsfähig wurden;
- 1995 machten Schweden, Finnland und Österreich den Sprung, die lange wegen ihrer Neutralität gezögert hatten;
- 2004 sind in einem Schlag zehn neue Mitgliedstaaten hinzu gekommen, von denen neben den beiden Mittelmeerinseln Malta und Zypern acht aus dem ehemals kommunistischen Ostblock stammten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Ungarn).
- 2007 sind zwei weitere ehemalige Ostblockstaaten - Rumänien und Bulgarien - aufgenommen worden.
Obwohl immer wieder Krisen auftraten, hat sich die europäische Integration nicht nur numerisch, sondern auch materiell weiter entwickelt. Nach der Zollunion wurden in so unterschiedlichen Bereichen wie Verkehr, Energie, Umwelt, Forschung und Bildung neue Kompetenzen an die Brüsseler Behörden übertragen. Zu einem gewichtigen Fortschritt kam es 1987, als mit der Einheitsakte die Schaffung des Binnenmarktes beschlossen wurde. Von grosser Bedeutung war ebenfalls der 1992 abgeschlossene Vertrag von Maastricht, der
- schrittweise eine gemeinsamen Währung zu entwickeln begann;
- gleichzeitig eine verstärkte Koordination der Aussenpolitik und der Bereiche Justiz und Inneres einführte;
- mit der Umbenennung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in Europäische Union zum Ausdruck brachte, dass das Ziel der Integration ein politisches ist, was schon von den Gründungsvätern beabsichtigt worden war.
Die Europäische Union ist heute mehr als ein Staatenbund, aber noch kein Bundesstaat, wie es sich manche wünschen würden. Im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen weist sie jedoch deutlich mehr Elemente demokratischer Gewaltentrennung aus:
- die Kommission wirkt als Exekutive zur Durchführung gemeinsamer Beschluesse und verfügt über das Recht, Vorschläge für neue Vereinbarungen zu machen;
- die legislative Gewalt oblag zunächst nur den aus Regierungsvertretern zusammengesetzten Ministerräten, wird aber inzwischen immer mehr mit dem direkt gewählten Parlament geteilt;
- von Anfang an gab es einen Gerichtshof, der in letzter Instanz über die Interpretation der Verträge und des daraus abgeleiteten Sekundärrechts zu entscheiden hat.
Um die Integration neuer Mitglieder zu erleichtern, werden erhebliche Mittel zur Strukturförderung aufgewendet. Deren Erfolg ist so beachtlich, dass sich die EU zu einem Instrument grenzüberschreitender Verteilungsgerechtigkeit entwickelt hat.
Als mit den sukzessiven Erweiterungen die internen Entscheidungsmechanismen zu schwerfällig wurden, hat man sich 2007 in Lissabon auf neue Regeln geeinigt, um gemeinsame Souveränität effektiver, aber dennoch mit demokratischen Prinzipien und einer positiven Diskriminierung kleinerer Mitgliedstaaten zu verwalten:
- ab 2014 soll der Ministerrat in den meisten Bereichen mit doppelter Mehrheit entscheiden können, so dass eine Vorlage als angenommen gilt, wenn sie von 55% der Mitgliedstaaten, die zusammen 65% der EU-Bevölkerung ausmachen, unterstützt wird.
- dagegen werden kleinere Mitgliedstaaten im Europäischen Parlament weiterhin überproportional vertreten sein: Deutschland verfügt mit 82 Mio. Einwohnern über 99 Abgeordnete, also einem Abgeordneten pro 710 000 Einwohner, während Malta mit 400 000 Einwohnern 6 Abgeordnete hat, was einem Vertreter pro 66 000 Einwohner entspricht.
Das Bruttosozialprodukt der EU ist zum grössten der Welt geworden. Bei den Militärausgaben steht die EU nach den USA an zweiter Stelle, obwohl es sich dabei mehr um eine arithmetische Summe als um ein vereintes Machtpotential handelt.
Deshalb tritt die EU auf der Weltbühne vor allem mit “soft power” auf. Das ist weniger zu kritisieren als positiv anzuerkennen, denn dass es ehemals verfeindeten Staaten gelungen ist, untereinander eine permanente Friedenszone aufzubauen und gleichzeitig den Wohlstand zu fördern, sollte zur Nachahmung anspornen. Verschiedentlich wird das auch versucht, ein vergleichbarer Erfolg ist aber bisher keinen anderen Bemühungen gelungen.
Trotz periodischer Krisen ist das Modell der EU weiterhin als attraktives Rezept zu betrachten, um sich der heutigen Globalisierung zu stellen. Da zurzeit mehr als ein halbes Dutzend neuer Beitrittskandidaten vor der Türe stehen, hat jedoch die EU wenig Anlass, sich mit hegemonialen Methoden für die Verbreitung ihres Modells zu verwenden.
Nicht zuletzt wegen des Erfolges der EU ist unter Intellektuellen wieder die Diskussion über die Notwendigkeit eines Weltstaates aufgegriffen worden. Schon der um den Frieden besorgte Dante Alighieri hatte sich im ausgehenden Mittelalter für eine weltumspannende Herrschaft ausgesprochen, um die unsäglichen Leiden des Krieges zu vermeiden.
Immanuel Kant, der herausragende Begründer des Kosmopolitismus, der den Frieden als Postulat der Vernunft betrachtete, lehnte jedoch die Idee des Weltstaates ab. Für ihn war ein solcher schon aus praktischen Gründen nicht machbar, ausserdem befürchtete er, dass er zu despotischen Tendenzen zurueckkehren könnte, welche die Freiheit des Einzelnen wieder zunichte machen würde.
Indessen sind mit der Globalisierung selbst einige Kantianer zur Ansicht gekommen, ein minimaler Weltstaat würde sich heute rechtfertigen lassen. Unter minimal verstehen sie, dass diesem ausschliesslich das weltweite Gewaltmonopol, die Überwachung der Menschenrechte sowie die Lösung globaler Umweltproblem zukommen sollte. Für Themen der Wirtschaft und der sozialen Gerechtigkeit sollten der Markt und die zu erhaltenden staatlichen Gemeinschaften zuständig bleiben.
Schon lange bevor man von Globalisierung zu reden begann, hatte Papst Johannes XXIII. 1963 in seiner Enzyklika “Pacem in terris” geschrieben:
“ Da heute das allgemeine Wohl der Völker Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt betreffen, und da diese Fragen nur durch eine politische Gewalt geklärt werden können, deren Macht und Organisation und deren Mittel einen entsprechenden Umfang haben müssen, deren Wirksamkeit sich somit über den ganzen Erdkreis erstrecken muss, folgt um der sittlichen Ordnung zwingend, dass eine universalen politische Gewalt eingesetzt werden muss. Diese allgemeine politische Gewalt, deren Macht überall auf Erden Geltung haben soll und deren Mittel in geeigneter Weise zu einem universalen Gemeinwohl führen sollen, muss freilich durch Übereinkunft aller Völker und nicht mit Gewalt auferlegt werden”.
Dennoch ist nach wie vor kaum vorstellbar, dass selbst für einen minimalen Weltstaat eine freie Zustimmung zu finden wäre. Auch wenn für die Verhinderung des Krieges weitgehend Konsens besteht, ist das bei Themen wie Menschenrechten und Umweltschutz bei weitem nicht der Fall. Teilen die EU-Staaten die von ihnen erfundene Souveränität immer grosszügiger untereinander, bleiben Länder, die erst seit der Entkolonisierung unabhängig geworden sind, dem Konzept der Souveraenitaet stark verhaftet. Das gilt nicht zuletzt für jene, die wegen ihres wirtschaftlichen Erfolgs im Begriffe sind, sich zu künftigen Grossmächten zu entwickeln.
Kant glaubte, dank republikanischer Regierungsformen sollte es möglich sein, zu einem wachsenden Friedensbund unter den Staaten zu kommen. Nachdem die “wohlwollende” Hegemonie Amerikas fehlgeschlagen hat, propagieren heute einige Politiker und Ideologen, demokratische Staaten zu einem Konzert zusammenzuführen, um für die Lösung globaler Probleme die Führungskraft zu übernehmen.
Seit dem Fall der Berliner Mauer hat sich die Zahl der Demokratien in der Welt stark erhöht, macht aber unter nachhaltigen Kriterien immer noch kaum mehr als die Hälfte der UNO – Mitgliedstaaten aus. Selbst wenn grosse Mächte in allen Regionen des Südens den Kriterien der Nachhaltigkeit genügen - etwa Indien, Brasilien oder Südafrika -, ist von ihnen schwerlich zu erwarten, dass sie ein starkes Interesse verspüren, sich einem mehrheitlich westlich dominierten Bündnis anzuschliessen.
Sogar unter den alten Demokratien besteht noch wenig Konsens, wie die neuen, aus der Globalisierung entstandenen Probleme zu lösen sind. Das gilt sowohl für den Agrarhandel, die Umweltproblematik als auch für die Art und Weise, wie der internationale Terrorismus zu bekämpfen ist
Die Anhänger des Konzertes demokratischer Länder wollen zwar nicht die von ihnen als defizient empfundene UNO abschaffen, glauben aber, diese über ein wirksameres Vorgehen der Demokratien zu einem konstruktiven Wettbewerb herausfordern zu können.
Doch selbst bei einem so zentralen Thema wie der Demokratie haben westliche Staaten keine völlig weisse Weste vorzuweisen. Nur zu oft haben sie aus kurzfristigen Interessen autoritäre Regime unterstützt. Folglich ist von südlichen Demokratien, die sich in ihrer Umgebung mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen, nicht unbedingt zu erwarten, dass sie sich vorbehaltlos einem westlichen Kreuzzug zugunsten der Demokratie anschliessen können.
Demnach dürfte ein Verbund demokratischer Staaten, der die globale Führung zu übernehmen hätte, vorderhand zu mehr Problemen als zu Lösungen führen. Das bedeutet keineswegs, dass demokratische Staaten untereinander nicht enger zusammenarbeiten sollen und auch berechtigt sind, sich mit ihrer bilateralen und multilateralen Entwicklungshilfe für die Verbreitung ihres moralisch unbestrittenen Gedankengutes einzusetzen.
Denn Demokratie ist zweifelsohne ein universal gültiges Ideal, das jedoch nur mit der Kraft der Überzeugung verwirklicht werden kann. Solange das nicht vollständig erreicht ist, gilt es auch mit anderen graduell nach Verbesserungen der Zusammenarbeit zu suchen. Deshalb kommt man nicht um die Vereinten Nationen herum, in denen sowohl demokratische wie nicht-demokratische Staaten vertreten sind.
Trotz dem Versagen des Völkerbundes einigten sich die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges darauf, die Idee der kollektiven Sicherheit weiterzuführen. Nach dem Ausbruch des Kalten Krieges ist jedoch das Konzept wegen des Veto-Rechtes der Grossmächte lahm gelegt worden. Dennoch ist es der UNO gelungen, eine praktisch universale Mitgliedschaft zu erreichen.
Nach dem Ende des Kalten Krieges und der sich verbreitenden Globalisierung wird mehr denn je klar, dass die UNO dringender Reformen bedarf.
Das Veto-Recht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ist überholt. Zwar wollten die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs für die Erhaltung des Friedens stärkere Entscheidungsmechanismen schaffen und gleichzeitig Konflikte unter den Grossmächten vermeiden. Von den Inhabern dieses Privileges haben jedoch Frankreich und Grossbritannien ihre Grossmachtstellung verloren. Es ist mehr als legitim, dass andere den Anspruch auf eine ständige Vertretung im Sicherheitsrat erheben. Dass die alten Veto-Mächte dafür plädieren, neuen ständigen Mitgliedern kein Veto-Recht zu gewähren, bestätigt bloss, wie anachronistisch ihr Privileg geworden ist. Deshalb wäre es unter den heutigen Umständen angezeigt, die Zahl der ständigen Sitze von 5 auf 9 zu erhöhen, um im Sicherheitsrat eine Mehrheit der Weltbevölkerung und alle grossen Regionen der Welt zu vereinigen. 16 nicht ständige Sitze sollten garantieren, dass auch die Stimme kleinerer Länder zum Ausdruck kommt. Würde man für Beschlüsse eine qualifizierte Mehrheit verlangen, sollte zu erwarten sein, dass auf das undemokratische Veto-Recht verzichtet wird.
Da die kleineren Zwerge des Fünfer-Bundes nicht auf ihr Privileg verzichten wollen und jegliche Veränderung der UNO-Charta von ihrer Zustimmung abhängt, sollte man vermehrt wieder auf die Resolution “Uniting for Peace” zurückgreifenn, die 1950 während des Korea-Kriegs auf Betreiben der USA zustande kam. Weil die Sowjetunion damals den Sicherheitsrat boykottierte, einigte man sich darauf, dass bei Beschlussunfähigkeit des Sicherheitsrates die Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit zwar nicht bindende Entschlüsse fassen kann, jedoch befähigt ist, das Vorgehen einzelner Staaten zu legitimieren.
In der Generalversammlung verfügt jeder Staat über eine Stimme, was als sakrosanktes Prinzip der Gleichheit unter den Staaten gilt. Dennoch ist das nicht ohne Probleme, weil unter den heutigen Mitgliedstaaten enorme Bevölkerungsunterschiede bestehen. Die kleinsten unter ihnen kommen auf weniger als 30’000 Einwohner, während Indien ohne permanenten Sitz im Sicherheitsrat mehr als eine Milliarde zählt. Das ist einer der Gründe, warum die Generalversammlung nach wie vor über sehr bescheidene Befugnisse verfügt. Nur beim Budget und bei verschiedenen Wahlen kann sie verbindliche Entscheide treffen, daneben darf sie bloss Empfehlungen abgeben, was sie zwar ausgiebig macht, doch werden diese immer weniger zur Kenntnis genommen, weil sie wegen des Prinzips der offenen Abstimmung zu einer jährlich wieder kehrenden Routine verkommen sind.
Die Stimmen der Generalsversammlung nach Bevölkerungszahl oder Beitragszahlungen zu gewichten, scheint vorläufig ebenso illusorisch zu sein wie die Abschaffung des Veto-Rechtes im Sicherheitsrat. Deshalb wird von einigen vorgeschlagen, zur Verbesserung demokratischer Prinzipien in der UNO ein Zweikammersystem nach föderalem Muster einzurichten. Die bestehende Generalsversammlung würde weiterhin als “Ständekammer” nach dem Prinzip ein Staat eine Stimme funktionieren, sollte jedoch mit einer Versammlung nationaler Parlamentarier ergänzt werden, für deren Zusammensetzung proportionale Kriterien in Bezug auf Bevölkerungsgrösse zu berücksichtigen wären.
Die Idee ist verlockend, weil man beispielsweise die Vorbereitung internationaler Verträge der parlamentarischen Versammlung übertragen könnte, die anschliessend von der Generalversammlung an die Mitgliedstaaten zur Ratifikation zu überweisen wären. Das käme jenen Kritikern des Multilateralismus entgegen, die sich beklagen, ein Grossteil des internationalen Rechtes würde heute von Funktionären der Exekutive ausgehandelt, worauf den nationalen Legislativen nur die Möglichkeit übrig bleibe, die getroffenen Vereinbarungen entweder zu akzeptieren oder zurückzuweisen.
Dass die Zusammensetzung einer solchen parlamentarischen Versammlung mit einigem Kopfzerbrechen verbunden wäre, liegt auf der Hand. Völlig unlösbar sollte aber das Problem nicht sein, wenn man an das Beispiel des EU-Parlaments denkt. Sicher müsste jeder Mitgliedstaat Anrecht auf einen parlamentarischen Vertreter haben. Daneben könnten 1000 weitere Abgeordnete proportional nach der Bevölkerungsgrösse zugeteilt werden. Die Zahl mag unter dem Gesichtspunkt der Funktionstüchtigkeit bereits sehr hoch erscheinen, für ein realistisches Proporzsystem dürfte sie allerdings noch zu tief liegen.
Hatten die Gründungsväter der UNO als wichtigste Aufgabe die Friedenssicherung übertragen, waren sie sich jedoch bewusst, dass zur Erreichung dieses Ziels auch eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern ist. Bestehende und neu gegründete technische Organisationen wurden in das UNO-System integriert, von denen wichtige Dienste in einer immer mehr zusammen wachsenden Weltwirtschaft geleistet werden. Häufig funktionieren sie aber wie autonome Provinzen, in denen Vertreter des gleichen Staates unterschiedliche Positionen vertreten, weil sie aus anderen Fachministerien stammen.
Zwar hatte die UNO-Charta zur Koordination dieser Spezialorganisationen den Wirtschafts- und Sozialrat vorgesehen. Dieser vermochte jedoch seine Aufgabe nie wirksam wahrzunehmen. Ausserhalb der UNO entstanden informelle Gruppen wie die G-7 der Industriestaaten oder die G-77 der Entwicklungsländer, die mehr zur Polarisierung als zur Koordination beitrugen.
Seit der globalen Wirtschaftskrise von 2008 erscheinen diese Gruppen als völlig überholt. Deshalb hat man überstürzt die G-20 ins Leben gerufen, in der sowohl alte wie neue Weltwirtschaftsmächte vertreten sind. Anstatt informelle Gruppen zu vermehren, wäre es wohl vernünftiger gewesen, dem Wirtschafts- und Sozialrat der UNO die Kompetenz für eine effiziente Koordination zu übertragen, deren Notwendigkeit heute mehr denn je offenkundig ist.
In diesem sollten stets die 20 grössten Wirtschaftsmächte der Welt vertreten sein, ohne jemandem einen ständigen Sitz zu garantieren, wenn er die Voraussetzung nicht mehr erfüllt. 45 weitere Staaten hätten sich im Turnus abzulösen, um den übrigen Staaten eine Stimme zu verleihen. Die Erhöhung von 54 auf 65 Mitglieder ist mit der Zunahme der Mitgliedschaft der UNO, die seit 1945 erfolgt ist, ohne weiteres zu rechtfertigen.
Allerdings macht das nur einen Sinn, wenn diesem Gremium wirkliche Koordinationsbefugnisse über alle weltweiten Wirtschafts- und Sozialorganisationen übertragen werden. Namentlich müsste dies auch für den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die Welthandelsorganisation gelten, die noch heute ein weitgehend ein unabhängiges Eigenleben führen.
Schwierig ist nach wie vor die Frage der Menschenrechte, die bei der Gründung der UNO ebenfalls als notwendig für die Erhaltung des Friedens proklamiert wurden. Das heutige System überträgt deren weltweite Überwachung Regierungsvertreten, die sich mehrheitlich politische Grabenkämpfe liefern. Daran hat auch der neue Menschenrechtsrat, der zu einem Organ der UNO – Generalversammlung aufgewertet worden ist, nichts geändert.
Die Beachtung individueller Rechte sollte grundsätzlich unabhängigen Richtern übertragen werden. Dieses Prinzip ist von der europäischen Menschenrechtskonvention und den Mechanismen der Organisation Amerikanischer Staaten verwirklicht worden. Auch die Mitglieder der afrikanischen Union haben sich auf einen ähnlichen Weg begeben. Mit dem Internationalen Strafgerichtshof konnte eine weltweite, aber noch nicht universale Gerichtsbarkeit für schwere Verbrechen gegen die Menschheit geschaffen werden.
Zur Förderung der allgemeinen Menschenrechte sollte es in allen Teilen der Welt zunächst zu regionalen Überwachungsgerichten kommen, weil damit lokalen Sensibilitäten Rechnung getragen werden kann. Trotzdem bleibt das Ziel anzustreben, dass über den regionalen Instanzen eine universale Rekursmöglichkeit geschaffen wird.
Auch wenn die Globalisierung rasch voranschreitet, bleibt der Diskurs über die Notwendigkeit einer Weltregierung ein umstrittenes Ideal. Auf der Ebene der Praxis sind jedoch verschiedene Instrumente entstanden, mit denen ein horizontales Weltregieren auf immer neue Bereiche ausgedehnt wird. Dass es dieser polyzentrischen Architektur an Klarheit mangelt, liegt auf der Hand. Indessen verbreitet sich die Einsicht, dass mit dem klassischen Verständnis des Nationalstaates viele Probleme nicht mehr zu lösen sind.
Auf diesem Hintergrund ist vor allem zu fordern, dass Staaten weniger auf ihre Souveränität pochen, um kurzfristige Interessen durchzusetzen, sondern sich ihrer Verantwortung gegenüber dem weltweiten Gemeinwohl bewusst werden. Was der Föderalismus in einzelnen Staaten seit langem praktiziert - dass im Sinne der Subsidiarität möglichst viel lokal gelöst wird, dass aber das Notwendige nach oben delegiert wird - dürfte wohl die beste Richtschnur sein, die es gegenwärtig für ein dezentralisiertes, aber wirksames Weltregieren zu verfolgen gilt.
Der Einwand, dass das unter den heutigen Umständen nur über zwischenstaatliche Vereinbarungen möglich ist, die wegen eines fehlenden Gewaltmonopols auf höherer Stufe über keine wirksamen Sanktionsmöglichkeiten verfügen, ist durchaus ernst zu nehmen. Dennoch ist die Feststellung erlaubt, dass sich Staaten wegen ihrer gegenseitigen Abhängigkeit zunehmend - wenn auch nicht vollständig - an internationale Normen halten. Dazu tragen namentlich die immer einflussreicheren Nicht-Regierungsorganisationen bei, die Staaten unter Druck zu stellen vermögen, wenn sie ihren Ruf als gutes Mitglied der Weltgemeinschaft nicht verlieren wollen.
Literaturhinweise
Amstutz Mark R.., International Ethics, Rowman & Littlefield Publishers , Oxford, 2005 (second edition)
Atack Iain, The Ethics of Peace and War,Palgrave Macmillan, New York, 2005
Barry Bryan, Theories of Justice, University of California Press, Los Angeles, 1989
Baylis John, Smith Steve, Owens Patricia (ed), The Globalization of World Politics, Oxford University Press, Oxford, 2008 (fourth edition)
Beitz Charles, Political Theory and International Relations, Princeton University Press, Princeton, 1979
Bonanate Luigi, Etica e Politica Internazionale, Einaudi, Torino, 1992
Brown Chris, International Relations Theory, Columbia University Press, New York, 1992
Chwaszcza Christina & Kersting Wolfgang (Hrsg.), Politische Philosopie der internationalen Beziehungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1998
Colonomos Ariel, La morale das les relations internationales, Odile Jacob, Paris, 2005
Finnis John, Boyle Joseph, Grisez Germain, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, Oxford University Press, Oxford, 1987
Forsythe David P., Human Rights in Internationale Realations, Cambridge University Press, Cambridge, 2006
(second edition)
Frost Mervyn, Ethics in International Relations, a Constituive Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
Graham Gordon, Ethics and International Relations, Blackwell Publishing, Oxford, 2008 (second edition)
Held David, Democracy and the Global Order, Stanford University Press, Stanford California, 1995
Höffe Otfried, Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger, Politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung, Verlag C.H. Beck, München, 2004
Küng Hans, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, Piper Verlag, München, 1997
Küng Hans & Senghaas Dieter (Hg.), Friedenspolitik, Ethische Grundlagen Internationaler Beziehunegn, Piper Verlag, München, 2003
Meier Gerald M., Rauch James E., Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press, New York, 2005 (eigth edition)
Müller Harald, Wie kann eine neue Weltordnung aussehen?, Wege in eine nachhaltige Politik, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2008
Nardin Terry, Mapel David (eds), Traditions of International Ethics, Cambridge Uinversity Press, 1992
Niggli Peter, Der Streit um die Entwicklungshilfe, Rotpunktverlag, Zürich, 2008
Pogge Thomas, World Poverty and Human Rights, Polity Press, Cambridge, 2008 (second edition)
Rawls John, The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge, 1999
Walzer Michael, Just and Unjust Wars, Basic Books, New York, 2006 (fourth edition)
Wolf Klaus Dieter, Die Uno: Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, Verlag C.H. Beck, München, 2005
[...]
[1] Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, New York, Random House, 1979
[2] Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, New York, Alfred A. Knopf, 1948
[3] Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, New York, C. Scribners Son, 1932
[4] Edward H. Carr, The Twenty Years´Crisis, New York, Harper and Row, 1946
[5] John Rawls, A Theroy of Justice, Oxford University Press, Oxford 1971
[6] Dorothy V. Jones, The Declaratory Tradition in Modern International Law, in Terry Nardin & David R. Mapel ed., Traditions of International Ethics, Cambridge University Press, 1992
[7] Mervyn Frost, Ethics in International Relations, a Constitutive Theory, Cambridge University Press, 1996
[8] Michael Walzer, Just and Unjust Wars, Basic Books, New York, 1977
[9] Kenneth N. Waltz, The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better, Adelphi Paper 171, London, International Institute for Strategic Studies, 1981
[10] Commission Internationale de l`Intervention et de la Souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, Centre de recherche pour le développement international, Ottawa, 2001
[11] Hans Küng, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, Piper Verlag GmbH, München, 1997
[12] Peter Singer, Famine, affluence and morality, Philosophy and Public Affairs, vol. 1, no.3.
[13] Onora O Neill, Faces of Hunger: An essay on poverty, justice and development, Allen and Unwin, London, 1986
[14] James Tobin, A Proposal for International Monetary Reform, Eastern Economic Journal, Nr 4, 1978, S. 153 - 159
[15] Thomas W. Pogge, “Eine globale Rohstoffdividende“, Analyse & Kritik Nr. 17, 1995, S. 183 - 208, reproduziert in Christine Chawszcza und Wolfgang Kersting, Hrsg., Politische Philosophie der internationalen Beziehungen, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1998
[16] John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1971.
[17] Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations, Princeton University Press, Princeton, 1979
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt das Dokument "Sprachvorschau"?
Das Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert Themen in strukturierter und professioneller Weise, wobei die Texte von einer Verlagsfirma stammen und OCR-Daten enthalten, die ausschließlich für akademische Zwecke gedacht sind.
Welche Hauptthemen werden im Inhaltsverzeichnis aufgeführt?
Die Hauptthemen im Inhaltsverzeichnis sind:
- Unterschiedliche Meinungen (Skeptiker, Befürworter, Praktiker)
- Krieg und Frieden (Tradition des gerechten Krieges, Heutige Situation, Nukleare Abschreckung, Selbstbestimmung der Völker, Humanitäre Interventionen, Terrorismus)
- Menschenrechte (Historische Wurzeln, Praktische Verwirklichung, Schwierige Umsetzung)
- Soziale Gerechtigkeit (Arme und Reiche, Theorien und Strategien, Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung, Vorschläge für alternative Finanzierungsmechanismen, Postulate für eine neue Weltwirtschaftsordnung)
- Globales Regieren (Veränderungen der letzten Jahrzehnte, Wenig einstimmige Antworten, Ethische Herausforderungen)
Was sind die grundlegenden Prämissen der Realisten in der internationalen Politik?
Die grundlegenden Prämissen der Realisten sind:
- Menschen sind selbstsüchtig und stets bereit, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
- Innerhalb des Staates konnte der individuelle Egoismus gezügelt werden, in den Beziehungen unter den Staaten bleibt er aber bestehen.
- Zwischen den Staaten herrscht Anarchie, so dass sich jeder selber behaupten muss.
- Anarchie bedeutet nicht, dass ständig Krieg herrscht, dieser kann aber jederzeit ausbrechen, weil es keine oberste Gewalt gibt, um Auseinandersetzungen zu schlichten.
Wer sind einige der Vordenker des Realismus, die im Text genannt werden?
Einige der Vordenker des Realismus, die im Text genannt werden, sind:
- Thukydides
- Niccolò Machiavelli
- Thomas Hobbes
- Hans J. Morgenthau
- Reinhold Niebuhr
- Edward H. Carr
Welche Kritik wird am Realismus geübt?
Der Realismus wird dafür kritisiert, dass seine konstante Fixierung auf die "unveränderlichen" Gesetze der Machtpolitik als zu kurz empfunden wird und dass die Forschung an der Realität vorbeiarbeitet.
Was sind die drei Bedingungen, unter denen ein Krieg für die christliche Moral nicht als Sünde zu betrachten ist (gemäss Thomas von Aquin)?
Die drei Bedingungen sind:
- iusta causa: ein Krieg ist nur gerecht, wenn er begangenes Unrecht ahndet.
- recta intentio: ein Krieg darf keine andere Absicht verfolgen, als Gerechtigkeit und Frieden wiederherzustellen.
- legitima potestas: allein die staatliche Obrigkeit ist befugt, zu einem Kriege aufzurufen.
Was sind die wesentlichen Elemente des "legalistischen Paradigmas" nach Michael Walzer?
Die wesentlichen Elemente sind:
- Es gibt eine internationale Gemeinschaft, die aus unabhängigen Staaten besteht.
- Diese haben sich auf eine Rechtsordnung geeinigt, die den Anspruch auf territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit garantiert.
- Sowohl die Anwendung als auch die Androhung militärischer Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates ist eine unerlaubte Aggression.
- Tritt ein solcher Tatbestand ein, sind individuelle Selbstverteidigung und gemeinsames Vorgehen mehrerer Staaten gegen den Aggressor erlaubt.
- Nur der Akt einer Aggression kann den Krieg rechtfertigen.
- Wird der Aggressor besiegt, darf er angemessen bestraft werden, um die Wiederholung solcher Aktionen zu vermeiden.
Welche Prinzipien liegen dem Atomsperrvertrag von 1968 zugrunde?
Die Prinzipien sind:
- Zum Besitz von Nuklearwaffen sind nur jene fünf Staaten berechtigt, die am 1.1. 1967 einen erfolgreichen Test durchgeführt hatten (USA, UdSSR, UK, Frankreich und China).
- Die übrigen Vertragsparteien verzichten auf den Erwerb und die Entwicklung von Nuklearwaffen.
- Die Nicht-Nuklearstatten sollen für die zivile Nutzung der Atomenergie technologisch unterstützt werden.
- Die Nuklearmächte verpflichten sich, in "naher Zukunft" Verhandlungen über die Beendigung des Wettrüstens und die Abrüstung nuklearer Waffen aufzunehmen.
Welche Kriterien schlug die Kommission für extreme Fälle vor, um eine humanitäre Intervention zu rechtfertigen?
Die Kommission schlug Kriterien vor, die sich auf die Theorie des gerechten Krieges stützen:
- Die Verantwortung, Menschenleben zu schützen, ist primär Aufgabe des Staates. Ist ein Staat nicht willens oder fähig, diese Aufgabe zu erfüllen, geht die Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft über.
- Das Prinzip der Nichteinmischung ist nicht mehr zu halten, wenn Menschen aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen im grossen Ausmass umgebracht werden oder eine imminente Gefahr dafür besteht.
- Bei Interventionen in einem solchen Staat darf kein anderes Ziel verfolgt werden, als das Leiden der betroffenen Bevölkerung zu beenden.
- Der Rückgriff auf militärische Aktionen ist nur gestattet, wenn vorher alle Mittel für eine gewaltlose Lösung ausgeschöpft worden sind.
- Eine militärische Aktion hat sich strikte auf das zu beschränken, was zum Schutz von Menschenleben notwendig ist.
- Sie darf nur begonnen werden, wenn eine Aussicht auf Erfolg besteht.
Was sind die Kriterien, die im Text genannt werden, um zu bestimmen, wann terroristische Aktionen als zulässig gelten?
- Seitens einer Regierung schweres Unrecht begangen wird (“iusta causa”).
- Vorher alle Bemühungen für eine friedliche Lösung unternommen worden sind (“ultima ratio”).
- Nur gegen Ziele vorgegangen wird, die unmittelbar für das Unrecht verantwortlich sind (kein wahlloses Vorgehen gegen Unbeteiligte).
- Man sich bei den Mitteln darauf beschränkt, was zur Beseitigung des Unrechts notwendig ist und eine minimale Aussicht auf Erfolg besteht.
Welche historischen Wurzeln der Menschenrechte werden im Text diskutiert?
Griechische Antike (Stoa), Christentum, spanische Spätscholastik, Aufklärung.Welche Millenniumsziele wurden im Jahr 2000 von der UNO festgelegt?
Die Millenniumsziele sind im Text genannt. Das Ziel der Text war es diese bis zum Jahr 2015 durch gemeinsame Anstrengungen zu erreichen- Halbierung der Armut und Hunger.
- Grundschulbildung für alle Kinder.
- Gleichstellung der Geschlechter in der Bildung.
- Senkung der Kindersterblichkeit.
- Verbesserung der Müttergesundheit.
- Bekämpfung von Krankheiten wie Aids und Malaria.
- Nachhaltige Wasserversorgung.
- Globale Partnerschaften für Entwicklung.
- Citar trabajo
- Armin Ritz (Autor), 2012, Ethik und internationale Politik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197193