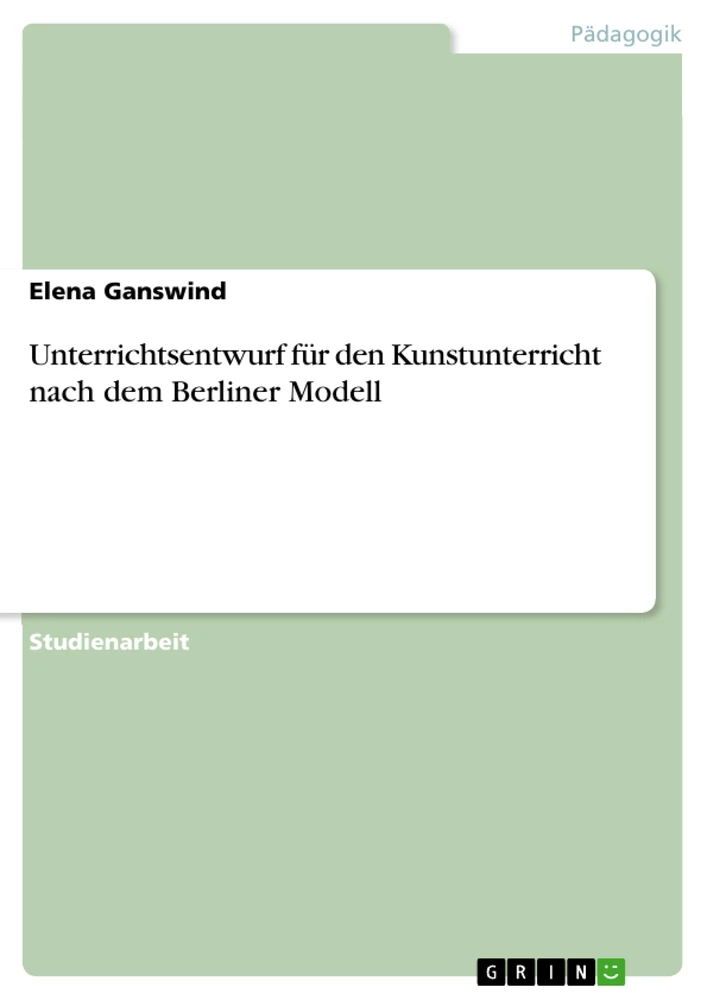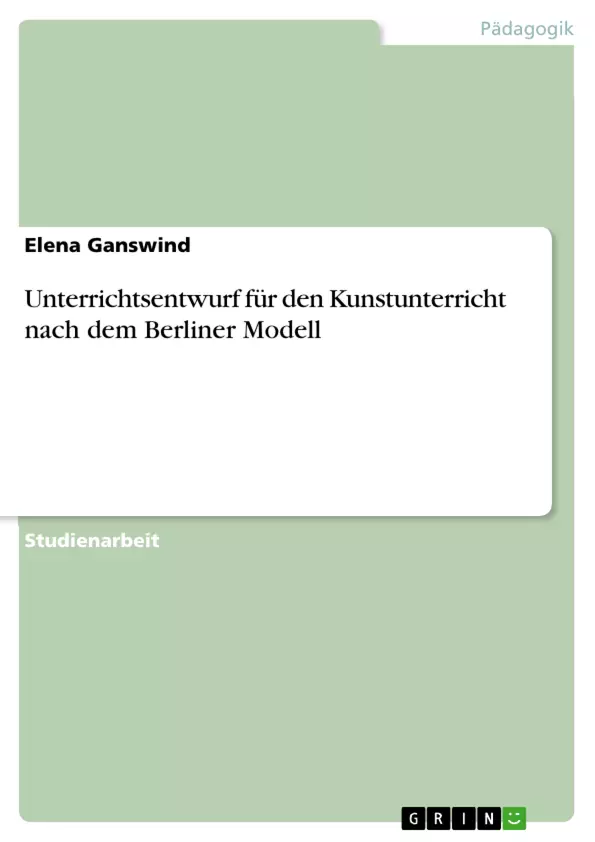Ein Unterrichtsentwurf in Anlehnung an das Berliner Modell für den Kunstunterricht für das Thema: Zeichnerische Gestaltung eines Zwei- Phasen- Tricks.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte und Entstehungsanlass
- Das Berliner Modell
- Strukturanalyse
- Faktoranalyse
- Die Weiterentwicklung zum Hamburger Modell
- Unterrichtsplanung für den Kunstunterricht im Sinne des Berliner Modells - Zeichnerische Gestaltung eines Zwei-Phasen-Tricks
- Bedingungsanalyse
- Soziokulturelle Voraussetzungen
- Anthropogene Voraussetzungen
- Strukturanalyse
- Intentionalität
- Thematik
- Methodik
- Medienwahl
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Bedingungsanalyse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Berliner Modell der Unterrichtsplanung. Ziel ist es, dieses Modell zu erläutern, seine Anwendung anhand eines Beispiels aus dem Kunstunterricht zu demonstrieren und Vor- und Nachteile kritisch zu reflektieren. Die Arbeit verzichtet dabei auf die Behauptung der Absolutheit dieses Modells und dient als exemplarische Anwendung eines ausgewählten Ansatzes.
- Das Berliner Modell der Unterrichtsplanung
- Anwendung des Modells in der Praxis (Kunstunterricht)
- Analyse der Struktur- und Faktoranalyse des Berliner Modells
- Vergleich impliziter und expliziter Ziele im Unterricht
- Reflexion der Vor- und Nachteile des Berliner Modells
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Unterrichtsplanung ein und stellt die zentrale Frage nach geeigneten Modellen und Strategien. Die Autorin begründet ihre Wahl des Berliner Modells und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont den exemplarischen Charakter ihrer Anwendung und vermeidet absolute Wertungen des Modells. Der Bezug auf Bertolt Brecht unterstreicht den komplexen und oft widersprüchlichen Charakter von Planungsprozessen.
Entstehungsgeschichte und Entstehungsanlass: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Berliner Modells in den 1960er Jahren durch Heimann, Otto und Schulz als Reaktion auf die Praxisferne des damaligen Lehramtsstudiums. Es wird die Kritik an Klafkis bildungstheoretischem Modell und die Forderung nach Integration praktischen Handelns in die Ausbildung hervorgehoben. Die Einführung des "Didaktikums" an der Pädagogischen Hochschule Berlin wird als wichtiger Kontextfaktor dargestellt.
Das Berliner Modell: Dieses Kapitel beschreibt das Berliner Modell als ein erfahrungswissenschaftliches Didaktikmodell, das die umfassende Analyse der Unterrichtswirklichkeit anstrebt. Es gliedert sich in Struktur- und Faktoranalyse. Die Strukturanalyse beinhaltet Entscheidungsfelder (Intentionalität, Thematik, Methodik, Medien) und Bedingungsfelder (soziokulturelle und anthropogene Voraussetzungen). Die Bedeutung der Berücksichtigung aller Felder für erfolgreichen Unterricht wird betont, mit detaillierter Erläuterung der verschiedenen methodischen Kategorien nach Heimann.
Schlüsselwörter
Berliner Modell, Unterrichtsplanung, Didaktik, Strukturanalyse, Faktoranalyse, Methodik, Intentionalität, Thematik, Medienwahl, Erfahrungswissenschaft, Unterrichtswirklichkeit, praktisches Handeln, theoretisches Wissen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Berliner Modell der Unterrichtsplanung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Berliner Modell der Unterrichtsplanung. Sie erläutert das Modell, demonstriert seine Anwendung anhand eines Beispiels aus dem Kunstunterricht und reflektiert kritisch dessen Vor- und Nachteile. Der Fokus liegt auf einer exemplarischen Anwendung, ohne den Anspruch auf Absolutheit des Modells zu erheben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entstehungsgeschichte und Entstehungsanlass des Berliner Modells, Das Berliner Modell (inkl. Struktur- und Faktoranalyse), Die Weiterentwicklung zum Hamburger Modell, Unterrichtsplanung für den Kunstunterricht im Sinne des Berliner Modells (inkl. Bedingungsanalyse, Strukturanalyse und geplantem Unterrichtsverlauf) und Reflexion.
Was sind die Ziele und Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Berliner Modell zu erläutern und seine praktische Anwendung im Kunstunterricht zu zeigen. Weitere Schwerpunkte sind die Analyse der Struktur- und Faktoranalyse des Modells, der Vergleich impliziter und expliziter Unterrichtsziele und die Reflexion der Vor- und Nachteile des Berliner Modells.
Was ist das Berliner Modell der Unterrichtsplanung?
Das Berliner Modell ist ein erfahrungswissenschaftliches Didaktikmodell, das eine umfassende Analyse der Unterrichtswirklichkeit anstrebt. Es besteht aus einer Strukturanalyse (Entscheidungsfelder: Intentionalität, Thematik, Methodik, Medien) und einer Faktoranalyse (Bedingungsfelder: soziokulturelle und anthropogene Voraussetzungen). Die Berücksichtigung aller Felder ist für erfolgreichen Unterricht entscheidend.
Wie wird das Berliner Modell im Kunstunterricht angewendet?
Die Arbeit demonstriert die Anwendung des Berliner Modells anhand eines Beispiels aus dem Kunstunterricht, inklusive einer detaillierten Bedingungs- und Strukturanalyse sowie der Planung des Unterrichtsverlaufs für einen "Zwei-Phasen-Trick".
Welche Kritikpunkte werden am Berliner Modell geäußert?
Die Arbeit reflektiert kritisch die Vor- und Nachteile des Berliner Modells, ohne jedoch eine definitive Bewertung abzugeben. Der exemplarische Charakter der Anwendung soll Raum für eigene Interpretationen und Weiterentwicklungen lassen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Berliner Modell, Unterrichtsplanung, Didaktik, Strukturanalyse, Faktoranalyse, Methodik, Intentionalität, Thematik, Medienwahl, Erfahrungswissenschaft, Unterrichtswirklichkeit, praktisches Handeln, theoretisches Wissen.
Was ist die Entstehungsgeschichte des Berliner Modells?
Das Berliner Modell entstand in den 1960er Jahren als Reaktion auf die Praxisferne des damaligen Lehramtsstudiums. Heimann, Otto und Schulz entwickelten es als Alternative zu Klafkis bildungstheoretischem Modell, um praktisches Handeln stärker in die Ausbildung zu integrieren. Die Einführung des "Didaktikums" an der Pädagogischen Hochschule Berlin spielte dabei eine wichtige Rolle.
Welche Methoden werden im Rahmen des Berliner Modells eingesetzt?
Das Berliner Modell verwendet die Struktur- und Faktoranalyse. Die Strukturanalyse beinhaltet die Analyse von Intentionalität, Thematik, Methodik und Medienwahl. Die Faktoranalyse betrachtet soziokulturelle und anthropogene Voraussetzungen. Die detaillierte Beschreibung der methodischen Kategorien nach Heimann wird ebenfalls behandelt.
- Citation du texte
- Elena Ganswind (Auteur), 2010, Unterrichtsentwurf für den Kunstunterricht nach dem Berliner Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196195