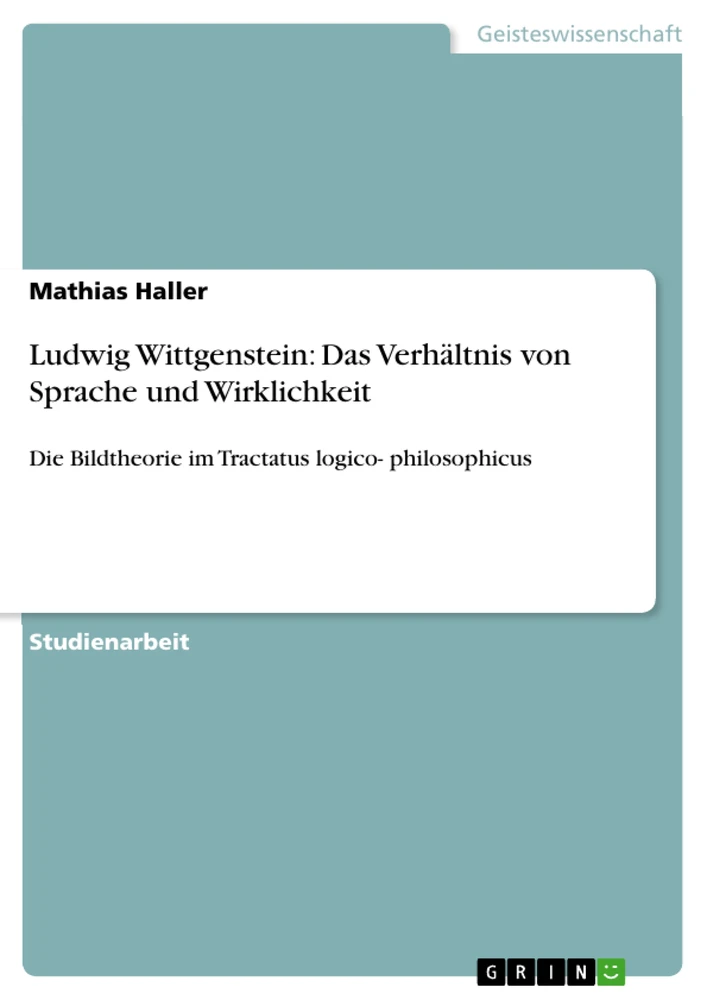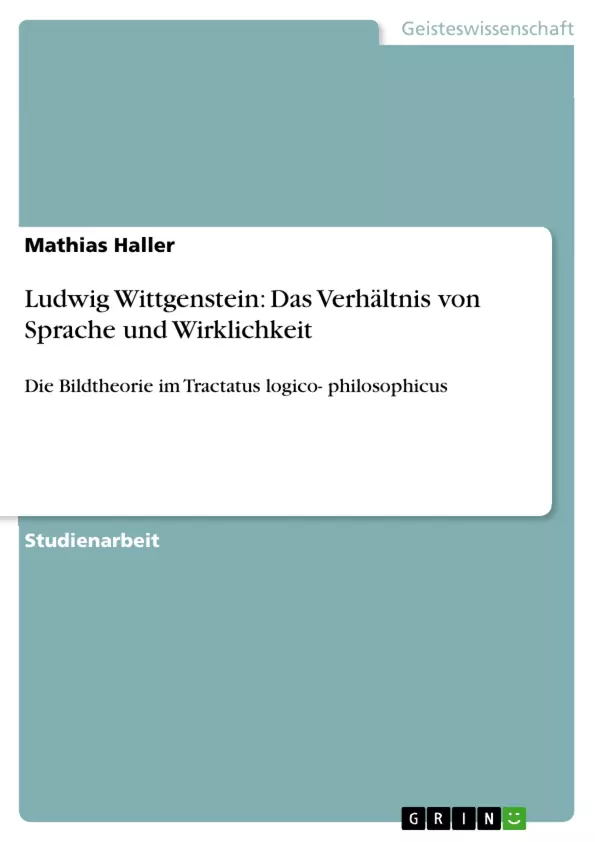Das erste und zu Lebzeiten Ludwig Wittgensteins einzige veröffentlichte Buch, der Tractatus logico-philosophicus (TLP) ist bis heute einer der meistdiskutierten Texte der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Der Grund dafür ist die Dichte, in der die weitreichenden Gedanken im Tractatus entwickelt werden und den Interpreten bis heute einige Rätsel aufgeben. So bemerkt beispielsweise Kampits: „Man kann die knapp 100 Seiten [...] dieses Buches an einem Nachmittag lesen und zugleich Jahre darüber grübeln, ohne sie völlig verstanden zu haben.“ (Kampits 1985, S. 54). Diese Feststellung gilt selbst für einzelne Teile des Buches. Im besonderen Massen gilt sie für die Bildtheorie, die von vielen Autoren als „Kern“ des Tractatus angesehen wird (vgl. Bezzel 1989, S. 65). Die Bildtheorie hat einen zentralen Stellenwert, weil sie grundlegend unseren Zugang zur Welt, der gemäss Wittgenstein nur mittels Zeichen möglich ist, beschreibt. In ihrer Anwendung auf Sätze erklärt die Bildtheorie das Verhältnis zwischen der Sprache und der Wirklichkeit.
In dieser Arbeit soll ausgehend von einer Textstelle, die Wittgenstein als seinen Grundgedanken bezeichnet, die allgemeine Bildtheorie erläutert werden. Dabei wird auf die Form der Abbildung und die abbildende Beziehung besonderes Augenmerk gerichtet. Sie sind sozusagen die „Säulen, auf denen die Bildtheorie ruht.“ (Ammereller 2001, S. 116). Im weiteren Verlauf wird Wittgensteins Übertragung der Bildtheorie auf Sätze rekonstruiert, um im nächsten Schritt die Leistungen der Bildtheorie als Semantiktheorie untersuchen zu können. Im letzten Teil soll ein hauptsächlicher Kritikpunkt an der Bildtheorie zur Sprache kommen. Es ist die selbständige Interpretierbarkeit von Bildern.
Die Arbeit hat grundsätzlich den Anspruch einer textnahen Lektüre der einschlägigen Passagen im Tractatus. Jedoch sollen die im Tractatus vorgestellten Gedanken zur Bildtheorie dann in den Kontext von Einträgen aus Wittgensteins Tagebüchern der Jahre 1914 bis 1916 (TB) gestellt werden, wenn dies für das Verständnis einzelner Aspekte der Theorie hilfreich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der „,Grundgedanke“
- Die Form der Abbildung
- Die abbildende Beziehung
- Der Satz als Bild
- Leistungen der Bildtheorie als Semantiktheorie
- Kritik an der Bildtheorie
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bildtheorie Ludwig Wittgensteins, die im Tractatus logico-philosophicus (TLP) dargelegt wird, zu erläutern und zu analysieren. Dabei wird auf die Form der Abbildung, die abbildende Beziehung und die Anwendung der Bildtheorie auf Sätze fokussiert.
- Die „Vertretung von Gegenständen durch Zeichen“ als Grundgedanke der Bildtheorie
- Die Form der Abbildung als notwendige Gemeinsamkeit zwischen Bild und Abgebildetem
- Die Beziehung zwischen Bild und Abgebildetem in Bezug auf die „Art und Weise“ der Darstellung
- Die Funktion des Satzes als Bild in Wittgensteins Theorie
- Die Leistungen der Bildtheorie als Semantiktheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in den Tractatus logico-philosophicus ein und erklärt die Relevanz der Bildtheorie im Kontext des Werks. Das Kapitel „Der ‚Grundgedanke‘“ erläutert das zentrale Prinzip der „Vertretung von Gegenständen durch Zeichen“ und stellt die Bedeutung der Bildtheorie im Allgemeinen dar. Im Kapitel „Die Form der Abbildung“ wird die notwendige Gemeinsamkeit zwischen Bild und Abgebildetem, die „Form der Abbildung“, analysiert. Die „abbildende Beziehung“ wird im nächsten Kapitel betrachtet, wobei die verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung und die Funktion des Bildes als „Modell“ der Wirklichkeit im Mittelpunkt stehen. Das Kapitel „Der Satz als Bild“ beschäftigt sich mit der Anwendung der Bildtheorie auf Sätze, um das Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit zu erklären. Schließlich werden im Kapitel „Leistungen der Bildtheorie als Semantiktheorie“ die Stärken der Bildtheorie als Theorie der Bedeutung untersucht. Die Arbeit vermeidet eine detaillierte Darstellung des Abschnitts „Kritik an der Bildtheorie“ sowie des „Schlussworts“, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Tractatus logico-philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Bildtheorie, Form der Abbildung, abbildende Beziehung, Satz als Bild, Semantik, Sprache, Wirklichkeit, Gegenstände, Zeichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Wittgensteins Bildtheorie?
Der Kern ist die Vorstellung, dass wir uns Bilder der Tatsachen machen. Ein Bild ist ein Modell der Wirklichkeit, in dem Zeichen (Elemente) die Gegenstände der Welt vertreten.
Was versteht Wittgenstein unter der „Form der Abbildung“?
Die Form der Abbildung ist die notwendige Gemeinsamkeit, die das Bild mit dem Abgebildeten teilen muss, damit es die Wirklichkeit überhaupt richtig oder falsch darstellen kann.
Inwiefern ist ein Satz ein Bild?
Laut Wittgenstein ist der Satz ein Bild der Wirklichkeit, weil er eine logische Struktur aufweist, die der Struktur der Tatsachen in der Welt entspricht.
Welches Verhältnis besteht zwischen Sprache und Wirklichkeit?
Sprache bildet die Wirklichkeit ab. Die Grenzen der Sprache bedeuten dabei die Grenzen der Welt, da wir nur über das sprechen können, was sich logisch abbilden lässt.
Welche Kritik gibt es an der Bildtheorie?
Ein Hauptkritikpunkt ist die Frage der selbstständigen Interpretierbarkeit von Bildern und die spätere Erkenntnis Wittgensteins, dass Sprache vielfältigere Funktionen als nur das Abbilden von Tatsachen hat.
- Citar trabajo
- Mathias Haller (Autor), 2010, Ludwig Wittgenstein: Das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195855