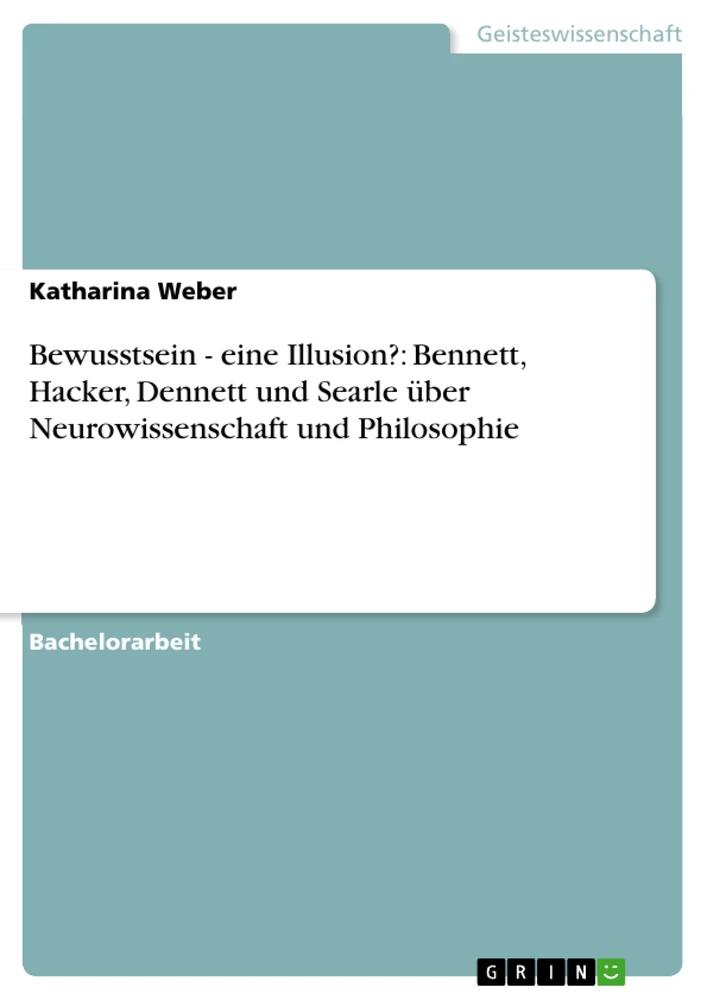Kann das Gehirn denken ‒ oder ist es die Person als Ganzes, die denkt? Was macht Bewusstsein aus, und welche Bedeutung spielen Gefühle in diesem Zusammenhang? Welche Sprachverwendung ist die richtige, um sich dem Phänomen Bewusstsein angemessen zu nähern? Zwischen diesen und vielen anderen Fragestellungen oszilliert die Debatte in dem Buch "Neurowissenschaften und Philosophie ‒ Geist, Gehirn und Sprache". Drei renommierte Philosophen und ein namhafter Neurowissenschaftler ringen darin um die besten Argumente für ihre Theorie über das menschliche Bewusstsein.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll nun eine Analyse der Buches "Neurowissenschaften und Philosophie ‒ Geist, Gehirn und Sprache" sein. Die Argumente der Autoren Bennett, Hacker, Dennett und Searle sollen nachgezeichnet werden und Parallelen und Differenzen herausgearbeitet werden. Zu beachten ist dabei, dass hinter den Thesen jedes Autors eine autarke komplexe Theorie steht. Jede dieser Theorien von Grund auf detailliert darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, mit Verkürzungen und Vereinfachungen muss daher stellenweise vorlieb genommen werden. Da die Argumentationen
der vier behandelten Autoren und deren neurowissenschaftliche und philosophische Forschung ein derart ausgedehntes Feld umfasst ‒ von Sprachphilosophie, über Neuroanatomie und Künstliche-Intelligenz-Forschung bis hin zur Evolutionstheorie ‒, wird bei der vorliegenden Arbeit kein Anspruch auf Vollständigkeit bei der Darstellung
der Argumente erhoben. Vielmehr sollen die von Bennett und Hacker gelieferten Stichworte als Aufhänger dienen, die Positionen der widerstreitenden Parteien nachzuvollziehen und anhand dieser Thesen tiefer zu ihren grundlegenden Annahmen vorzudringen.
Die zentralen Stichworte von "Neurowissenschaft und Philosophie ‒ Geist, Gehirn und Sprache", auf welche sich die vorliegende Arbeit konzentrieren soll, lauten "Psychologische Prädikate", "Mereologischer Fehlschluss" und "Qualia". Ihnen ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem die Positionen der verschiedenen Autoren dargestellt werden. Am Ende eines jeden Kapitels soll eine kurze Zusammenfassung das Kapitel abschließen, ein Resümee soll einen Überblick über die erarbeiteten Ergebnisse verschaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychologische Prädikate
- Bennett und Hacker über psychologische Prädikate
- Psychologische Prädikate als Homonyme
- Psychologische Prädikate als Analogien
- Psychologische Prädikate als Metaphern
- Fazit
- Searle über psychologische Prädikate
- Dennett über psychologische Prädikate
- Fazit
- Bennett und Hacker über psychologische Prädikate
- Der mereologische Fehlschluss
- Searle vs. Bennett und Hacker
- Dennett vs. Bennett und Hacker
- Fazit
- Qualia
- Bennett und Hacker
- perception vs. sensation
- Searle --- Qualia A Bewusstsein
- Dennett
- Fazit
- Bennett und Hacker
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Buch "Neurowissenschaften und Philosophie - Geist, Gehirn und Sprache". Sie verfolgt das Ziel, die Argumente der Autoren Bennett, Hacker, Dennett und Searle nachzuzeichnen und Parallelen sowie Unterschiede in ihren Positionen herauszuarbeiten. Dabei wird die Komplexität jeder Theorie angesprochen, wobei Vereinfachungen aufgrund des begrenzten Rahmens unvermeidlich sind. Das Buch befasst sich mit einem weiten Feld, von Sprachphilosophie bis hin zur Neuroanatomie und Künstlichen Intelligenz, weshalb die Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Analyse konzentriert sich auf die zentralen Themen "Psychologische Prädikate", "Mereologischer Fehlschluss" und "Qualia".
- Psychologische Prädikate und ihre Anwendung auf Gehirn und Person
- Der mereologische Fehlschluss und seine Relevanz für die Philosophie des Geistes
- Die Natur von Qualia und deren Rolle im Bewusstsein
- Die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren auf das Verhältnis von Geist und Gehirn
- Die Kritik an der neurowissenschaftlichen Sprachpraxis und deren Auswirkungen auf die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich den "Psychologischen Prädikaten". Es werden die verschiedenen Ansätze von Bennett, Hacker, Searle und Dennett zur Charakterisierung von mentalen Zuständen beleuchtet. Dabei werden die Argumente für und gegen die Anwendung psychologischer Prädikate auf nicht-personale Entitäten wie Gehirne oder Computer diskutiert.
Im zweiten Kapitel geht es um den "Mereologischen Fehlschluss", der besagt, dass man aus der Tatsache, dass ein Teil eines Ganzen eine bestimmte Eigenschaft besitzt, nicht schließen kann, dass das Ganze diese Eigenschaft ebenfalls besitzt. Die unterschiedlichen Perspektiven von Searle, Bennett und Hacker auf diese Argumentation werden vorgestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit "Qualia", den subjektiven Erlebnisinhalten des Bewusstseins. Die Positionen von Bennett und Hacker, Searle und Dennett werden im Hinblick auf die Natur und Bedeutung von Qualia analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Psychologische Prädikate, Mereologischer Fehlschluss, Qualia, Bewusstsein, Geist, Gehirn, Sprache, Neurowissenschaften, Philosophie, Bennett, Hacker, Searle, Dennett.
Häufig gestellte Fragen
Welche Philosophen und Wissenschaftler stehen im Zentrum dieser Analyse?
Die Arbeit analysiert die Positionen von Max Bennett, Peter Hacker, Daniel Dennett und John Searle.
Was ist der „mereologische Fehlschluss“?
Es ist der Fehler, Eigenschaften, die nur einem Ganzen (der Person) zukommen, fälschlicherweise seinen Teilen (dem Gehirn) zuzuschreiben – etwa die Behauptung, das Gehirn könne „denken“.
Was versteht man unter dem Begriff „Qualia“?
Qualia bezeichnen die subjektiven Erlebnisinhalte des Bewusstseins, also wie es sich „anfühlt“, einen bestimmten Zustand zu haben.
Können Gehirne laut Bennett und Hacker psychologische Prädikate besitzen?
Nein, sie argumentieren, dass psychologische Prädikate (wie denken, glauben, fühlen) nur auf die Person als Ganzes angewendet werden können, nicht auf das Gehirn.
Worin unterscheiden sich die Positionen von Searle und Dennett?
Während Searle das Bewusstsein oft als biologisches Phänomen verteidigt, ist Dennett für seine funktionalistische Sichtweise bekannt, die das Bewusstsein teils als Illusion oder Konstrukt betrachtet.
- Citar trabajo
- Katharina Weber (Autor), 2012, Bewusstsein - eine Illusion?: Bennett, Hacker, Dennett und Searle über Neurowissenschaft und Philosophie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195429