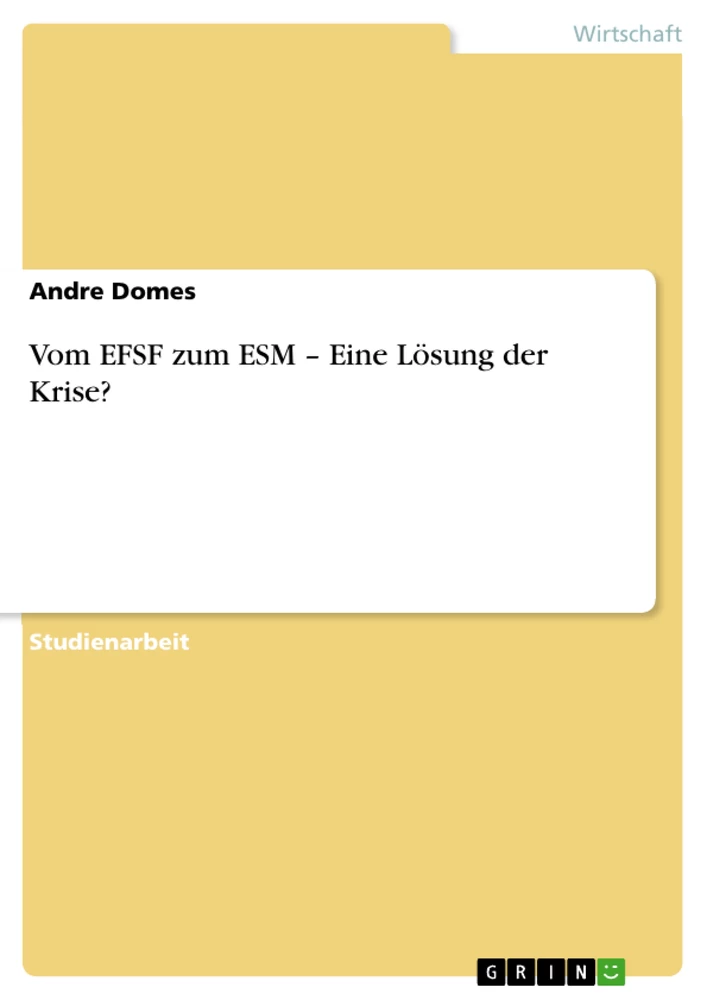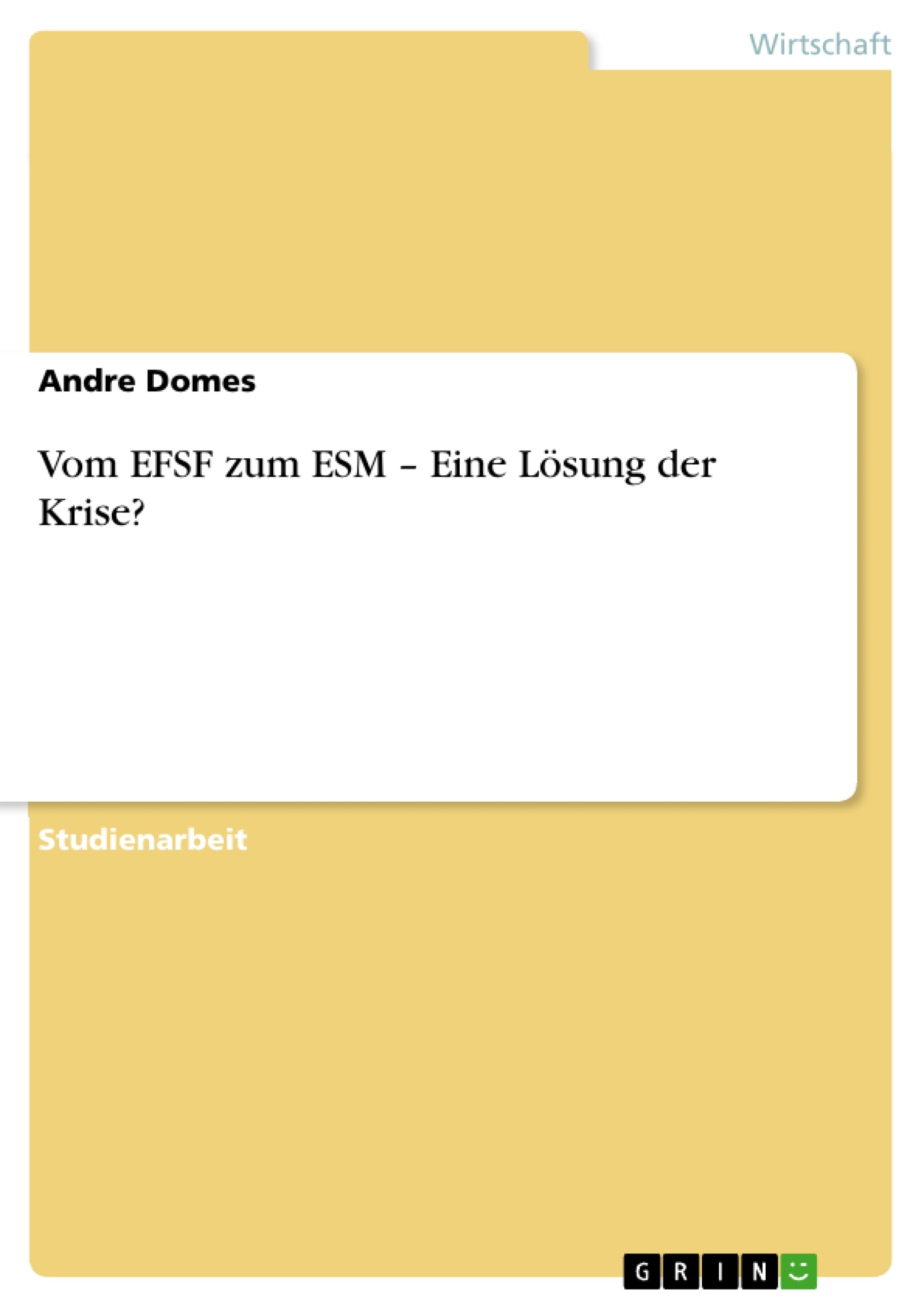Wie sagt man doch zumeist so lapidar: „jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“ Auf die Euro Gemeinschaft bezogen würde dies bedeuten: Die Gemeinschaft steht und fällt mit ihren schwächsten Mitgliedern.
Was dies besagt wird erst in jüngster Zeit so wirklich klar. Mit dem Installieren einer gemeinsamen Währungszone ist Europa nicht nur zusammengerückt, auch die Ungleichheit in Sachen Finanzierungskosten hat sich durch Konvergenz der Zinsen verbessert. Zum Vorteil gerade der Staaten, die nun an den Märkten im Fokus stehen. Eigentlich verwunderlich dass sich diese Vorteile letzten Endes als Übel herausstellen, war doch ein stabiler Euro von Anfang an oberste Prämisse einer gemeinsamen Währungsunion. Doch selbst die besten Gesetze sind nur bindend wenn geeignete Sanktionen bei Verstößen bestehen. Auch Deutschland hat in diesem Zusammenhang durch mehrmaligen Verstoß gegen die Kriterien Vertrauen der Investoren, vor allem aber Vertrauen unter den Mitgliedsstaaten verloren.
Verstärkt durch den externen Schock der Finanzkrise rund um die Lehman-Pleite, in deren Verlauf gerade Irland seine eigentlich solide Haushaltspolitik der Bankenrettung opfern musste, hat sich das Schuldenwachstum zu einem systemkritischen Problem entwickelt. Schlussendlich steht man irgendwann an dem Punkt an dem man heute angelangt ist.
Eine europaweite Staatsschuldenkrise beherrscht die Märkte und selbst die Lösungsversuche befeuern die Ängste noch weiter. Mit einem gemeinsamen Euro ist eine Abwertung der eigenen Währung leider kein Heilmittel mehr zur Wiederherstellung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und so werden Staaten an ihrer eigenen Basis angegriffen – der Finanzierung. Verlieren Investoren irgendwann das Vertrauen in ihre Schuldner lässt dies automatisch die Zinsen zur Finanzierung in die Höhe schnellen. Steigende Zinsen bedeutet höhere Verschuldung und vice versa. Ein Teufelskreis dem scheinbar ohne fremde Hilfe kein Entrinnen ist, der jedoch in einem gemeinsamen Währungsraum schnell weitere Brandherde entstehen lässt. Dieser Ansteckungsgefahr Herr zu werden ist nun Aufgabe der Gemeinschaft, um das Vertrauen der Märkte zurück zu gewinnen.
Wie dies durch Einführung verschiedener Rettungssysteme, im speziellen aber der Europäische Finanzstabilisierungsfazilität, kurz EFSF, gelungen ist und ob der EFSF ein geeignetes System zur Überwindung der Vertrauenskrise darstellt wird im Folgenden dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der EFSF
- 2.1 Ausstattung und Instrumente
- 2.1.1 Anfängliche Struktur
- 2.1.2 Angepasste Struktur
- 2.1.3 Mittelmaximierung durch Hebel
- 2.2 Maßnahmen
- 2.2.1 Programm für Irland
- 2.2.2 Programm für Portugal
- 3 Entscheidungen im Zeitverlauf
- 4 Der ESM
- 5 Schluss: Zusammenfassung und persönliche Einschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Entstehung und Wirkung des Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) als Reaktionen auf die europäische Staatsschuldenkrise. Die Arbeit untersucht die Instrumente und Maßnahmen beider Einrichtungen und bewertet deren Effektivität im Kontext der Bewältigung der Krise.
- Die Entwicklung und Struktur des EFSF
- Die Maßnahmen des EFSF zur Rettung von Irland und Portugal
- Die politischen Entscheidungen im Umgang mit der Krise
- Der Übergang vom EFSF zum ESM
- Die Auswirkungen der Krisenbewältigung auf die Eurozone
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen der Eurozone aufgrund der Ungleichgewichte in den Finanzierungskosten und der Verstärkung dieser Probleme durch die Finanzkrise 2008. Sie betont die systemische Natur der Staatsschuldenkrise und die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Lösungsansätze zur Wiederherstellung des Vertrauens der Märkte. Die Bedeutung der gemeinsamen Währung und die damit verbundenen Risiken werden hervorgehoben, wobei der Fokus auf den Teufelskreis aus steigenden Zinsen und zunehmender Verschuldung liegt. Die Arbeit leitet zur Notwendigkeit von Rettungssystemen wie dem EFSF über.
2 Der EFSF: Dieses Kapitel beleuchtet die Einrichtung und die Funktionsweise des EFSF. Es analysiert detailliert die Ausstattung und die Instrumente des EFSF, beginnend mit der anfänglichen Struktur und deren Anpassungen im Laufe der Zeit. Ein wichtiger Aspekt ist die Mittelmaximierung durch Hebelwirkung, die die Effektivität des EFSF deutlich erhöht hat. Darüber hinaus werden die konkreten Maßnahmen des EFSF im Rahmen der Rettungsprogramme für Irland und Portugal eingehend untersucht, wobei die einzelnen Finanzhilfen und ihre Bedingungen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Europäische Staatsschuldenkrise, EFSF, ESM, Eurozone, Finanzkrise, Rettungspakete, Irland, Portugal, Wettbewerbsfähigkeit, Staatsanleihen, Zinsen, Vertrauensverlust, Finanzstabilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Entstehung und Wirkung des Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) als Reaktionen auf die europäische Staatsschuldenkrise. Sie untersucht die Instrumente und Maßnahmen beider Einrichtungen und bewertet deren Effektivität bei der Bewältigung der Krise.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Struktur des EFSF, die Maßnahmen des EFSF zur Rettung von Irland und Portugal, die politischen Entscheidungen im Umgang mit der Krise, den Übergang vom EFSF zum ESM und die Auswirkungen der Krisenbewältigung auf die Eurozone.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über den EFSF (inklusive Ausstattung, Instrumente und Maßnahmen in Irland und Portugal), ein Kapitel über Entscheidungen im Zeitverlauf, ein Kapitel über den ESM und abschließend eine Zusammenfassung und persönliche Einschätzung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was sind die wichtigsten Aspekte des EFSF, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit beleuchtet detailliert die Ausstattung und die Instrumente des EFSF, einschließlich der anfänglichen Struktur, deren Anpassungen und der Mittelmaximierung durch Hebelwirkung. Die konkreten Maßnahmen des EFSF im Rahmen der Rettungsprogramme für Irland und Portugal werden eingehend untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Staatsschuldenkrise, EFSF, ESM, Eurozone, Finanzkrise, Rettungspakete, Irland, Portugal, Wettbewerbsfähigkeit, Staatsanleihen, Zinsen, Vertrauensverlust, Finanzstabilität.
Was ist der Fokus der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen der Eurozone durch Ungleichgewichte in den Finanzierungskosten, die Verstärkung dieser Probleme durch die Finanzkrise 2008 und die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Lösungsansätze. Sie betont den Teufelskreis aus steigenden Zinsen und zunehmender Verschuldung und leitet zur Notwendigkeit von Rettungssystemen wie dem EFSF über.
Welche konkreten Maßnahmen des EFSF werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert die Programme des EFSF für Irland und Portugal, inklusive der jeweiligen Finanzhilfen und Bedingungen.
Welche Bedeutung hat der Übergang vom EFSF zum ESM?
Der Übergang vom EFSF zum ESM wird als ein wichtiger Aspekt der Krisenbewältigung behandelt und analysiert.
Wie wird die Effektivität des EFSF und ESM bewertet?
Die Seminararbeit bewertet die Effektivität der Maßnahmen des EFSF und ESM im Kontext der Bewältigung der europäischen Staatsschuldenkrise.
- Quote paper
- Andre Domes (Author), 2011, Vom EFSF zum ESM – Eine Lösung der Krise?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194956