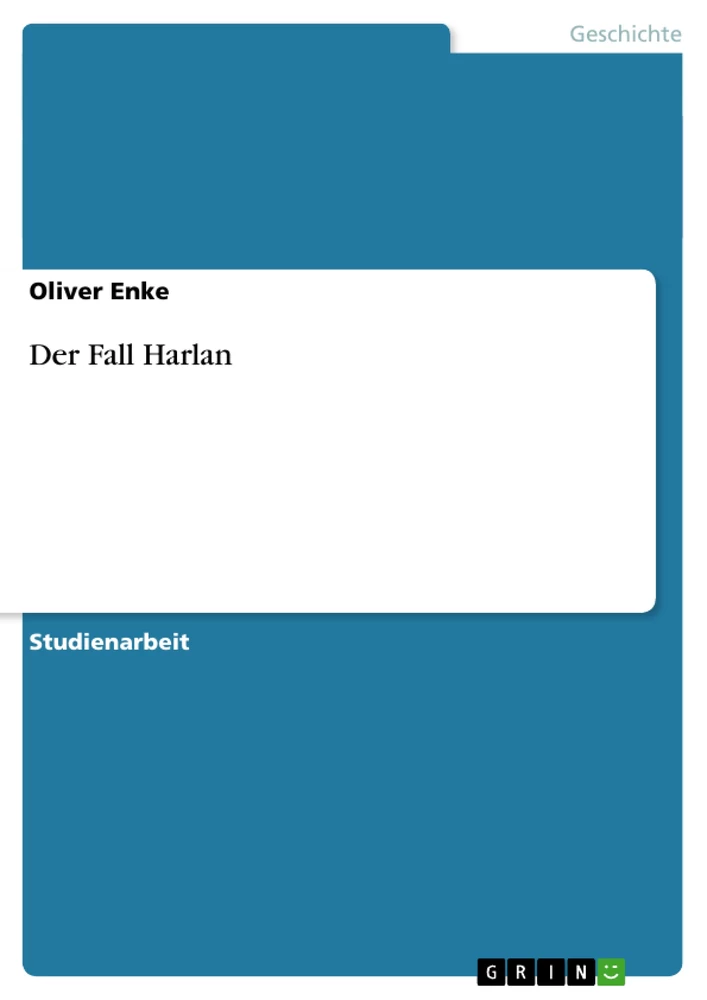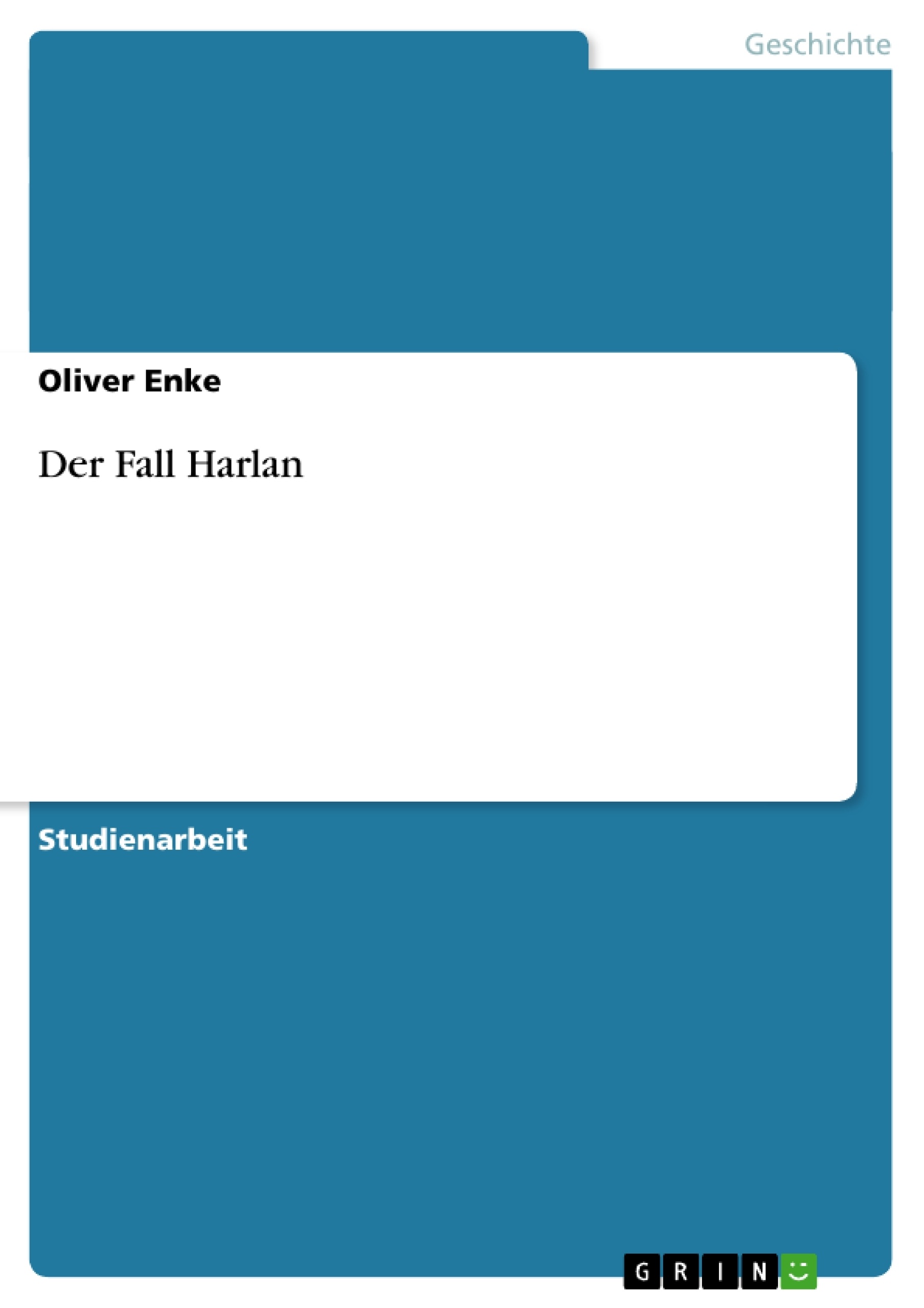Veit Harlan macht schnell Karriere. Als Filmemacher im Deutschland der dreißiger Jahre verläuft seine Erfolgskurve steiler und schneller nach oben, als die seiner Kollegen. Diese Meinung vertritt zumindest Wolfgang Kraushaar in seiner 1995 erschienenen Analyse „Der Kampf gegen den ‚Jud-Süß’-Regisseur Veit Harlan“1. Der Grund für seinen überragenden Erfolg als Drehbuchautor und Regisseur liege dem zu Folge in dem Film „Jud Süß“. Den 1940 erschienenen Streifen hatten bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges allein im Deutschen Reich über 22 Millionen Menschen gesehen. Rund sechs Millionen Reichsmark, das Dreifache seiner damaligen Produktionskosten, hatte der Film innerhalb von nur 15 Monaten eingespielt. „Jud Süß“ ist nach dem Kriegsende verboten. Herbert Pardo und Siegfried Schiffner bezeichnen den Film 1949 als „einen psychologischen Wegbereiter für die späteren Massenermordungen in den Konzentrationslagern“2. Veit Harlan beantragt kurz nach Kriegsende ein Entnazifizierungs-Verfahren für sich selbst, um möglichst bald wieder als Filmschaffender tätig werden zu können. Als die Presse Anfang des Jahres 1948 berichtet, Harlan solle vom zuständigen Zentralausschuss für die Ausschaltung von Nationalsozialisten in Hamburg als „unbelastet“ eingestuft werden, spitzt sich der öffentliche Konflikt um den „Prestige-Regisseur der Nazis“ zu. Die Hamburger Staatsanwaltschaft erhebt im Juli 1948 Anklage gegen Veit Harlan wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Dem Freispruch Harlans durch das Landgericht Hamburg folgt eine Revisionsverhandlung, wiederum am Landgericht in Hamburg. Das Verfahren endet wiederum mit einem Freispruch Harlans. Der Regisseur setzt seine Karriere fort, dreht einen weiteren Film namens „Unsterbliche Geliebte“. Gegen diesen Film ruft Erich Lüth, Leiter der staatlichen Pressestelle, am 20. September 1950 zum Boykott auf. Wenig später verhängt die 15. Zivilkammer des Landgerichts Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen Lüth, die ihm weitere Boykottaufrufe untersagt. Teile der deutschen Bevölkerung, der Politiker und der Presse wenden sich in der Folge auf der Seite von Lüth gegen neue Arbeiten Harlans. Lüth legt beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Beschwerde gegen das Urteil ein, er beruft sich auf sein in Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschriebenes Recht der „freien Meinungsäußerung“. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veit Harlan - Symbol des Antisemitismus in Deutschland?
- Der antisemitische Propagandafilm „Jud Süß“
- Die Harlan-Prozesse – Skandalisierung und Medienrummel
- Freispruch - ein Skandal?
- Erich Lüth - Symbol eines „Anderen Deutschland\"?
- Recht vs. Moral - Die Boykott-Aufrufe gegen Harlan-Filme
- Das Lüth-Urteil – ein später Wegweiser für die Deutschen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Debatte um den Regisseur Veit Harlan und seinen Film „Jud Süß“ in der Bundesrepublik Deutschland der späten 1940er und frühen 1950er Jahre. Im Zentrum stehen die Harlan-Prozesse, der Boykottaufruf von Erich Lüth und die Frage, wie verschiedene Teile der deutschen Gesellschaft mit dem Antisemitismus in der Nachkriegszeit umgingen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein Bild vom „Antisemitismus im Nachkriegsdeutschland“ zu zeichnen und die Rolle der Medien, der Politik und der Justiz in dieser Debatte zu untersuchen.
- Die Rolle von Veit Harlan als Symbol des Antisemitismus in Deutschland
- Die Bedeutung des Films „Jud Süß“ für die NS-Propaganda
- Die Harlan-Prozesse als Spiegel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
- Der Boykottaufruf von Erich Lüth und seine Bedeutung für die Meinungsfreiheit
- Der Einfluss von Medien, Politik und Justiz auf die öffentliche Debatte um den Antisemitismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt den Kontext der Arbeit dar, indem es die Bedeutung des Films „Jud Süß“ und die Harlan-Prozesse in den Zusammenhang der deutschen Nachkriegsgeschichte stellt.
- Veit Harlan - Symbol des Antisemitismus in Deutschland?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Karriere von Veit Harlan im NS-Deutschland, analysiert den antisemitischen Propagandafilm „Jud Süß“ und die Prozesse gegen Harlan nach dem Krieg.
- Erich Lüth - Symbol eines „Anderen Deutschland\"?: Dieses Kapitel beleuchtet den Boykottaufruf von Erich Lüth gegen einen neuen Film Harlans und die anschließende juristische Auseinandersetzung um die Meinungsfreiheit.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Veit Harlan, „Jud Süß“, Erich Lüth, Boykott, Nachkriegsdeutschland, NS-Vergangenheit, Meinungsfreiheit, Medien, Politik, Justiz.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Veit Harlan und warum ist er umstritten?
Veit Harlan war ein Regisseur im Nationalsozialismus, der durch den antisemitischen Propagandafilm „Jud Süß“ bekannt wurde. Nach dem Krieg war er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, wurde jedoch freigesprochen.
Welche Bedeutung hatte der Film „Jud Süß“?
Der Film gilt als eines der bösartigsten Werke der NS-Propaganda und erreichte über 22 Millionen Zuschauer. Er wird als psychologischer Wegbereiter für den Holocaust eingestuft.
Was war der Anlass für das Lüth-Urteil?
Erich Lüth rief 1950 zum Boykott gegen Harlans neuen Film „Unsterbliche Geliebte“ auf. Das Landgericht verbot den Aufruf, woraufhin Lüth Verfassungsbeschwerde einlegte.
Warum ist das Lüth-Urteil für die Meinungsfreiheit so wichtig?
Das Bundesverfassungsgericht entschied zugunsten Lüths und stellte fest, dass Grundrechte (wie die Meinungsfreiheit) auch das Privatrecht beeinflussen („Ausstrahlungswirkung“). Es war ein wegweisendes Urteil für die deutsche Demokratie.
Wie reagierte die Justiz nach 1945 auf Veit Harlan?
Trotz massiver öffentlicher Proteste wurde Harlan in mehreren Prozessen freigesprochen, was zu heftigen Debatten über die moralische und rechtliche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit führte.
- Arbeit zitieren
- Oliver Enke (Autor:in), 2002, Der Fall Harlan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19401