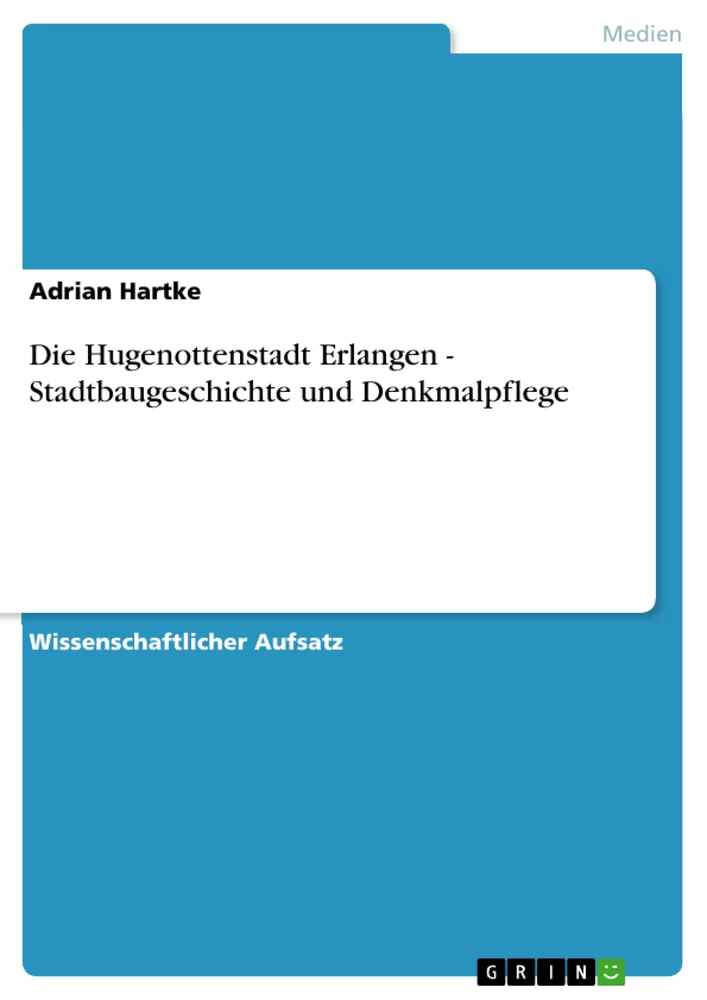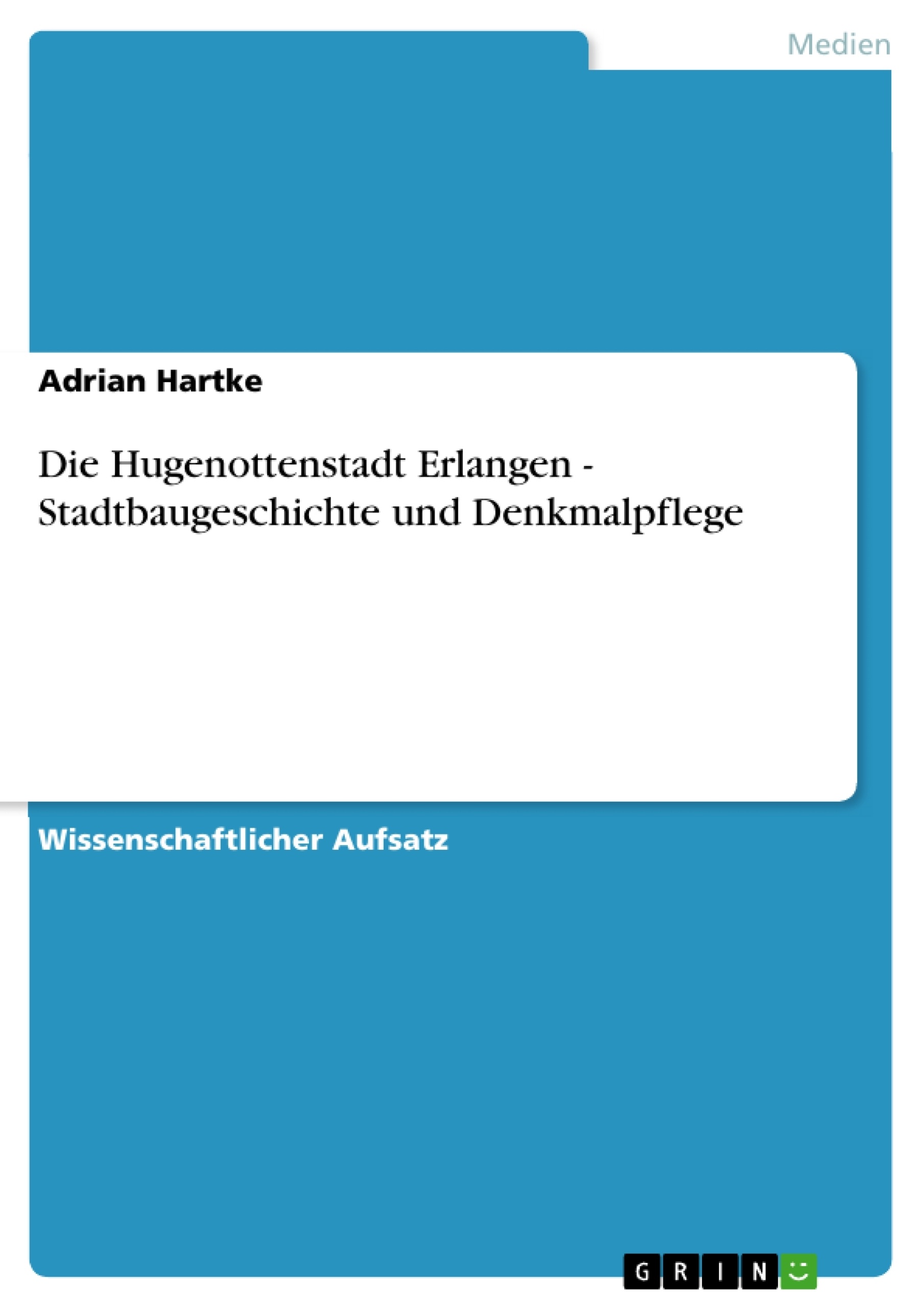Im 16. und 17. Jahrhundert gab die administrative Verdichtung der beherrschten Länder der Fürsten zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Spielraum. Der Dreißigjährige Krieg vollendete den finanziellen Verarmungsprozess der Städte und schwächte ihre Autonomie so stark, dass immer mehr Bereiche, vor allem aber die Wirtschaft, von der obrigkeitlichen Reglementierung erfasst wurden. So sollte das tägliche Leben der Bürger durch zahllose Gesetze von der Zunft- bis zur Kleiderordnung hin geregelt werden. Mit den immer stärkeren Regulierungen durch den Landesherrn und dem aufkommenden Kameralismus setzte in Deutschland die Gründung von Planstädten beziehungsweise planmäßig angelegten Städten auf fürstlichen Befehl ein. Diese Gründungen waren meist mit der Aufnahme einer größeren Gruppe von Flüchtlingen, also Personen, die noch kein eigenes Recht und keinen Besitz im Land hatten, verbunden. Vor allem wurden Hugenotten angeworben, die mit dem aufkommenden Absolutismus und der mit diesem eng verknüpften Konfessionalisierung aus Frankreich vertrieben wurden, nachdem das Toleranzedikt von Nantes von 1598 von König Ludwig XVI. mit dem Edikt von Fontainebleau aufgehoben worden ist. Die erste Planstadt auf deutschem Gebiet war die von Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth für hugenottische Glaubensflüchtlinge neu angelegte Stadt Erlang, wie Andreas Jakob betont, der die Geschichte Erlangens in dem Ausstellungskatalog (300 Jahre Hugenottenstadt Erlangen. Vom Nutzen der Toleranz, hrsg. von Christoph Friedrich) klar und fundiert darstellt. Dem Alfred Wendehorst gelingt es zwar auch die Geschichte chronologisch und detailliert dem Leser nahe zu bringen, jedoch scheint er zeitweilig von der Perspektive des Wissenschaftlers in die des schwärmenden Heimatforschers hineinzugeraten. Bevor ich die Geschichte der Hugenottenstadt Erlangen en detail aufzeigen werde, möchte ich jedoch einen kurzen Abriss zur Geschichte vor der Errichtung der Neustadt geben, um die geographischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Geschichte der Stadt Erlangen bis 1685
- 2. Vorgeschichte zum Bau der Neustadt
- 3. Plan des Johann Moritz Richter
- 3.1 Maße und Aufbau des Plans
- 3.2 Ausführung des Plans
- 3.4 Die bauliche Gestalt der Stadt
- 3.4.1 Das Normhaus
- 3.4.2 Idealplan und Realisierung
- 4. Die Erweiterungen der Stadt
- 4.1 Das Schloss und repräsentative Bauten des Hofes
- 4.2 Der Brand der Altstadt
- 4.3 Der Schlossgarten und die Erweiterungskampagnen von 1720
- 4.4 Adelspalais und repräsentative Bauten der Stadt
- 5. Der Niedergang der Stadt
- 6. Die Veränderung der Barockstadt
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Stadt Erlangen, insbesondere die Entstehung und Planung der Neustadt im späten 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Rolle der Hugenotten als Gründungsbevölkerung und der Umsetzung eines idealisierten Stadtplans nach den Prinzipien des Barocks. Die Arbeit analysiert die planmäßige Anlage der Stadt, ihre architektonische Gestaltung und ihre Entwicklung im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit.
- Die Geschichte Erlangens vor der Gründung der Neustadt
- Die Planung und der Bau der Neustadt durch Johann Moritz Richter
- Die Rolle der Hugenotten bei der Stadtgründung
- Die architektonische Gestaltung und die Prinzipien des Stadtplans
- Die Bedeutung des Plans im Kontext des frühneuzeitlichen Städtebaus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der Stadtgründungen im 17. Jahrhundert, geprägt von absolutistischer Herrschaft und dem Zustrom hugenottischer Flüchtlinge. Sie führt in die Thematik der Planstädte ein und benennt wichtige Quellen und deren unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte Erlangens. Der Fokus liegt auf der bevorstehenden detaillierten Darstellung der Geschichte Erlangens und ihrer Vorgeschichte.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Die Geschichte der Stadt Erlangen bis 1685: Dieses Kapitel skizziert die Geschichte Erlangens bis zum Bau der Neustadt. Es beschreibt die erste urkundliche Erwähnung, die Verleihung der Stadtrechte und die vergleichsweise unbedeutende wirtschaftliche Stellung der Stadt bis zum späten 17. Jahrhundert. Die geographische Lage und die geringe Bevölkerungszahl werden hervorgehoben, um den Kontrast zur späteren Entwicklung darzustellen.
II. Hauptteil, Kapitel 2. Vorgeschichte zum Bau der Neustadt: Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe und die Entscheidungsfindung zum Bau der Erlanger Neustadt. Es thematisiert die Motivation des Markgrafen Christian Ernst, Hugenotten anzusiedeln und eine neue Stadt zu gründen, um wirtschaftlichen Aufschwung und politischen Ruhm zu erlangen. Die Entscheidung für den Standort Erlangen gegenüber Baiersdorf wird erklärt, und die Rolle der Hugenotten als Hauptinvestoren im Projekt wird hervorgehoben.
II. Hauptteil, Kapitel 3. Plan des Johann Moritz Richter: Kapitel 3 analysiert den Stadtplan von Johann Moritz Richter, der die Grundlage für die Neustadt bildete. Es beschreibt die geometrischen Prinzipien des Plans, die Anordnung der Plätze und Straßen sowie die Maßverhältnisse, die auf harmonischen Proportionen basieren und das Prinzip des Goldenen Schnitts aufzeigen. Die Einheitlichkeit und Vollständigkeit des Plans sowie die Implikation, dass Erweiterungen ausgeschlossen waren, werden diskutiert.
II. Hauptteil, Kapitel 3.1 Maße und Aufbau des Plans: Dieses Unterkapitel befasst sich detailliert mit den Maßen und dem Aufbau des Stadtplans. Die außergewöhnliche rechteckige Form, die Anordnung der beiden Plätze („Grand Place“ und „Place devant le Temple et la Douane“), und deren Beziehung zueinander werden im Detail erklärt. Die präzise mathematische und geometrische Ausgestaltung des Planes mit seinen Proportionen, insbesondere die mehrfachige Anwendung des Goldenen Schnitts, wird als Kernmerkmal hervorgehoben.
II. Hauptteil, Kapitel 4. Die Erweiterungen der Stadt: Dieses Kapitel würde die Erweiterungen der Stadt nach dem ursprünglichen Plan von Richter behandeln (da diese im vorliegenden Textauszug nicht enthalten sind, kann hier keine Zusammenfassung geliefert werden).
II. Hauptteil, Kapitel 5. Der Niedergang der Stadt: Dieses Kapitel würde den Niedergang der Stadt beschreiben (da dies im vorliegenden Textauszug nicht enthalten ist, kann hier keine Zusammenfassung geliefert werden).
II. Hauptteil, Kapitel 6. Die Veränderung der Barockstadt: Dieses Kapitel würde die Veränderungen der Stadt in der Barockzeit behandeln (da dies im vorliegenden Textauszug nicht enthalten ist, kann hier keine Zusammenfassung geliefert werden).
Schlüsselwörter
Erlangen, Neustadt, Hugenotten, Stadtplanung, Johann Moritz Richter, Barock, Planstadt, Goldener Schnitt, Stadtgeschichte, Frühneuzeit, Absolutismus, Konfessionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschichte der Stadt Erlangen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Stadt Erlangen, insbesondere die Entstehung und Planung der Neustadt im späten 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Rolle der Hugenotten, der Umsetzung eines idealisierten Stadtplans nach barocken Prinzipien, der planmäßigen Anlage, der architektonischen Gestaltung und der Entwicklung im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte Erlangens vor der Gründung der Neustadt, die Planung und den Bau der Neustadt durch Johann Moritz Richter, die Rolle der Hugenotten, die architektonische Gestaltung und die Prinzipien des Stadtplans sowie die Bedeutung des Plans im Kontext des frühneuzeitlichen Städtebaus. Die Kapitel befassen sich detailliert mit den Maßen und dem Aufbau des Stadtplans, einschließlich der Anwendung des Goldenen Schnitts. Geplant sind auch Kapitel über die Erweiterungen der Stadt, ihren Niedergang und die Veränderungen in der Barockzeit (jedoch nicht im vorliegenden Auszug enthalten).
Welche Quellen werden verwendet?
Die Einleitung erwähnt unterschiedliche Quellen und deren Perspektiven auf die Geschichte Erlangens. Die konkreten Quellen werden im vorliegenden Auszug jedoch nicht genannt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil unterteilt sich in Kapitel zur Geschichte Erlangens vor 1685, zur Vorgeschichte des Baus der Neustadt, zum Plan von Johann Moritz Richter (inkl. detaillierter Analyse von Maßen und Aufbau), zu den Erweiterungen der Stadt, zum Niedergang der Stadt und zu den Veränderungen der Barockstadt. Der Auszug enthält jedoch nur Zusammenfassungen der Einleitung und einiger Kapitel des Hauptteils.
Welche Rolle spielten die Hugenotten?
Die Hugenotten spielten eine zentrale Rolle bei der Stadtgründung. Sie wurden vom Markgrafen Christian Ernst angesiedelt, um wirtschaftlichen Aufschwung und politischen Ruhm zu erlangen. Die Arbeit hebt ihre Bedeutung als Hauptinvestoren hervor.
Welche Bedeutung hat der Stadtplan von Johann Moritz Richter?
Der Stadtplan von Johann Moritz Richter ist das zentrale Element der Arbeit. Er wird detailliert analysiert, wobei die geometrischen Prinzipien, die Anordnung der Plätze und Straßen sowie die auf harmonischen Proportionen und dem Goldenen Schnitt basierenden Maßverhältnisse im Mittelpunkt stehen. Die Einheitlichkeit und Vollständigkeit des Plans werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erlangen, Neustadt, Hugenotten, Stadtplanung, Johann Moritz Richter, Barock, Planstadt, Goldener Schnitt, Stadtgeschichte, Frühneuzeit, Absolutismus, Konfessionalisierung.
Welche Kapitel sind im Auszug nicht vollständig enthalten?
Die Kapitel über die Erweiterungen der Stadt, den Niedergang der Stadt und die Veränderungen der Barockstadt sind im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten und können daher nicht zusammengefasst werden.
Für welche Zielgruppe ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich für die Stadtgeschichte Erlangens, Stadtplanung im Barock und die Rolle der Hugenotten interessiert.
- Citar trabajo
- Adrian Hartke (Autor), 2004, Die Hugenottenstadt Erlangen - Stadtbaugeschichte und Denkmalpflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193962