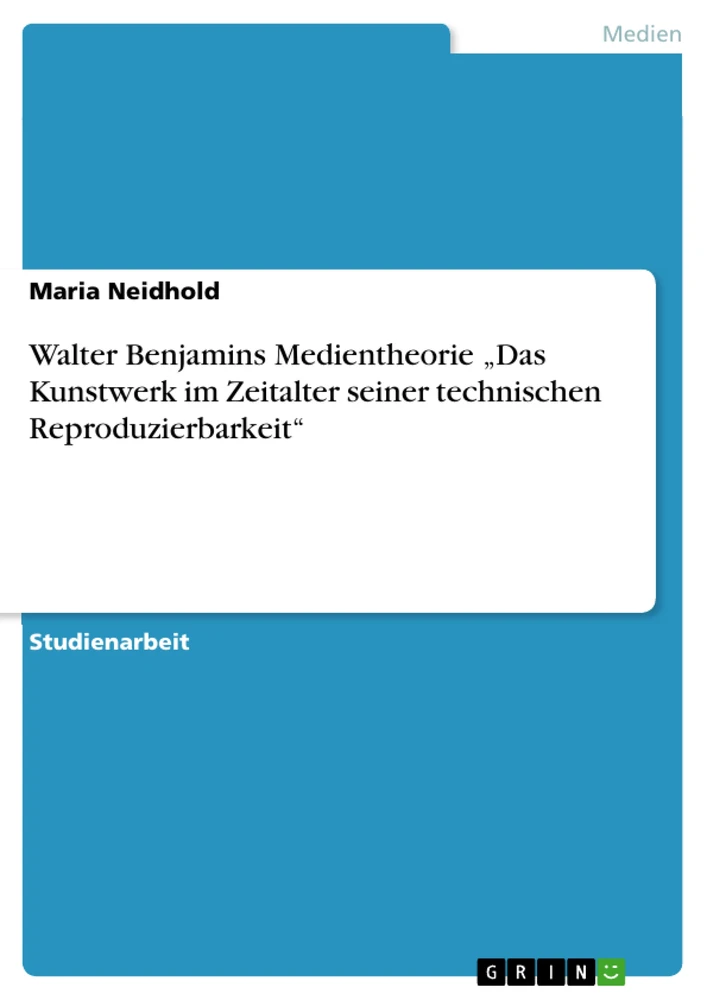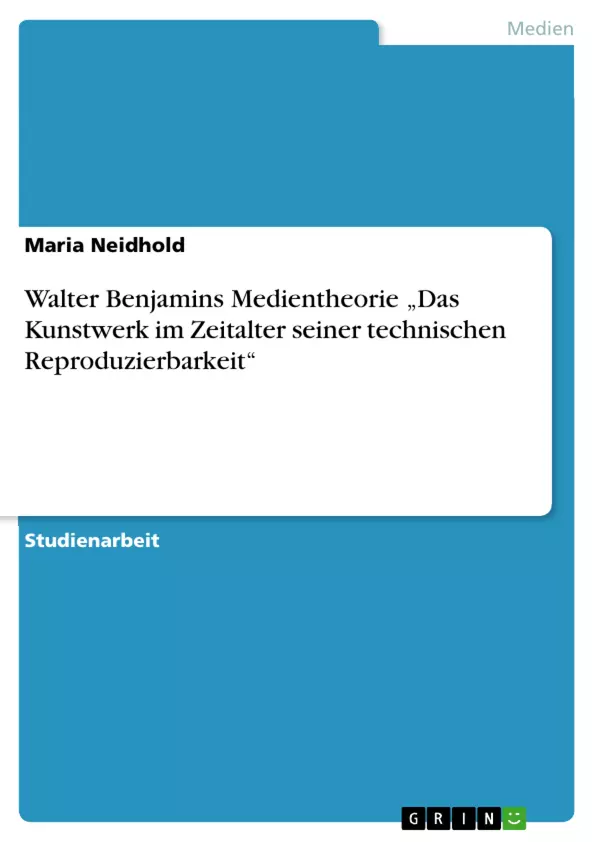Film und Fotografie sind in der heutigen Mediengesellschaft zu einem wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Fotoapparate und Videokameras sind längst nicht mehr professionellen Fotografen, Filme-machern oder enthusiastischen Amateuren vorenthalten. Sie lassen sich heutzutage, außer in Ihrer ursprünglichen Form, auch als Hybrid in Handys, Computern oder MP3-Playern wieder finden. Und die Forschung ist hierbei noch lange nicht an ihrem Höhepunkt angelangt, wobei die Entwicklung von dreidimensionalem Foto- und Videomaterial wohl den nächsten großen Schritt bedeutet. Festzuhalten bleibt, dass durch Massenproduktion und Vereinfachung der Geräte Film und Foto zu einem Massenphänomen geworden sind, an denen jeder teilhaben kann. Durch diesen unaufhaltsamen Fortschritt ist es umso wichtiger, sich die Auswirkungen, wie es Walter Benjamin in seiner Medientheorie: „Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduktion“ tut, vor Augen zu halten. Dabei geht er vor allem auf die Aura des Kunstwerkes und die Bedeutung der massenhaften Reproduktion in den 30er Jahren ein. Mir stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: „Was bedeutet die Reproduzierbarkeit für die Kunst aus heutiger Sicht?“ Zur Beantwortung der Frage werde ich zunächst kurz auf die Person Walter Benjamins eingehen und die Entstehungsgeschichte seiner Arbeit, bevor ich im Hauptteil die zentralen Aussagen aus seiner Medientheorie herausarbeite und dessen zeitgenössischen Zusammenhang näher erläutere. Abschließend folgt ein Fazit mit einer kurzen Zusammenfassung und der Beantwortung der eingangsgestellten Frage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeithistorische Einordnung Walter Benjamin und die Entstehungsgeschichte seiner Medientheorie
- Zentrale Aussagen der Medientheorie
- Begriff der Reproduzierbarkeit
- Begriff der Aura
- Die Medientheorie im zeitgenössischen Zusammenhang
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Walter Benjamins Medientheorie „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ analysiert die Auswirkungen der Massenreproduzierbarkeit von Kunstwerken auf deren Wert und Bedeutung. Der Text untersucht, wie die Reproduktionsprozesse von Fotografie und Film die Aura des Kunstwerkes verändern und welche Folgen dies für die Kunst und deren Rezeption hat.
- Der Einfluss der technischen Reproduzierbarkeit auf die Aura des Kunstwerkes
- Die Veränderung der Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachter im Zeitalter der Reproduzierbarkeit
- Die Bedeutung der Massenproduktion und des technischen Fortschritts für die Entwicklung der Kunst
- Die politische Dimension der Medientheorie und die Verbindung zwischen Kunst, Technologie und Gesellschaft
- Die Aktualität von Benjamins Gedanken für die heutige Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Buches führt in die Thematik der Medientheorie ein und stellt die Frage nach den Auswirkungen der Reproduzierbarkeit auf die Kunst aus heutiger Sicht. Kapitel 2 widmet sich der zeithistorischen Einordnung von Walter Benjamin und der Entstehungsgeschichte seiner Medientheorie. In diesem Kapitel werden die biographischen Aspekte Benjamins beleuchtet und die Entstehung des Textes im Kontext der politischen und kulturellen Veränderungen der 1930er Jahre erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit den zentralen Aussagen der Medientheorie, wobei der Fokus auf den Begriffen der Reproduzierbarkeit und der Aura liegt. In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten der Reproduktion beleuchtet und deren Einfluss auf die Wertigkeit von Kunstwerken analysiert.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Medientheorie, Kunstwerk, technische Reproduzierbarkeit, Aura, Fotografie, Film, Massenproduktion, Medienwandel, Werteverfall, Marxismus, historischer Materialismus, zeitgenössischer Zusammenhang.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Walter Benjamin unter der "Aura" eines Kunstwerks?
Die Aura ist das einmalige Erscheinen einer Ferne, so nah sie sein mag – das Hier und Jetzt des Originals, das durch Reproduktion verloren geht.
Wie verändert technische Reproduzierbarkeit die Kunst?
Sie führt zu einem Verfall der Aura, ermöglicht aber gleichzeitig die massenhafte Rezeption und verändert die politische Funktion der Kunst.
Warum sind Film und Fotografie zentrale Medien in Benjamins Theorie?
Diese Medien sind von Natur aus auf Reproduzierbarkeit angelegt und markieren den Übergang zur modernen Mediengesellschaft.
Wann entstand Benjamins Medientheorie?
Der Text wurde in den 1930er Jahren verfasst, geprägt durch die politischen Umbrüche und den aufkommenden Faschismus.
Welche Bedeutung hat die Theorie für die heutige Zeit?
In Zeiten von digitalen Kopien und Smartphones ist die Frage nach dem Wert des Originals und der massenhaften Verbreitung aktueller denn je.
- Quote paper
- Maria Neidhold (Author), 2011, Walter Benjamins Medientheorie „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193951